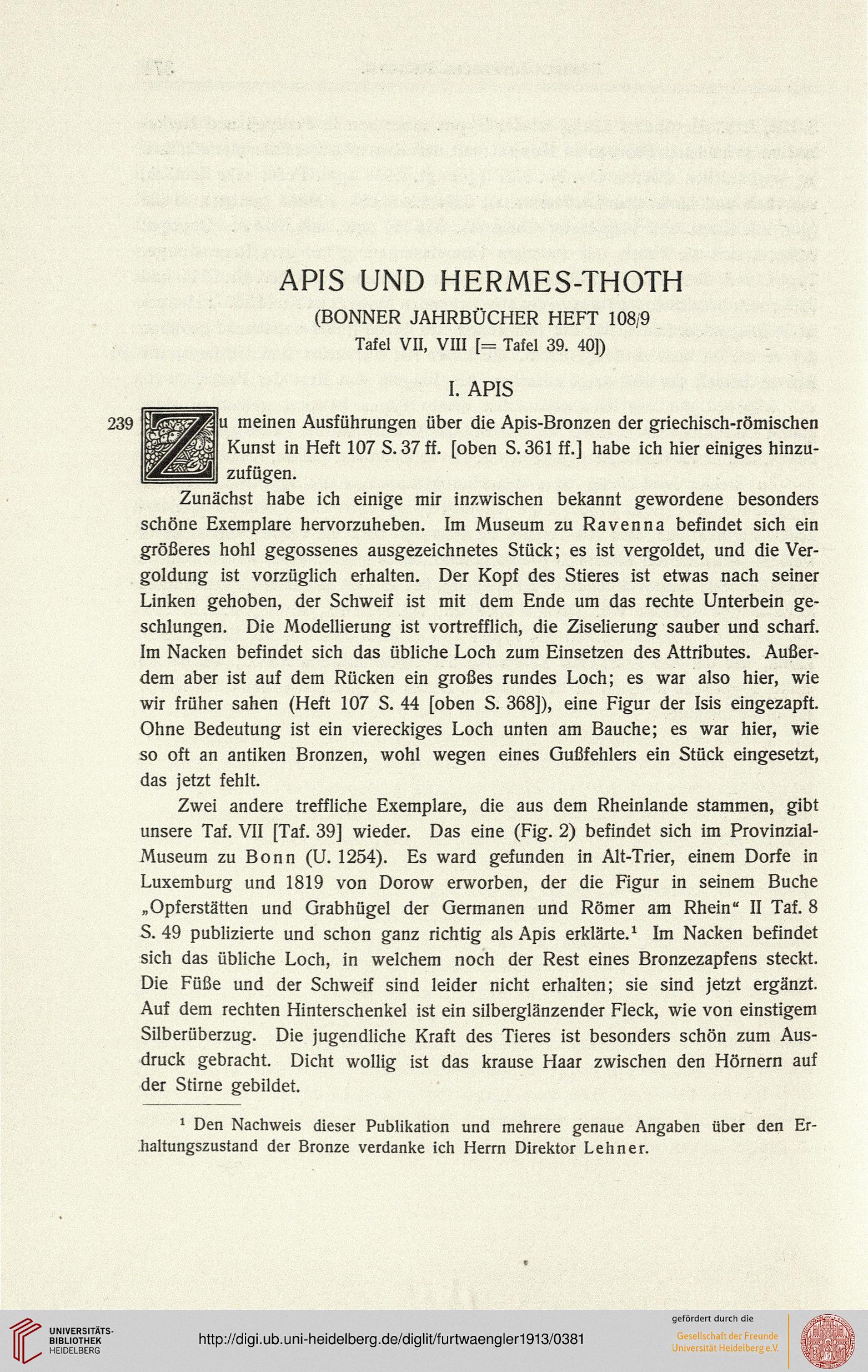APIS UND HERMES-THOTH
(BONNER JAHRBÜCHER HEFT 108/9
Tafel VII, VIII [= Tafel 39. 40])
I. APIS
239 §|1 §| u meinen Ausführungen über die Apis-Bronzen der griechisch-römischen
Kunst in Heft 107 S. 37 ff. [oben S. 361 ff.] habe ich hier einiges hinzu-
zufügen.
Zunächst habe ich einige mir inzwischen bekannt gewordene besonders
schöne Exemplare hervorzuheben. Im Museum zu Ravenna befindet sich ein
größeres hohl gegossenes ausgezeichnetes Stück; es ist vergoldet, und die Ver-
goldung ist vorzüglich erhalten. Der Kopf des Stieres ist etwas nach seiner
Linken gehoben, der Schweif ist mit dem Ende um das rechte Unterbein ge-
schlungen. Die Modellierung ist vortrefflich, die Ziselierung sauber und scharf.
Im Nacken befindet sich das übliche Loch zum Einsetzen des Attributes. Außer-
dem aber ist auf dem Rücken ein großes rundes Loch; es war also hier, wie
wir früher sahen (Heft 107 S. 44 [oben S. 368]), eine Figur der Isis eingezapft.
Ohne Bedeutung ist ein viereckiges Loch unten am Bauche; es war hier, wie
so oft an antiken Bronzen, wohl wegen eines Gußfehlers ein Stück eingesetzt,
das jetzt fehlt.
Zwei andere treffliche Exemplare, die aus dem Rheinlande stammen, gibt
unsere Taf. VII [Taf. 39] wieder. Das eine (Fig. 2) befindet sich im Provinzial-
Museum zu Bonn (U. 1254). Es ward gefunden in Alt-Trier, einem Dorfe in
Luxemburg und 1819 von Dorow erworben, der die Figur in seinem Buche
„Opferstätten und Grabhügel der Germanen und Römer am Rhein" II Taf. 8
S. 49 publizierte und schon ganz richtig als Apis erklärte.1 Im Nacken befindet
sich das übliche Loch, in welchem noch der Rest eines Bronzezapfens steckt.
Die Füße und der Schweif sind leider nicht erhalten; sie sind jetzt ergänzt.
Auf dem rechten Hinterschenkel ist ein silberglänzender Fleck, wie von einstigem
Silberüberzug. Die jugendliche Kraft des Tieres ist besonders schön zum Aus-
druck gebracht. Dicht wollig ist das krause Haar zwischen den Hörnern auf
der Stirne gebildet.
1 Den Nachweis dieser Publikation und mehrere genaue Angaben über den Er-
haltungszustand der Bronze verdanke ich Herrn Direktor Lehn er.
(BONNER JAHRBÜCHER HEFT 108/9
Tafel VII, VIII [= Tafel 39. 40])
I. APIS
239 §|1 §| u meinen Ausführungen über die Apis-Bronzen der griechisch-römischen
Kunst in Heft 107 S. 37 ff. [oben S. 361 ff.] habe ich hier einiges hinzu-
zufügen.
Zunächst habe ich einige mir inzwischen bekannt gewordene besonders
schöne Exemplare hervorzuheben. Im Museum zu Ravenna befindet sich ein
größeres hohl gegossenes ausgezeichnetes Stück; es ist vergoldet, und die Ver-
goldung ist vorzüglich erhalten. Der Kopf des Stieres ist etwas nach seiner
Linken gehoben, der Schweif ist mit dem Ende um das rechte Unterbein ge-
schlungen. Die Modellierung ist vortrefflich, die Ziselierung sauber und scharf.
Im Nacken befindet sich das übliche Loch zum Einsetzen des Attributes. Außer-
dem aber ist auf dem Rücken ein großes rundes Loch; es war also hier, wie
wir früher sahen (Heft 107 S. 44 [oben S. 368]), eine Figur der Isis eingezapft.
Ohne Bedeutung ist ein viereckiges Loch unten am Bauche; es war hier, wie
so oft an antiken Bronzen, wohl wegen eines Gußfehlers ein Stück eingesetzt,
das jetzt fehlt.
Zwei andere treffliche Exemplare, die aus dem Rheinlande stammen, gibt
unsere Taf. VII [Taf. 39] wieder. Das eine (Fig. 2) befindet sich im Provinzial-
Museum zu Bonn (U. 1254). Es ward gefunden in Alt-Trier, einem Dorfe in
Luxemburg und 1819 von Dorow erworben, der die Figur in seinem Buche
„Opferstätten und Grabhügel der Germanen und Römer am Rhein" II Taf. 8
S. 49 publizierte und schon ganz richtig als Apis erklärte.1 Im Nacken befindet
sich das übliche Loch, in welchem noch der Rest eines Bronzezapfens steckt.
Die Füße und der Schweif sind leider nicht erhalten; sie sind jetzt ergänzt.
Auf dem rechten Hinterschenkel ist ein silberglänzender Fleck, wie von einstigem
Silberüberzug. Die jugendliche Kraft des Tieres ist besonders schön zum Aus-
druck gebracht. Dicht wollig ist das krause Haar zwischen den Hörnern auf
der Stirne gebildet.
1 Den Nachweis dieser Publikation und mehrere genaue Angaben über den Er-
haltungszustand der Bronze verdanke ich Herrn Direktor Lehn er.