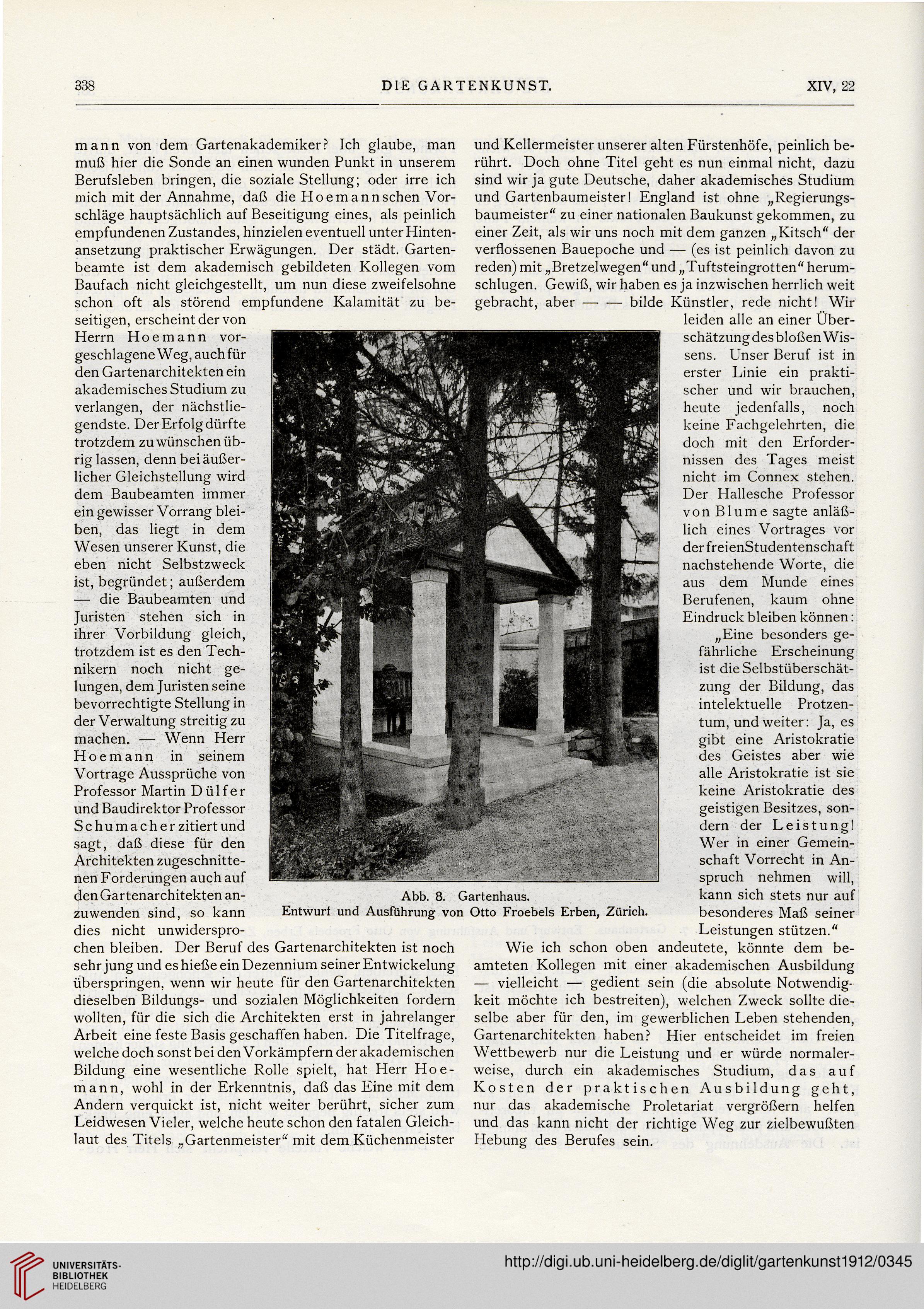338
DIE GARTENKUNST.
XIV, 22
mann von dem Gartenakademiker? Ich glaube, man
muß hier die Sonde an einen wunden Punkt in unserem
Berufsleben bringen, die soziale Stellung; oder irre ich
mich mit der Annahme, daß die Hoemannschen Vor-
schläge hauptsächlich auf Beseitigung eines, als peinlich
empfundenen Zustandes, hinzielen eventuell unter Hinten-
ansetzung praktischer Erwägungen. Der städt. Garten-
beamte ist dem akademisch gebildeten Kollegen vom
Baufach nicht gleichgestellt, um nun diese zweifelsohne
schon oft als störend empfundene Kalamität zu be-
seitigen, erscheint der von
Herrn Ho e mann vor-
geschlagene Weg, auch für
den Gartenarchitekten ein
akademisches Studium zu
verlangen, der nächstlie-
gendste. Der Erfolg dürfte
trotzdem zu wünschen üb-
riglassen, denn bei äußer-
licher Gleichstellung wird
dem Baubeamten immer
ein gewisser Vorrang blei-
ben, das liegt in dem
Wesen unserer Kunst, die
eben nicht Selbstzweck
ist, begründet; außerdem
— die Baubeamten und
Juristen stehen sich in
ihrer Vorbildung gleich,
trotzdem ist es den Tech-
nikern noch nicht ge-
lungen, dem Juristen seine
bevorrechtigte Stellung in
der Verwaltung streitig zu
machen. -— Wenn Herr
Hoemann in seinem
Vortrage Aussprüche von
Professor Martin Dülfer
und Baudirektor Professor
Schumacher zitiert und
sagt, daß diese für den
Architekten zugeschnitte-
nen Forderungen auch auf
den Gartenarchitekten an-
zuwenden sind, so kann
dies nicht unwiderspro-
chen bleiben. Der Beruf des Gartenarchitekten ist noch
sehr jung und es hieße ein Dezennium seiner Entwickelung
überspringen, wenn wir heute für den Gartenarchitekten
dieselben Bildungs- und sozialen Möglichkeiten fordern
wollten, für die sich die Architekten erst in jahrelanger
Arbeit eine feste Basis geschaffen haben. Die Titelfrage,
welche doch sonst bei den Vorkämpfern der akademischen
Bildung eine wesentliche Rolle spielt, hat Herr Hoe-
mann, wohl in der Erkenntnis, daß das Pline mit dem
Andern verquickt ist, nicht weiter berührt, sicher zum
Leidwesen Vieler, welche heute schon den fatalen Gleich-
laut des Titels „Gartenmeister“ mit dem Küchenmeister
und Kellermeister unserer alten Fürstenhöfe, peinlich be-
rührt. Doch ohne Titel geht es nun einmal nicht, dazu
sind wir ja gute Deutsche, daher akademisches Studium
und Gartenbaumeister! England ist ohne „Regierungs-
baumeister“ zu einer nationalen Baukunst gekommen, zu
einer Zeit, als wir uns noch mit dem ganzen „Kitsch“ der
verflossenen Bauepoche und — (es ist peinlich davon zu
reden) mit „Bretzelwegen“ und „Tuftsteingrotten“ herum-
schlugen. Gewiß, wir haben es ja inzwischen herrlich weit
gebracht, aber — — bilde Künstler, rede nicht! Wir
leiden alle an einer Über-
schätzung des bloßen Wis-
sens. Unser Beruf ist in
erster Linie ein prakti-
scher und wir brauchen,
heute jedenfalls, noch
keine Fachgelehrten, die
doch mit den Erforder-
nissen des Tages meist
nicht im Connex stehen.
Der Hallesche Professor
von Blume sagte anläß-
lich eines Vortrages vor
derfreienStudentenschaft
nachstehende Worte, die
aus dem Munde eines
Berufenen, kaum ohne
Eindruck bleiben können:
„Eine besonders ge-
fährliche Erscheinung
ist die Selbstüberschät-
zung der Bildung, das
intelektuelle Protzen-
tum, und weiter: Ja, es
gibt eine Aristokratie
des Geistes aber wie
alle Aristokratie ist sie
keine Aristokratie des
geistigen Besitzes, son-
dern der Leistung!
Wer in einer Gemein-
schaft Vorrecht in An-
spruch nehmen will,
kann sich stets nur auf
besonderes Maß seiner
Leistungen stützen.“
Wie ich schon oben andeutete, könnte dem be-
amteten Kollegen mit einer akademischen Ausbildung
— vielleicht — gedient sein (die absolute Notwendig-
keit möchte ich bestreiten), welchen Zweck sollte die-
selbe aber für den, im gewerblichen Leben stehenden,
Gartenarchitekten haben? Hier entscheidet im freien
Wettbewerb nur die Leistung und er würde normaler-
weise, durch ein akademisches Studium, das auf
Kosten der praktischen Ausbildung geht,
nur das akademische Proletariat vergrößern helfen
und das kann nicht der richtige Weg zur zielbewußten
Hebung des Berufes sein.
Abb. 8. Gartenhaus.
Entwurf und Ausführung von Otto Froebels Erben, Zürich.
DIE GARTENKUNST.
XIV, 22
mann von dem Gartenakademiker? Ich glaube, man
muß hier die Sonde an einen wunden Punkt in unserem
Berufsleben bringen, die soziale Stellung; oder irre ich
mich mit der Annahme, daß die Hoemannschen Vor-
schläge hauptsächlich auf Beseitigung eines, als peinlich
empfundenen Zustandes, hinzielen eventuell unter Hinten-
ansetzung praktischer Erwägungen. Der städt. Garten-
beamte ist dem akademisch gebildeten Kollegen vom
Baufach nicht gleichgestellt, um nun diese zweifelsohne
schon oft als störend empfundene Kalamität zu be-
seitigen, erscheint der von
Herrn Ho e mann vor-
geschlagene Weg, auch für
den Gartenarchitekten ein
akademisches Studium zu
verlangen, der nächstlie-
gendste. Der Erfolg dürfte
trotzdem zu wünschen üb-
riglassen, denn bei äußer-
licher Gleichstellung wird
dem Baubeamten immer
ein gewisser Vorrang blei-
ben, das liegt in dem
Wesen unserer Kunst, die
eben nicht Selbstzweck
ist, begründet; außerdem
— die Baubeamten und
Juristen stehen sich in
ihrer Vorbildung gleich,
trotzdem ist es den Tech-
nikern noch nicht ge-
lungen, dem Juristen seine
bevorrechtigte Stellung in
der Verwaltung streitig zu
machen. -— Wenn Herr
Hoemann in seinem
Vortrage Aussprüche von
Professor Martin Dülfer
und Baudirektor Professor
Schumacher zitiert und
sagt, daß diese für den
Architekten zugeschnitte-
nen Forderungen auch auf
den Gartenarchitekten an-
zuwenden sind, so kann
dies nicht unwiderspro-
chen bleiben. Der Beruf des Gartenarchitekten ist noch
sehr jung und es hieße ein Dezennium seiner Entwickelung
überspringen, wenn wir heute für den Gartenarchitekten
dieselben Bildungs- und sozialen Möglichkeiten fordern
wollten, für die sich die Architekten erst in jahrelanger
Arbeit eine feste Basis geschaffen haben. Die Titelfrage,
welche doch sonst bei den Vorkämpfern der akademischen
Bildung eine wesentliche Rolle spielt, hat Herr Hoe-
mann, wohl in der Erkenntnis, daß das Pline mit dem
Andern verquickt ist, nicht weiter berührt, sicher zum
Leidwesen Vieler, welche heute schon den fatalen Gleich-
laut des Titels „Gartenmeister“ mit dem Küchenmeister
und Kellermeister unserer alten Fürstenhöfe, peinlich be-
rührt. Doch ohne Titel geht es nun einmal nicht, dazu
sind wir ja gute Deutsche, daher akademisches Studium
und Gartenbaumeister! England ist ohne „Regierungs-
baumeister“ zu einer nationalen Baukunst gekommen, zu
einer Zeit, als wir uns noch mit dem ganzen „Kitsch“ der
verflossenen Bauepoche und — (es ist peinlich davon zu
reden) mit „Bretzelwegen“ und „Tuftsteingrotten“ herum-
schlugen. Gewiß, wir haben es ja inzwischen herrlich weit
gebracht, aber — — bilde Künstler, rede nicht! Wir
leiden alle an einer Über-
schätzung des bloßen Wis-
sens. Unser Beruf ist in
erster Linie ein prakti-
scher und wir brauchen,
heute jedenfalls, noch
keine Fachgelehrten, die
doch mit den Erforder-
nissen des Tages meist
nicht im Connex stehen.
Der Hallesche Professor
von Blume sagte anläß-
lich eines Vortrages vor
derfreienStudentenschaft
nachstehende Worte, die
aus dem Munde eines
Berufenen, kaum ohne
Eindruck bleiben können:
„Eine besonders ge-
fährliche Erscheinung
ist die Selbstüberschät-
zung der Bildung, das
intelektuelle Protzen-
tum, und weiter: Ja, es
gibt eine Aristokratie
des Geistes aber wie
alle Aristokratie ist sie
keine Aristokratie des
geistigen Besitzes, son-
dern der Leistung!
Wer in einer Gemein-
schaft Vorrecht in An-
spruch nehmen will,
kann sich stets nur auf
besonderes Maß seiner
Leistungen stützen.“
Wie ich schon oben andeutete, könnte dem be-
amteten Kollegen mit einer akademischen Ausbildung
— vielleicht — gedient sein (die absolute Notwendig-
keit möchte ich bestreiten), welchen Zweck sollte die-
selbe aber für den, im gewerblichen Leben stehenden,
Gartenarchitekten haben? Hier entscheidet im freien
Wettbewerb nur die Leistung und er würde normaler-
weise, durch ein akademisches Studium, das auf
Kosten der praktischen Ausbildung geht,
nur das akademische Proletariat vergrößern helfen
und das kann nicht der richtige Weg zur zielbewußten
Hebung des Berufes sein.
Abb. 8. Gartenhaus.
Entwurf und Ausführung von Otto Froebels Erben, Zürich.