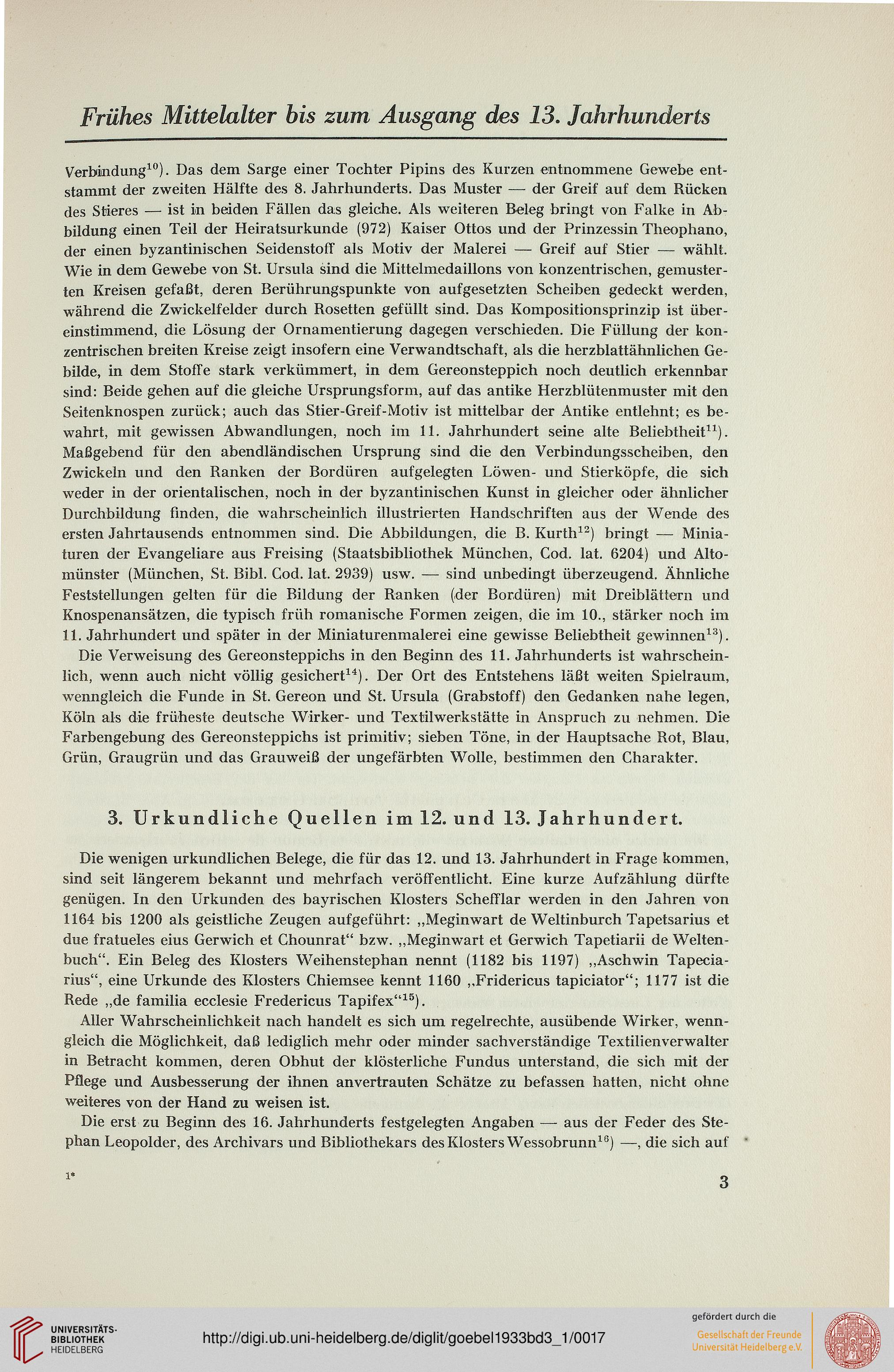Frühes Mittelalter bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts
Verbindung10). Das dem Sarge einer Tochter Pipins des Kurzen entnommene Gewebe ent-
stammt der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Das Muster — der Greif auf dem Rücken
des Stieres — ist in beiden Fällen das gleiche. Als weiteren Beleg bringt von Falke in Ab-
bildung einen Teil der Heiratsurkunde (972) Kaiser Ottos und der Prinzessin Theophano,
der einen byzantinischen Seidenstoff als Motiv der Malerei — Greif auf Stier — wählt.
Wie in dem Gewebe von St. Ursula sind die Mittelmedaillons von konzentrischen, gemuster-
ten Kreisen gefaßt, deren Berührungspunkte von aufgesetzten Scheiben gedeckt werden,
während die Zwickelfelder durch Rosetten gefüllt sind. Das Kompositionsprinzip ist über-
einstimmend, die Lösung der Ornamentierung dagegen verschieden. Die Füllung der kon-
zentrischen breiten Kreise zeigt insofern eine Verwandtschaft, als die herzblattähnlichen Ge-
bilde, in dem Stoffe stark verkümmert, in dem Gereonsteppich noch deutlich erkennbar
sind: Beide gehen auf die gleiche Ursprungsform, auf das antike Herzblütenmuster mit den
Seitenknospen zurück; auch das Stier-Greif-Motiv ist mittelbar der Antike entlehnt; es be-
wahrt, mit gewissen Abwandlungen, noch im 11. Jahrhundert seine alte Beliebtheit11).
Maßgebend für den abendländischen Ursprung sind die den Verbindungsscheiben, den
Zwickeln und den Ranken der Bordüren aufgelegten Löwen- und Stierköpfe, die sich
weder in der orientalischen, noch in der byzantinischen Kunst in gleicher oder ähnlicher
Durchbildung finden, die wahrscheinlich illustrierten Handschriften aus der Wende des
ersten Jahrtausends entnommen sind. Die Abbildungen, die B. Kurth12) bringt — Minia-
turen der Evangeliare aus Freising (Staatsbibliothek München, Cod. lat. 6204) und Alto-
münster (München, St. Bibl. Cod. lat. 2939) usw. — sind unbedingt überzeugend. Ähnliche
Feststellungen gelten für die Bildung der Ranken (der Bordüren) mit Dreiblättern und
Knospenansätzen, die typisch früh romanische Formen zeigen, die im 10., stärker noch im
11. Jahrhundert und später in der Miniaturenmalerei eine gewisse Beliebtheit gewinnen13).
Die Verweisung des Gereonsteppichs in den Beginn des 11. Jahrhunderts ist wahrschein-
lich, wenn auch nicht völlig gesichert14). Der Ort des Entstehens läßt weiten Spielraum,
wenngleich die Funde in St. Gereon und St. Ursula (Grabstoff) den Gedanken nahe legen,
Köln als die früheste deutsche Wirker- und Textilwerkstätte in Anspruch zu nehmen. Die
Farbengebung des Gereonsteppichs ist primitiv; sieben Töne, in der Hauptsache Rot, Blau,
Grün, Graugrün und das Grauweiß der ungefärbten Wolle, bestimmen den Charakter.
3. Urkundliche Quellen im 12. und 13. Jahrhundert.
Die wenigen urkundlichen Belege, die für das 12. und 13. Jahrhundert in Frage kommen,
sind seit längerem bekannt und mehrfach veröffentlicht. Eine kurze Aufzählung dürfte
genügen. In den Urkunden des bayrischen Klosters Schefflar werden in den Jahren von
1164 bis 1200 als geistliche Zeugen aufgeführt: „Meginwart de Weltinburch Tapetsarius et
due fratueles eius Gerwich et Chounrat" bzw. „Meginwart et Gerwich Tapetiarii de Welten-
buch". Ein Beleg des Klosters Weihenstephan nennt (1182 bis 1197) „Aschwin Tapecia-
rius", eine Urkunde des Klosters Chiemsee kennt 1160 ,,Fridericus tapiciator"; 1177 ist die
Rede „de familia ecclesie Fredericus Tapifex"15).
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um regelrechte, ausübende Wirker, wenn-
gleich die Möglichkeit, daß lediglich mehr oder minder sachverständige Textilienverwalter
in Betracht kommen, deren Obhut der klösterliche Fundus unterstand, die sich mit der
Pflege und Ausbesserung der ihnen anvertrauten Schätze zu befassen hatten, nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen ist.
Die erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts festgelegten Angaben — aus der Feder des Ste-
phan Leopolder, des Archivars und Bibliothekars des Klosters Wessobrunn16) —, die sich auf
Verbindung10). Das dem Sarge einer Tochter Pipins des Kurzen entnommene Gewebe ent-
stammt der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Das Muster — der Greif auf dem Rücken
des Stieres — ist in beiden Fällen das gleiche. Als weiteren Beleg bringt von Falke in Ab-
bildung einen Teil der Heiratsurkunde (972) Kaiser Ottos und der Prinzessin Theophano,
der einen byzantinischen Seidenstoff als Motiv der Malerei — Greif auf Stier — wählt.
Wie in dem Gewebe von St. Ursula sind die Mittelmedaillons von konzentrischen, gemuster-
ten Kreisen gefaßt, deren Berührungspunkte von aufgesetzten Scheiben gedeckt werden,
während die Zwickelfelder durch Rosetten gefüllt sind. Das Kompositionsprinzip ist über-
einstimmend, die Lösung der Ornamentierung dagegen verschieden. Die Füllung der kon-
zentrischen breiten Kreise zeigt insofern eine Verwandtschaft, als die herzblattähnlichen Ge-
bilde, in dem Stoffe stark verkümmert, in dem Gereonsteppich noch deutlich erkennbar
sind: Beide gehen auf die gleiche Ursprungsform, auf das antike Herzblütenmuster mit den
Seitenknospen zurück; auch das Stier-Greif-Motiv ist mittelbar der Antike entlehnt; es be-
wahrt, mit gewissen Abwandlungen, noch im 11. Jahrhundert seine alte Beliebtheit11).
Maßgebend für den abendländischen Ursprung sind die den Verbindungsscheiben, den
Zwickeln und den Ranken der Bordüren aufgelegten Löwen- und Stierköpfe, die sich
weder in der orientalischen, noch in der byzantinischen Kunst in gleicher oder ähnlicher
Durchbildung finden, die wahrscheinlich illustrierten Handschriften aus der Wende des
ersten Jahrtausends entnommen sind. Die Abbildungen, die B. Kurth12) bringt — Minia-
turen der Evangeliare aus Freising (Staatsbibliothek München, Cod. lat. 6204) und Alto-
münster (München, St. Bibl. Cod. lat. 2939) usw. — sind unbedingt überzeugend. Ähnliche
Feststellungen gelten für die Bildung der Ranken (der Bordüren) mit Dreiblättern und
Knospenansätzen, die typisch früh romanische Formen zeigen, die im 10., stärker noch im
11. Jahrhundert und später in der Miniaturenmalerei eine gewisse Beliebtheit gewinnen13).
Die Verweisung des Gereonsteppichs in den Beginn des 11. Jahrhunderts ist wahrschein-
lich, wenn auch nicht völlig gesichert14). Der Ort des Entstehens läßt weiten Spielraum,
wenngleich die Funde in St. Gereon und St. Ursula (Grabstoff) den Gedanken nahe legen,
Köln als die früheste deutsche Wirker- und Textilwerkstätte in Anspruch zu nehmen. Die
Farbengebung des Gereonsteppichs ist primitiv; sieben Töne, in der Hauptsache Rot, Blau,
Grün, Graugrün und das Grauweiß der ungefärbten Wolle, bestimmen den Charakter.
3. Urkundliche Quellen im 12. und 13. Jahrhundert.
Die wenigen urkundlichen Belege, die für das 12. und 13. Jahrhundert in Frage kommen,
sind seit längerem bekannt und mehrfach veröffentlicht. Eine kurze Aufzählung dürfte
genügen. In den Urkunden des bayrischen Klosters Schefflar werden in den Jahren von
1164 bis 1200 als geistliche Zeugen aufgeführt: „Meginwart de Weltinburch Tapetsarius et
due fratueles eius Gerwich et Chounrat" bzw. „Meginwart et Gerwich Tapetiarii de Welten-
buch". Ein Beleg des Klosters Weihenstephan nennt (1182 bis 1197) „Aschwin Tapecia-
rius", eine Urkunde des Klosters Chiemsee kennt 1160 ,,Fridericus tapiciator"; 1177 ist die
Rede „de familia ecclesie Fredericus Tapifex"15).
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um regelrechte, ausübende Wirker, wenn-
gleich die Möglichkeit, daß lediglich mehr oder minder sachverständige Textilienverwalter
in Betracht kommen, deren Obhut der klösterliche Fundus unterstand, die sich mit der
Pflege und Ausbesserung der ihnen anvertrauten Schätze zu befassen hatten, nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen ist.
Die erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts festgelegten Angaben — aus der Feder des Ste-
phan Leopolder, des Archivars und Bibliothekars des Klosters Wessobrunn16) —, die sich auf