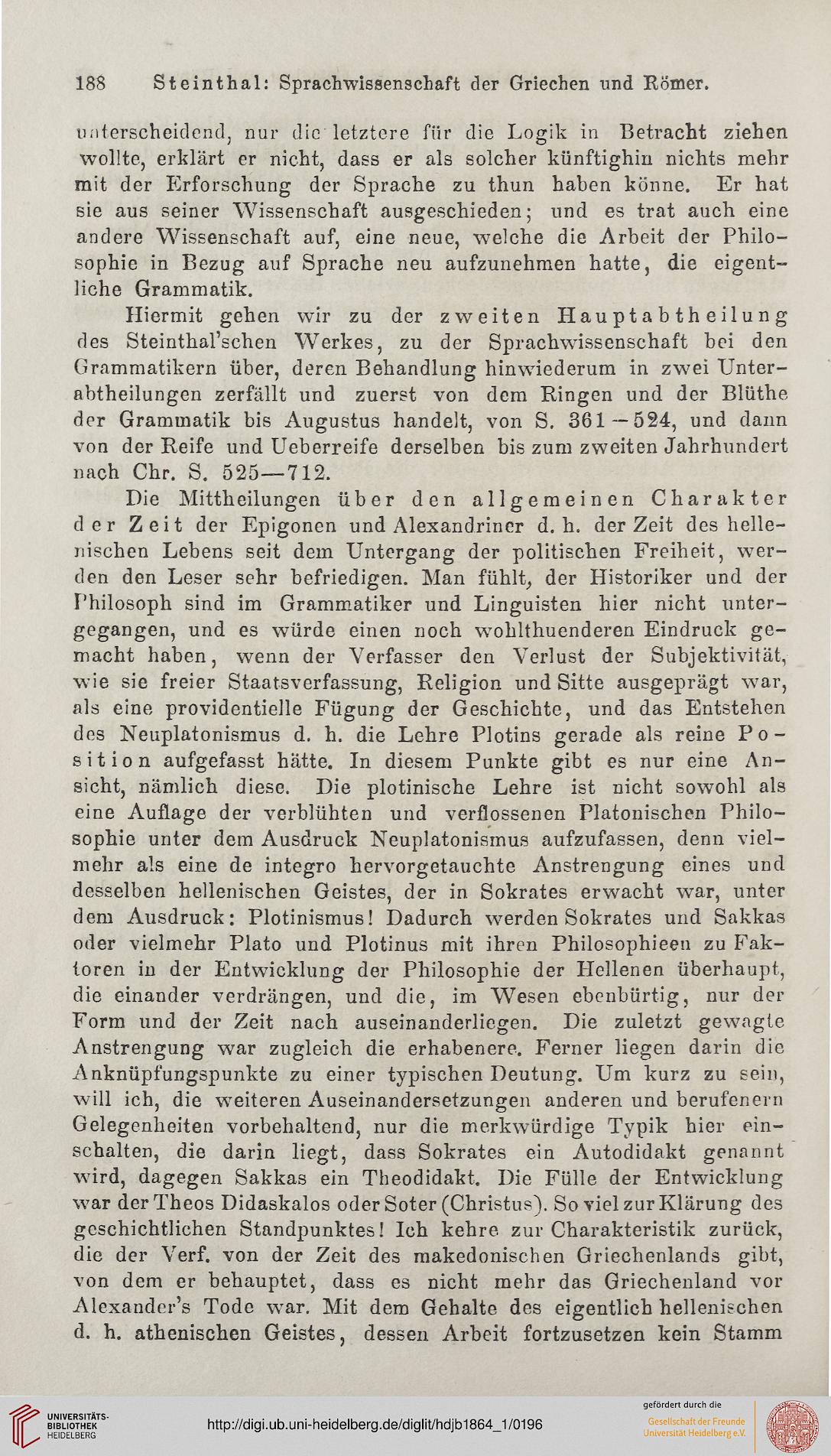188
Steinthal: Sprachwissenschaft der Griechen und Römer.
unterscheidend, nur die letztere für die Logik in Betracht ziehen
wollte, erklärt er nicht, dass er als solcher künftighin nichts mehr
mit der Erforschung der Sprache zu thun haben könne. Er hat
sie aus seiner Wissenschaft ausgeschieden; und es trat auch eine
andere Wissenschaft auf, eine neue, welche die Arbeit der Philo-
sophie in Bezug auf Sprache neu aufzunehmen hatte, die eigent-
liche Grammatik.
Hiermit gehen wir zu der zweiten Hauptabtheilung
des Steinthal’schen Werkes, zu der Sprachwissenschaft bei den
Grammatikern über, deren Behandlung hinwiederum in zwei Unter-
abtheilungen zerfällt und zuerst von dem Ringen und der Blüthe
der Grammatik bis Augustus handelt, von S. 361 —524, und dann
von der Reife und Ueberreife derselben bis zum zweiten Jahrhundert
nach Chr. S. 525—712.
Die Mittheilungen über den allgemeinen Charakter
der Zeit der Epigonen und Alexandriner d. h. derZeit des helle-
nischen Lebens seit dem Untergang der politischen Freiheit, wer-
den den Leser sehr befriedigen. Man fühlt, der Historiker und der
Philosoph sind im Grammatiker und Linguisten hier nicht unter-
gegangen, und es würde einen noch w’ohlthuenderen Eindruck ge-
macht haben, wenn der Verfasser den Verlust der Subjektivität,
wie sie freier Staatsverfassung, Religion und Sitte ausgeprägt war,
als eine providentielle Fügung der Geschichte, und das Entstehen
des Neuplatonismus d. h. die Lehre Plotins gerade als reine Po-
sition aufgefasst hatte. In diesem Punkte gibt es nur eine An-
sicht, nämlich diese. Die plotinische Lehre ist nicht sowohl als
eine Auflage der verblühten und verflossenen Platonischen Philo-
sophie unter dem Ausdruck Neuplatonismus aufzufassen, denn viel-
mehr als eine de integro hervorgetauchte Anstrengung eines und
desselben hellenischen Geistes, der in Sokrates erwacht war, unter
dem Ausdruck: Plotinismus! Dadurch werden Sokrates und Sakkas
oder vielmehr Plato und Plotinus mit ihren Philosophieen zu Fak-
toren in der Entwicklung der Philosophie der Hellenen überhaupt,
die einander verdrängen, und die, im Wesen ebenbürtig, nur der
Form und der Zeit nach auseinanderliegen. Die zuletzt gewagte
Anstrengung war zugleich die erhabenere. Ferner liegen darin die
Anknüpfungspunkte zu einer typischen Deutung. Um kurz zu sein,
will ich, die weiteren Auseinandersetzungen anderen und berufenem
Gelegenheiten vorbehaltend, nur die merkwürdige Typik hier ein-
schalten, die darin liegt, dass Sokrates ein Autodidakt genannt
wird, dagegen Sakkas ein Theodidakt. Die Fülle der Entwicklung
war der Theos Didaskalos oder Soter (Christus). So viel zur Klärung des
geschichtlichen Standpunktes! Ich kehre zur Charakteristik zurück,
die der Verf. von der Zeit des makedonischen Griechenlands gibt,
von dem er behauptet, dass es nicht mehr das Griechenland vor
Alexander’s Tode war. Mit dem Gehalte des eigentlich hellenischen
d. h. athenischen Geistes, dessen Arbeit fortzusetzen kein Stamm
Steinthal: Sprachwissenschaft der Griechen und Römer.
unterscheidend, nur die letztere für die Logik in Betracht ziehen
wollte, erklärt er nicht, dass er als solcher künftighin nichts mehr
mit der Erforschung der Sprache zu thun haben könne. Er hat
sie aus seiner Wissenschaft ausgeschieden; und es trat auch eine
andere Wissenschaft auf, eine neue, welche die Arbeit der Philo-
sophie in Bezug auf Sprache neu aufzunehmen hatte, die eigent-
liche Grammatik.
Hiermit gehen wir zu der zweiten Hauptabtheilung
des Steinthal’schen Werkes, zu der Sprachwissenschaft bei den
Grammatikern über, deren Behandlung hinwiederum in zwei Unter-
abtheilungen zerfällt und zuerst von dem Ringen und der Blüthe
der Grammatik bis Augustus handelt, von S. 361 —524, und dann
von der Reife und Ueberreife derselben bis zum zweiten Jahrhundert
nach Chr. S. 525—712.
Die Mittheilungen über den allgemeinen Charakter
der Zeit der Epigonen und Alexandriner d. h. derZeit des helle-
nischen Lebens seit dem Untergang der politischen Freiheit, wer-
den den Leser sehr befriedigen. Man fühlt, der Historiker und der
Philosoph sind im Grammatiker und Linguisten hier nicht unter-
gegangen, und es würde einen noch w’ohlthuenderen Eindruck ge-
macht haben, wenn der Verfasser den Verlust der Subjektivität,
wie sie freier Staatsverfassung, Religion und Sitte ausgeprägt war,
als eine providentielle Fügung der Geschichte, und das Entstehen
des Neuplatonismus d. h. die Lehre Plotins gerade als reine Po-
sition aufgefasst hatte. In diesem Punkte gibt es nur eine An-
sicht, nämlich diese. Die plotinische Lehre ist nicht sowohl als
eine Auflage der verblühten und verflossenen Platonischen Philo-
sophie unter dem Ausdruck Neuplatonismus aufzufassen, denn viel-
mehr als eine de integro hervorgetauchte Anstrengung eines und
desselben hellenischen Geistes, der in Sokrates erwacht war, unter
dem Ausdruck: Plotinismus! Dadurch werden Sokrates und Sakkas
oder vielmehr Plato und Plotinus mit ihren Philosophieen zu Fak-
toren in der Entwicklung der Philosophie der Hellenen überhaupt,
die einander verdrängen, und die, im Wesen ebenbürtig, nur der
Form und der Zeit nach auseinanderliegen. Die zuletzt gewagte
Anstrengung war zugleich die erhabenere. Ferner liegen darin die
Anknüpfungspunkte zu einer typischen Deutung. Um kurz zu sein,
will ich, die weiteren Auseinandersetzungen anderen und berufenem
Gelegenheiten vorbehaltend, nur die merkwürdige Typik hier ein-
schalten, die darin liegt, dass Sokrates ein Autodidakt genannt
wird, dagegen Sakkas ein Theodidakt. Die Fülle der Entwicklung
war der Theos Didaskalos oder Soter (Christus). So viel zur Klärung des
geschichtlichen Standpunktes! Ich kehre zur Charakteristik zurück,
die der Verf. von der Zeit des makedonischen Griechenlands gibt,
von dem er behauptet, dass es nicht mehr das Griechenland vor
Alexander’s Tode war. Mit dem Gehalte des eigentlich hellenischen
d. h. athenischen Geistes, dessen Arbeit fortzusetzen kein Stamm