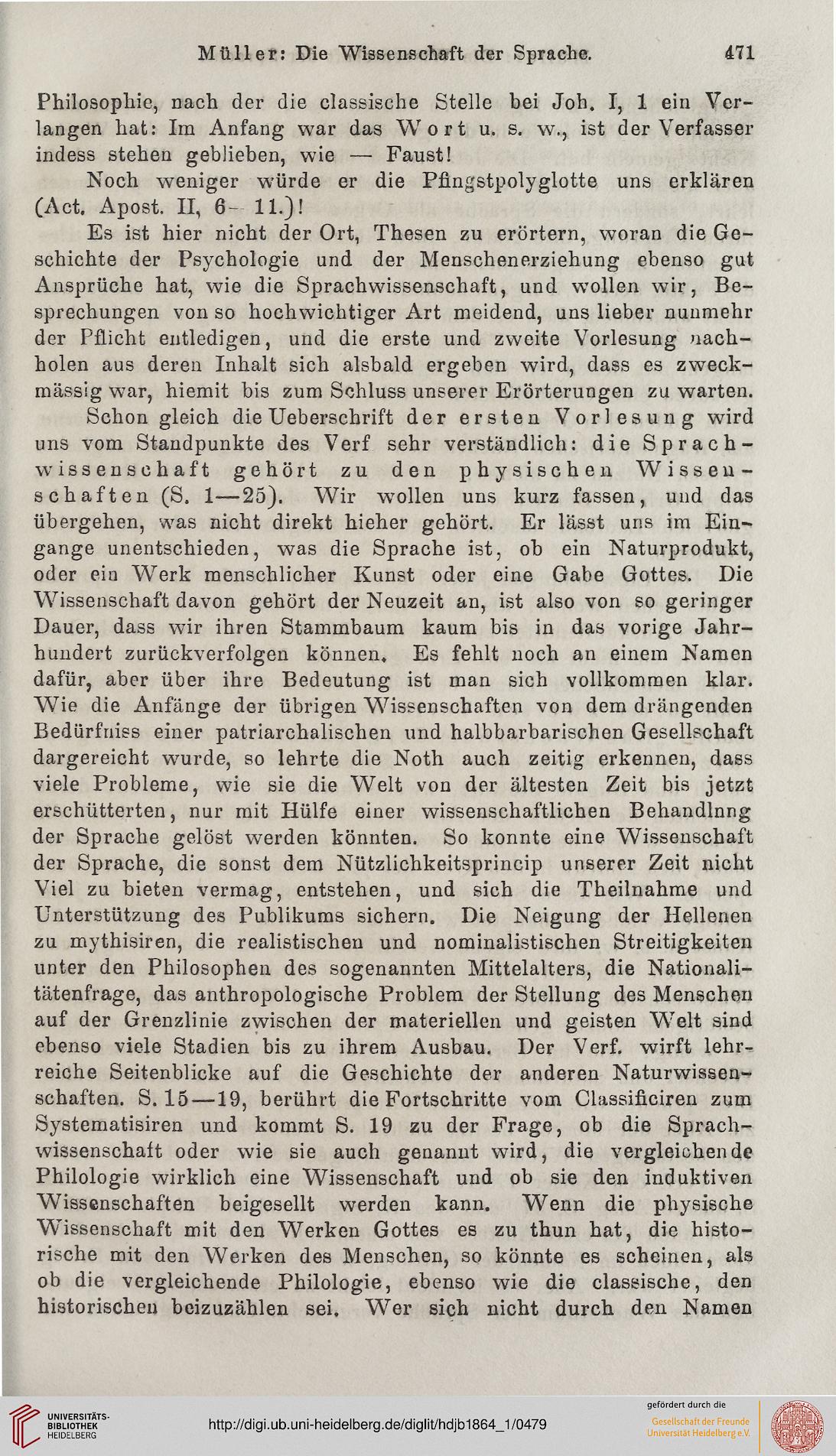Müller: Die Wissenschaft der Sprache.
471
Philosophie, nach der die classische Stelle bei Joh. I, 1 ein Ver-
langen hat: Im Anfang war das Wort u. s. w., ist der Verfasser
indess stehen geblieben, wie — Faust!
Noch weniger würde er die Pfingstpolyglotte uns erklären
(Act. Apost. II, 6- 11.)!
Es ist hier nicht der Ort, Thesen zu erörtern, woran die Ge-
schichte der Psychologie und der Menschenerziehung ebenso gut
Ansprüche hat, wie die Sprachwissenschaft, und wollen wir, Be-
sprechungen von so hochwichtiger Art meidend, uns lieber nunmehr
der Pflicht entledigen, und die erste und zweite Vorlesung nach-
holen aus deren Inhalt sich alsbald ergeben wird, dass es zweck-
mässig war, hiemit bis zum Schluss unserer Erörterungen zu warten.
Schon gleich die Ueberschrift der ersten Vorlesung wird
uns vom Standpunkte des Verf sehr verständlich: die Sprach-
wissenschaft gehört zu den physischen Wissen-
schaften (S. 1—25). Wir wollen uns kurz fassen, und das
übergehen, was nicht direkt hieher gehört. Er lässt uns im Ein-
gänge unentschieden, was die Sprache ist, ob ein Naturprodukt,
oder ein Werk menschlicher Kunst oder eine Gabe Gottes. Die
Wissenschaft davon gehört der Neuzeit an, ist also von so geringer
Dauer, dass wir ihren Stammbaum kaum bis in das vorige Jahr-
hundert zurückverfolgen können. Es fehlt noch an einem Namen
dafür, aber über ihre Bedeutung ist man sich vollkommen klar.
Wie die Anfänge der übrigen Wissenschaften von dem drängenden
Bedürfniss einer patriarchalischen und halbbarbarischen Gesellschaft
dargereicht wurde, so lehrte die Noth auch zeitig erkennen, dass
viele Probleme, wie sie die Welt von der ältesten Zeit bis jetzt
erschütterten, nur mit Hülfe einer wissenschaftlichen Behandlnng
der Sprache gelöst werden könnten. So konnte eine Wissenschaft
der Sprache, die sonst dem Nützlichkeitsprincip unserer Zeit nicht
Viel zu bieten vermag, entstehen, und sich die Theilnahme und
Unterstützung des Publikums sichern. Die Neigung der Hellenen
zu mythisiren, die realistischen und nominalistischen Streitigkeiten
unter den Philosophen des sogenannten Mittelalters, die Nationali-
tätenfrage, das anthropologische Problem der Stellung des Menschen
auf der Grenzlinie zwischen der materiellen und geisten Welt sind
ebenso viele Stadien bis zu ihrem Ausbau. Der Verf. wirft lehr-
reiche Seitenblicke auf die Geschichte der anderen Naturwissen-
schaften. S. 15 —19, berührt die Fortschritte vom Classificiren zum
Systematisiren und kommt S. 19 zu der Frage, ob die Sprach-
wissenschaft oder wie sie auch genannt wird, die vergleichende
Philologie wirklich eine Wissenschaft und ob sie den induktiven
Wissenschaften beigesellt werden kann. Wenn die physische
Wissenschaft mit den Werken Gottes es zu thun hat, die histo-
rische mit den Werken des Menschen, so könnte es scheinen, als
ob die vergleichende Philologie, ebenso wie die classische, den
historischen beizuzählen sei. Wer sich nicht durch den Namen
471
Philosophie, nach der die classische Stelle bei Joh. I, 1 ein Ver-
langen hat: Im Anfang war das Wort u. s. w., ist der Verfasser
indess stehen geblieben, wie — Faust!
Noch weniger würde er die Pfingstpolyglotte uns erklären
(Act. Apost. II, 6- 11.)!
Es ist hier nicht der Ort, Thesen zu erörtern, woran die Ge-
schichte der Psychologie und der Menschenerziehung ebenso gut
Ansprüche hat, wie die Sprachwissenschaft, und wollen wir, Be-
sprechungen von so hochwichtiger Art meidend, uns lieber nunmehr
der Pflicht entledigen, und die erste und zweite Vorlesung nach-
holen aus deren Inhalt sich alsbald ergeben wird, dass es zweck-
mässig war, hiemit bis zum Schluss unserer Erörterungen zu warten.
Schon gleich die Ueberschrift der ersten Vorlesung wird
uns vom Standpunkte des Verf sehr verständlich: die Sprach-
wissenschaft gehört zu den physischen Wissen-
schaften (S. 1—25). Wir wollen uns kurz fassen, und das
übergehen, was nicht direkt hieher gehört. Er lässt uns im Ein-
gänge unentschieden, was die Sprache ist, ob ein Naturprodukt,
oder ein Werk menschlicher Kunst oder eine Gabe Gottes. Die
Wissenschaft davon gehört der Neuzeit an, ist also von so geringer
Dauer, dass wir ihren Stammbaum kaum bis in das vorige Jahr-
hundert zurückverfolgen können. Es fehlt noch an einem Namen
dafür, aber über ihre Bedeutung ist man sich vollkommen klar.
Wie die Anfänge der übrigen Wissenschaften von dem drängenden
Bedürfniss einer patriarchalischen und halbbarbarischen Gesellschaft
dargereicht wurde, so lehrte die Noth auch zeitig erkennen, dass
viele Probleme, wie sie die Welt von der ältesten Zeit bis jetzt
erschütterten, nur mit Hülfe einer wissenschaftlichen Behandlnng
der Sprache gelöst werden könnten. So konnte eine Wissenschaft
der Sprache, die sonst dem Nützlichkeitsprincip unserer Zeit nicht
Viel zu bieten vermag, entstehen, und sich die Theilnahme und
Unterstützung des Publikums sichern. Die Neigung der Hellenen
zu mythisiren, die realistischen und nominalistischen Streitigkeiten
unter den Philosophen des sogenannten Mittelalters, die Nationali-
tätenfrage, das anthropologische Problem der Stellung des Menschen
auf der Grenzlinie zwischen der materiellen und geisten Welt sind
ebenso viele Stadien bis zu ihrem Ausbau. Der Verf. wirft lehr-
reiche Seitenblicke auf die Geschichte der anderen Naturwissen-
schaften. S. 15 —19, berührt die Fortschritte vom Classificiren zum
Systematisiren und kommt S. 19 zu der Frage, ob die Sprach-
wissenschaft oder wie sie auch genannt wird, die vergleichende
Philologie wirklich eine Wissenschaft und ob sie den induktiven
Wissenschaften beigesellt werden kann. Wenn die physische
Wissenschaft mit den Werken Gottes es zu thun hat, die histo-
rische mit den Werken des Menschen, so könnte es scheinen, als
ob die vergleichende Philologie, ebenso wie die classische, den
historischen beizuzählen sei. Wer sich nicht durch den Namen