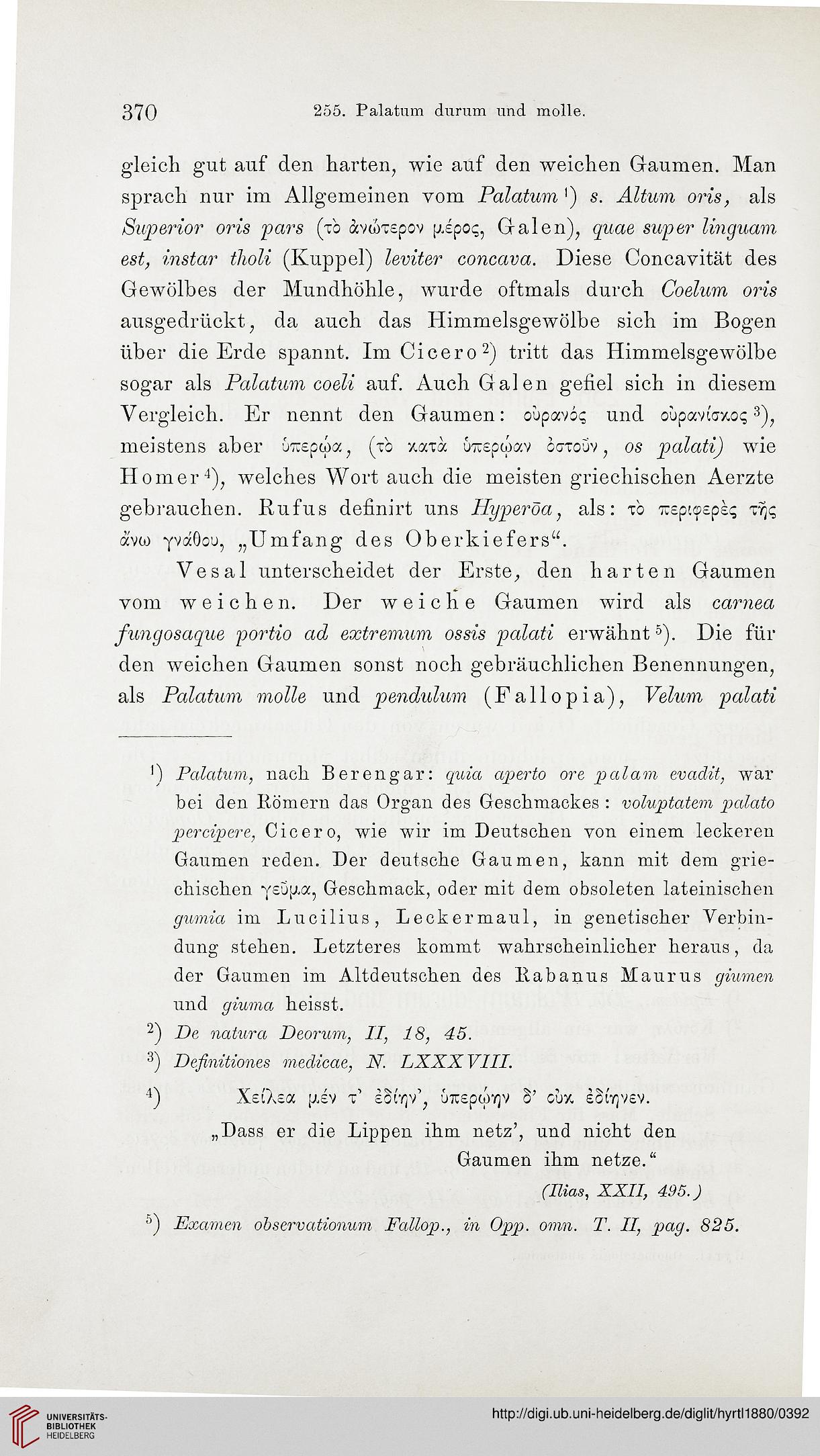370
255. Palatum durum und molle.
gleich gut auf den harten, wie auf den weichen Gaumen. Man
sprach nur im Allgemeinen vom Palatum ') s. Altum oris, als
Superior oris pars (xb avwTspov Galen), quae super Unguam
est, instar tholi (Kuppel) leviter concava. Diese Concavität des
Gewölbes der Mundhöhle, wurde oftmals durch Coelum oris
ausgedrückt, da auch das Himmelsgewölbe sich im Bogen
über die Erde spannt. Im Cicero2) tritt das Himmelsgewölbe
sogar als Palatum coeli auf. Auch Galen gefiel sich in diesem
Vergleich. Er nennt den Gaumen: oupavö? und oüpavt'ay.o; 3),
meistens aber oTrepioa, (Yo -accxcc uTcepwav ostouv, os palati) wie
Homer4), welches Wort auch die meisten griechischen Aerzte
gebrauchen. Rufus definirt uns Hyperöa, als: xb Trepttpepeq vqq
avw YväOou, „Umfang des Oberkiefers".
Vesal unterscheidet der Erste,, den harten Gaumen
vom weichen. Der weiche Gaumen wird als carnea
fungosaque portio ad extremum ossis palati erwähnt5). Die für
den weichen Gaumen sonst noch gebräuchlichen Benennungen,
als Palatum molle und pendulum (Fallopia), Velum palati
') Palatum, nach Berengar: quia ap>erto ore palam evadit, war
bei den Römern das Organ des Geschmackes : voluptatem palato
p>ercipere, Cicero, wie wir im Deutschen von einem leckeren
Gaumen reden. Der deutsche Gaumen, kann mit dem grie-
chischen ysujjwc, Geschmack, oder mit dem obsoleten lateinischen
gumia im Lucilius, Leckermaul, in genetischer Verbin-
dung stehen. Letzteres kommt wahrscheinlicher heraus, da
der Gaumen im Altdeutschen des Ilabanus Maurus giumen
und giuma heisst.
2) De natura Deorum, II, 18, 45.
3) Definitiones medicae, N. LXXXVIII.
4) ÄeiAsa p,sv t sotiqv , uTcepwvjv o cux eonqvev.
„Dass er die Lippen ihm netz', und nicht den
Gaumen ihm netze."
(Ilias, XXII, 495.)
5) Examen Observationen Fattop., in Opp. omn. T. II, pag. 825.
255. Palatum durum und molle.
gleich gut auf den harten, wie auf den weichen Gaumen. Man
sprach nur im Allgemeinen vom Palatum ') s. Altum oris, als
Superior oris pars (xb avwTspov Galen), quae super Unguam
est, instar tholi (Kuppel) leviter concava. Diese Concavität des
Gewölbes der Mundhöhle, wurde oftmals durch Coelum oris
ausgedrückt, da auch das Himmelsgewölbe sich im Bogen
über die Erde spannt. Im Cicero2) tritt das Himmelsgewölbe
sogar als Palatum coeli auf. Auch Galen gefiel sich in diesem
Vergleich. Er nennt den Gaumen: oupavö? und oüpavt'ay.o; 3),
meistens aber oTrepioa, (Yo -accxcc uTcepwav ostouv, os palati) wie
Homer4), welches Wort auch die meisten griechischen Aerzte
gebrauchen. Rufus definirt uns Hyperöa, als: xb Trepttpepeq vqq
avw YväOou, „Umfang des Oberkiefers".
Vesal unterscheidet der Erste,, den harten Gaumen
vom weichen. Der weiche Gaumen wird als carnea
fungosaque portio ad extremum ossis palati erwähnt5). Die für
den weichen Gaumen sonst noch gebräuchlichen Benennungen,
als Palatum molle und pendulum (Fallopia), Velum palati
') Palatum, nach Berengar: quia ap>erto ore palam evadit, war
bei den Römern das Organ des Geschmackes : voluptatem palato
p>ercipere, Cicero, wie wir im Deutschen von einem leckeren
Gaumen reden. Der deutsche Gaumen, kann mit dem grie-
chischen ysujjwc, Geschmack, oder mit dem obsoleten lateinischen
gumia im Lucilius, Leckermaul, in genetischer Verbin-
dung stehen. Letzteres kommt wahrscheinlicher heraus, da
der Gaumen im Altdeutschen des Ilabanus Maurus giumen
und giuma heisst.
2) De natura Deorum, II, 18, 45.
3) Definitiones medicae, N. LXXXVIII.
4) ÄeiAsa p,sv t sotiqv , uTcepwvjv o cux eonqvev.
„Dass er die Lippen ihm netz', und nicht den
Gaumen ihm netze."
(Ilias, XXII, 495.)
5) Examen Observationen Fattop., in Opp. omn. T. II, pag. 825.