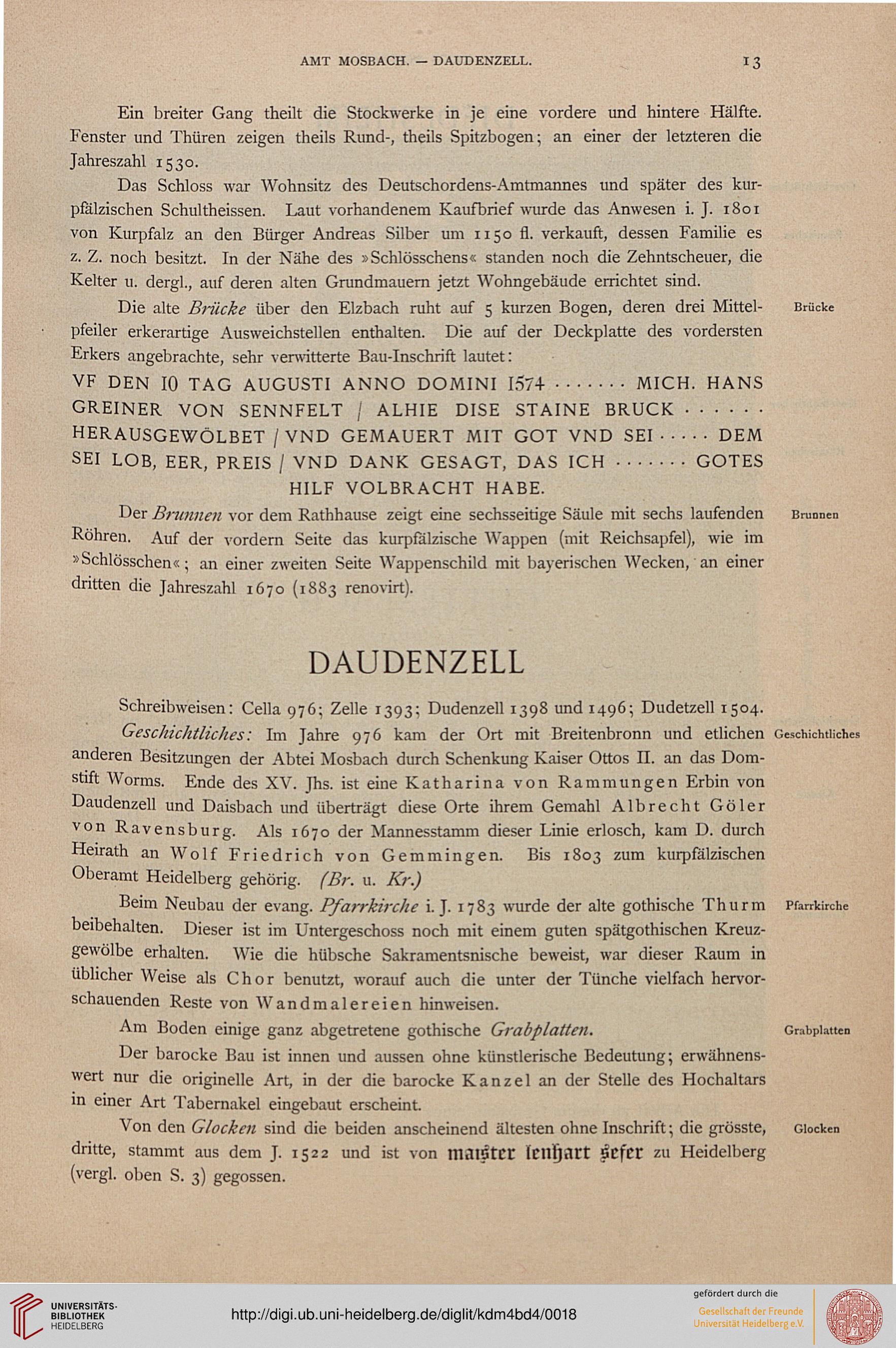AMT MOSBACH. — DAUDENZELL.
13
Ein breiter Gang theilt die Stockwerke in je eine vordere und hintere Hälfte.
Fenster und Thüren zeigen theils Rund-, theils Spitzbogen; an einer der letzteren die
Jahreszahl 1530.
Das Schloss war Wohnsitz des Deutschordens-Amtmannes und später des kur-
pfälzischen Schultheissen. Laut vorhandenem Kaufbrief wurde das Anwesen i. J. 1801
von Kurpfalz an den Bürger Andreas Silber um 1150 fl. verkauft, dessen Familie es
z. Z. noch besitzt. In der Nähe des »Schlösschens« standen noch die Zehntscheuer, die
Kelter u. dergl., auf deren alten Grundmauern jetzt Wohngebäude errichtet sind.
Die alte Brücke über den Elzbach ruht auf 5 kurzen Bogen, deren drei Mittel-
pfeiler erkerartige Ausweichstellen enthalten. Die auf der Deckplatte des vordersten
Erkers angebrachte, sehr verwitterte Bau-Inschrift lautet:
VF DEN 10 TAG AUGUSTI ANNO DOMINI 157+.......MICH. HANS
GREINER VON SENNFELT / ALHIE DISE STAINE BRÜCK......
HERAUSGEWÖLBET / VND GEMAUERT MIT GOT VND SEI.....DEM
SEI LOB, EER, PREIS / VND DANK GESAGT, DAS ICH.......GOTES
HILF VOLBRACHT HABE.
Der Brunnen vor dem Rathhause zeigt eine sechsseitige Säule mit sechs laufenden
Röhren. Auf der vordem Seite das kurpfälzische Wappen (mit Reichsapfel), wie im
»Schlösschen«; an einer zweiten Seite Wappenschild mit bayerischen Wecken, an einer
dritten die Jahreszahl 1670 (1883 renovirt).
Brücke
Brunnen
DAUDENZELL
Schreibweisen: Cella 976; Zelle 1393; Dudenzell 1398 und 1496; Dudetzell 1504.
Geschichtliches: Im Jahre 976 kam der Ort mit Breitenbronn und etlichen Geschichtliches
anderen Besitzungen der Abtei Mosbach durch Schenkung Kaiser Ottos II. an das Dom-
stift Worms. Ende des XV. Jhs. ist eine Katharina von Rammungen Erbin von
Daudenzell und Daisbach und überträgt diese Orte ihrem Gemahl Albrecht Göler
von Ravensburg. Als 1670 der Mannesstamm dieser Linie erlosch, kam D. durch
Heirath an Wolf Friedrich von Gemmingen. Bis 1803 zum kurpfälzischen
Oberamt Heidelberg gehörig. (Br. u. Kr.)
Beim Neubau der evang. Pfarrkirche i. J. 1783 wurde der alte gothische Thurm Pfarrkirche
beibehalten. Dieser ist im Untergeschoss noch mit einem guten spätgothischen Kreuz-
gewölbe erhalten. Wie die hübsche Sakramentsnische beweist, war dieser Raum in
üblicher Weise als Chor benutzt, worauf auch die unter der Tünche vielfach hervor-
schauenden Reste von Wandmalereien hinweisen.
Am Boden einige ganz abgetretene gothische Grabplatten. Grabplatten
Der barocke Bau ist innen und aussen ohne künstlerische Bedeutung; erwähnens-
wert nur die originelle Art, in der die barocke Kanzel an der Stelle des Hochaltars
in einer Art Tabernakel eingebaut erscheint.
Von den Glocken sind die beiden anscheinend ältesten ohne Inschrift; die grösste, Glocken
dritte, stammt aus dem J. 1522 und ist von matätCt fCllljart ätftt zu Heidelberg
(vergl. oben S. 3) gegossen.
13
Ein breiter Gang theilt die Stockwerke in je eine vordere und hintere Hälfte.
Fenster und Thüren zeigen theils Rund-, theils Spitzbogen; an einer der letzteren die
Jahreszahl 1530.
Das Schloss war Wohnsitz des Deutschordens-Amtmannes und später des kur-
pfälzischen Schultheissen. Laut vorhandenem Kaufbrief wurde das Anwesen i. J. 1801
von Kurpfalz an den Bürger Andreas Silber um 1150 fl. verkauft, dessen Familie es
z. Z. noch besitzt. In der Nähe des »Schlösschens« standen noch die Zehntscheuer, die
Kelter u. dergl., auf deren alten Grundmauern jetzt Wohngebäude errichtet sind.
Die alte Brücke über den Elzbach ruht auf 5 kurzen Bogen, deren drei Mittel-
pfeiler erkerartige Ausweichstellen enthalten. Die auf der Deckplatte des vordersten
Erkers angebrachte, sehr verwitterte Bau-Inschrift lautet:
VF DEN 10 TAG AUGUSTI ANNO DOMINI 157+.......MICH. HANS
GREINER VON SENNFELT / ALHIE DISE STAINE BRÜCK......
HERAUSGEWÖLBET / VND GEMAUERT MIT GOT VND SEI.....DEM
SEI LOB, EER, PREIS / VND DANK GESAGT, DAS ICH.......GOTES
HILF VOLBRACHT HABE.
Der Brunnen vor dem Rathhause zeigt eine sechsseitige Säule mit sechs laufenden
Röhren. Auf der vordem Seite das kurpfälzische Wappen (mit Reichsapfel), wie im
»Schlösschen«; an einer zweiten Seite Wappenschild mit bayerischen Wecken, an einer
dritten die Jahreszahl 1670 (1883 renovirt).
Brücke
Brunnen
DAUDENZELL
Schreibweisen: Cella 976; Zelle 1393; Dudenzell 1398 und 1496; Dudetzell 1504.
Geschichtliches: Im Jahre 976 kam der Ort mit Breitenbronn und etlichen Geschichtliches
anderen Besitzungen der Abtei Mosbach durch Schenkung Kaiser Ottos II. an das Dom-
stift Worms. Ende des XV. Jhs. ist eine Katharina von Rammungen Erbin von
Daudenzell und Daisbach und überträgt diese Orte ihrem Gemahl Albrecht Göler
von Ravensburg. Als 1670 der Mannesstamm dieser Linie erlosch, kam D. durch
Heirath an Wolf Friedrich von Gemmingen. Bis 1803 zum kurpfälzischen
Oberamt Heidelberg gehörig. (Br. u. Kr.)
Beim Neubau der evang. Pfarrkirche i. J. 1783 wurde der alte gothische Thurm Pfarrkirche
beibehalten. Dieser ist im Untergeschoss noch mit einem guten spätgothischen Kreuz-
gewölbe erhalten. Wie die hübsche Sakramentsnische beweist, war dieser Raum in
üblicher Weise als Chor benutzt, worauf auch die unter der Tünche vielfach hervor-
schauenden Reste von Wandmalereien hinweisen.
Am Boden einige ganz abgetretene gothische Grabplatten. Grabplatten
Der barocke Bau ist innen und aussen ohne künstlerische Bedeutung; erwähnens-
wert nur die originelle Art, in der die barocke Kanzel an der Stelle des Hochaltars
in einer Art Tabernakel eingebaut erscheint.
Von den Glocken sind die beiden anscheinend ältesten ohne Inschrift; die grösste, Glocken
dritte, stammt aus dem J. 1522 und ist von matätCt fCllljart ätftt zu Heidelberg
(vergl. oben S. 3) gegossen.