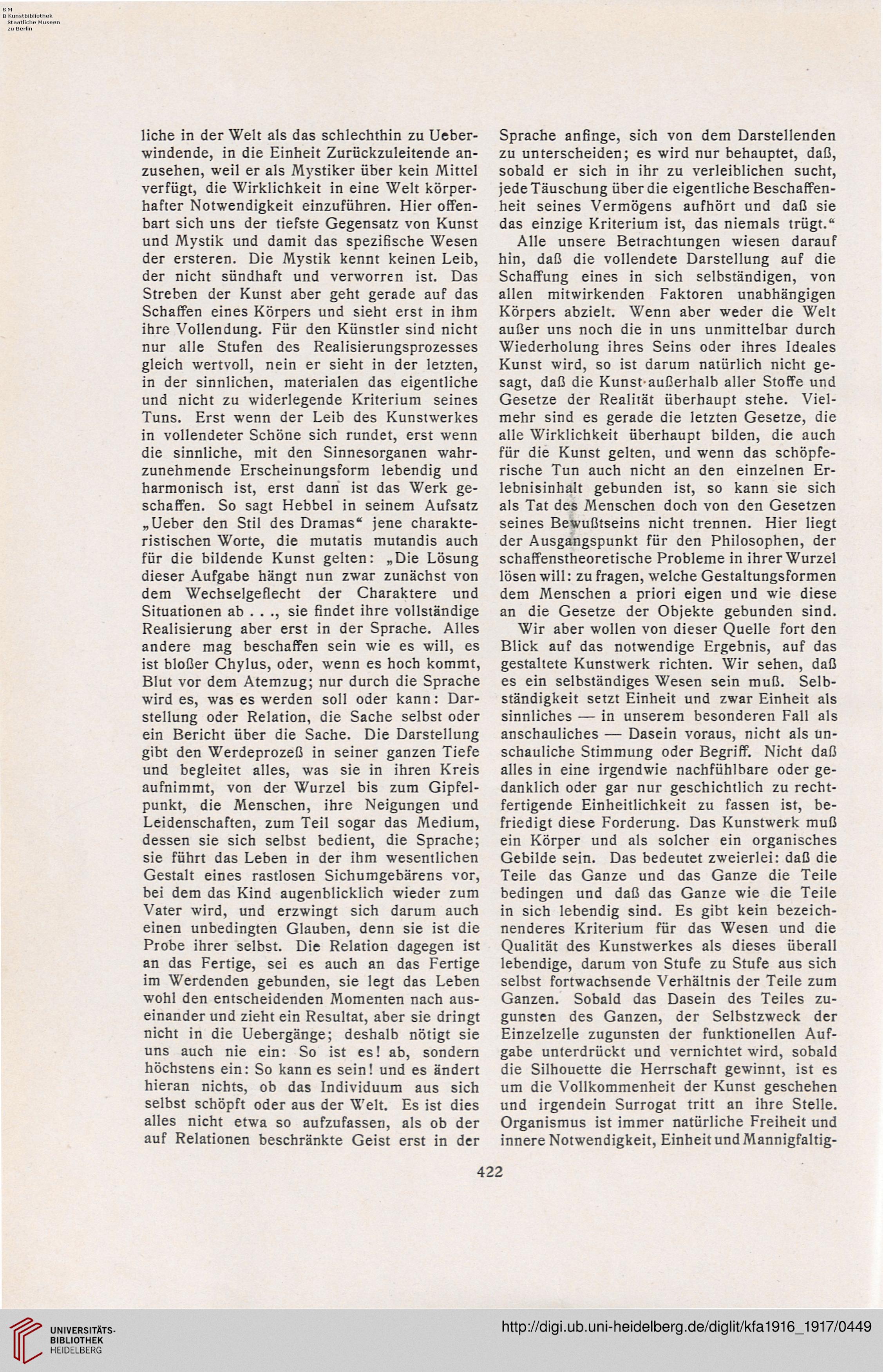liehe in der Welt als das schlechthin zu Ueber-
windende, in die Einheit Zurückzuleitende an-
zusehen, weil er als Mystiker über kein Mittel
verfügt, die Wirklichkeit in eine Welt körper-
hafter Notwendigkeit einzuführen. Hier offen-
bart sich uns der tiefste Gegensatz von Kunst
und Mystik und damit das spezifische Wesen
der ersteren. Die Mystik kennt keinen Leib,
der nicht sündhaft und verworren ist. Das
Streben der Kunst aber geht gerade auf das
Schaffen eines Körpers und sieht erst in ihm
ihre Vollendung. Für den Künstler sind nicht
nur alle Stufen des Realisierungsprozesses
gleich wertvoll, nein er sieht in der letzten,
in der sinnlichen, materialen das eigentliche
und nicht zu widerlegende Kriterium seines
Tuns. Erst wenn der Leib des Kunstwerkes
in vollendeter Schöne sich rundet, erst wenn
die sinnliche, mit den Sinnesorganen wahr-
zunehmende Erscheinungsform lebendig und
harmonisch ist, erst dann ist das Werk ge-
schaffen. So sagt Hebbel in seinem Aufsatz
„lieber den Stil des Dramas" jene charakte-
ristischen Worte, die mutatis mutandis auch
für die bildende Kunst gelten: „Die Lösung
dieser Aufgabe hängt nun zwar zunächst von
dem Wechselgeflecht der Charaktere und
Situationen ab . . ., sie findet ihre vollständige
Realisierung aber erst in der Sprache. Alles
andere mag beschaffen sein wie es will, es
ist bloßer Chylus, oder, wenn es hoch kommt,
Blut vor dem Atemzug; nur durch die Sprache
wird es, was es werden soll oder kann: Dar-
stellung oder Relation, die Sache selbst oder
ein Bericht über die Sache. Die Darstellung
gibt den Werdeprozeß in seiner ganzen Tiefe
und begleitet alles, was sie in ihren Kreis
aufnimmt, von der Wurzel bis zum Gipfel-
punkt, die Menschen, ihre Neigungen und
Leidenschaften, zum Teil sogar das Medium,
dessen sie sich selbst bedient, die Sprache;
sie führt das Leben in der ihm wesentlichen
Gestalt eines rastlosen Sichumgebärens vor,
bei dem das Kind augenblicklich wieder zum
Vater wird, und erzwingt sich darum auch
einen unbedingten Glauben, denn sie ist die
Probe ihrer selbst. Die Relation dagegen ist
an das Fertige, sei es auch an das Fertige
im Werdenden gebunden, sie legt das Leben
wohl den entscheidenden Momenten nach aus-
einander und zieht ein Resultat, aber sie dringt
nicht in die Uebergänge; deshalb nötigt sie
uns auch nie ein: So ist es! ab, sondern
höchstens ein: So kann es sein! und es ändert
hieran nichts, ob das Individuum aus sich
selbst schöpft oder aus der Welt. Es ist dies
alles nicht etwa so aufzufassen, als ob der
auf Relationen beschränkte Geist erst in der
Sprache anfinge, sich von dem Darstellenden
zu unterscheiden; es wird nur behauptet, daß,
sobald er sich in ihr zu verleiblichen sucht,
jede Täuschung über die eigentliche Beschaffen-
heit seines Vermögens aufhört und daß sie
das einzige Kriterium ist, das niemals trügt."
Alle unsere Betrachtungen wiesen darauf
hin, daß die vollendete Darstellung auf die
Schaffung eines in sich selbständigen, von
allen mitwirkenden Faktoren unabhängigen
Körpers abzielt. Wenn aber weder die Welt
außer uns noch die in uns unmittelbar durch
Wiederholung ihres Seins oder ihres Ideales
Kunst wird, so ist darum natürlich nicht ge-
sagt, daß die Kunst außerhalb aller Stoffe und
Gesetze der Realität überhaupt stehe. Viel-
mehr sind es gerade die letzten Gesetze, die
alle Wirklichkeit überhaupt bilden, die auch
für die Kunst gelten, und wenn das schöpfe-
rische Tun auch nicht an den einzelnen Er-
lebnisinhalt gebunden ist, so kann sie sich
als Tat des Menschen doch von den Gesetzen
seines Bewußtseins nicht trennen. Hier liegt
der Ausgangspunkt für den Philosophen, der
schaffenstheoretische Probleme in ihrer Wurzel
lösen will: zu fragen, welche Gestaltungsformen
dem Menschen a priori eigen und wie diese
an die Gesetze der Objekte gebunden sind.
Wir aber wollen von dieser Quelle fort den
Blick auf das notwendige Ergebnis, auf das
gestaltete Kunstwerk richten. Wir sehen, daß
es ein selbständiges Wesen sein muß. Selb-
ständigkeit setzt Einheit und zwar Einheit als
sinnliches — in unserem besonderen Fall als
anschauliches — Dasein voraus, nicht als un-
schauliche Stimmung oder Begriff. Nicht daß
alles in eine irgendwie nachfühlbare oder ge-
danklich oder gar nur geschichtlich zu recht-
fertigende Einheitlichkeit zu fassen ist, be-
friedigt diese Forderung. Das Kunstwerk muß
ein Körper und als solcher ein organisches
Gebilde sein. Das bedeutet zweierlei: daß die
Teile das Ganze und das Ganze die Teile
bedingen und daß das Ganze wie die Teile
in sich lebendig sind. Es gibt kein bezeich-
nenderes Kriterium für das Wesen und die
Qualität des Kunstwerkes als dieses überall
lebendige, darum von Stufe zu Stufe aus sich
selbst fortwachsende Verhältnis der Teile zum
Ganzen. Sobald das Dasein des Teiles zu-
gunsten des Ganzen, der Selbstzweck der
Einzelzelle zugunsten der funktionellen Auf-
gabe unterdrückt und vernichtet wird, sobald
die Silhouette die Herrschaft gewinnt, ist es
um die Vollkommenheit der Kunst geschehen
und irgendein Surrogat tritt an ihre Stelle.
Organismus ist immer natürliche Freiheit und
innere Notwendigkeit, Einheit und Mannigfaltig-
422
windende, in die Einheit Zurückzuleitende an-
zusehen, weil er als Mystiker über kein Mittel
verfügt, die Wirklichkeit in eine Welt körper-
hafter Notwendigkeit einzuführen. Hier offen-
bart sich uns der tiefste Gegensatz von Kunst
und Mystik und damit das spezifische Wesen
der ersteren. Die Mystik kennt keinen Leib,
der nicht sündhaft und verworren ist. Das
Streben der Kunst aber geht gerade auf das
Schaffen eines Körpers und sieht erst in ihm
ihre Vollendung. Für den Künstler sind nicht
nur alle Stufen des Realisierungsprozesses
gleich wertvoll, nein er sieht in der letzten,
in der sinnlichen, materialen das eigentliche
und nicht zu widerlegende Kriterium seines
Tuns. Erst wenn der Leib des Kunstwerkes
in vollendeter Schöne sich rundet, erst wenn
die sinnliche, mit den Sinnesorganen wahr-
zunehmende Erscheinungsform lebendig und
harmonisch ist, erst dann ist das Werk ge-
schaffen. So sagt Hebbel in seinem Aufsatz
„lieber den Stil des Dramas" jene charakte-
ristischen Worte, die mutatis mutandis auch
für die bildende Kunst gelten: „Die Lösung
dieser Aufgabe hängt nun zwar zunächst von
dem Wechselgeflecht der Charaktere und
Situationen ab . . ., sie findet ihre vollständige
Realisierung aber erst in der Sprache. Alles
andere mag beschaffen sein wie es will, es
ist bloßer Chylus, oder, wenn es hoch kommt,
Blut vor dem Atemzug; nur durch die Sprache
wird es, was es werden soll oder kann: Dar-
stellung oder Relation, die Sache selbst oder
ein Bericht über die Sache. Die Darstellung
gibt den Werdeprozeß in seiner ganzen Tiefe
und begleitet alles, was sie in ihren Kreis
aufnimmt, von der Wurzel bis zum Gipfel-
punkt, die Menschen, ihre Neigungen und
Leidenschaften, zum Teil sogar das Medium,
dessen sie sich selbst bedient, die Sprache;
sie führt das Leben in der ihm wesentlichen
Gestalt eines rastlosen Sichumgebärens vor,
bei dem das Kind augenblicklich wieder zum
Vater wird, und erzwingt sich darum auch
einen unbedingten Glauben, denn sie ist die
Probe ihrer selbst. Die Relation dagegen ist
an das Fertige, sei es auch an das Fertige
im Werdenden gebunden, sie legt das Leben
wohl den entscheidenden Momenten nach aus-
einander und zieht ein Resultat, aber sie dringt
nicht in die Uebergänge; deshalb nötigt sie
uns auch nie ein: So ist es! ab, sondern
höchstens ein: So kann es sein! und es ändert
hieran nichts, ob das Individuum aus sich
selbst schöpft oder aus der Welt. Es ist dies
alles nicht etwa so aufzufassen, als ob der
auf Relationen beschränkte Geist erst in der
Sprache anfinge, sich von dem Darstellenden
zu unterscheiden; es wird nur behauptet, daß,
sobald er sich in ihr zu verleiblichen sucht,
jede Täuschung über die eigentliche Beschaffen-
heit seines Vermögens aufhört und daß sie
das einzige Kriterium ist, das niemals trügt."
Alle unsere Betrachtungen wiesen darauf
hin, daß die vollendete Darstellung auf die
Schaffung eines in sich selbständigen, von
allen mitwirkenden Faktoren unabhängigen
Körpers abzielt. Wenn aber weder die Welt
außer uns noch die in uns unmittelbar durch
Wiederholung ihres Seins oder ihres Ideales
Kunst wird, so ist darum natürlich nicht ge-
sagt, daß die Kunst außerhalb aller Stoffe und
Gesetze der Realität überhaupt stehe. Viel-
mehr sind es gerade die letzten Gesetze, die
alle Wirklichkeit überhaupt bilden, die auch
für die Kunst gelten, und wenn das schöpfe-
rische Tun auch nicht an den einzelnen Er-
lebnisinhalt gebunden ist, so kann sie sich
als Tat des Menschen doch von den Gesetzen
seines Bewußtseins nicht trennen. Hier liegt
der Ausgangspunkt für den Philosophen, der
schaffenstheoretische Probleme in ihrer Wurzel
lösen will: zu fragen, welche Gestaltungsformen
dem Menschen a priori eigen und wie diese
an die Gesetze der Objekte gebunden sind.
Wir aber wollen von dieser Quelle fort den
Blick auf das notwendige Ergebnis, auf das
gestaltete Kunstwerk richten. Wir sehen, daß
es ein selbständiges Wesen sein muß. Selb-
ständigkeit setzt Einheit und zwar Einheit als
sinnliches — in unserem besonderen Fall als
anschauliches — Dasein voraus, nicht als un-
schauliche Stimmung oder Begriff. Nicht daß
alles in eine irgendwie nachfühlbare oder ge-
danklich oder gar nur geschichtlich zu recht-
fertigende Einheitlichkeit zu fassen ist, be-
friedigt diese Forderung. Das Kunstwerk muß
ein Körper und als solcher ein organisches
Gebilde sein. Das bedeutet zweierlei: daß die
Teile das Ganze und das Ganze die Teile
bedingen und daß das Ganze wie die Teile
in sich lebendig sind. Es gibt kein bezeich-
nenderes Kriterium für das Wesen und die
Qualität des Kunstwerkes als dieses überall
lebendige, darum von Stufe zu Stufe aus sich
selbst fortwachsende Verhältnis der Teile zum
Ganzen. Sobald das Dasein des Teiles zu-
gunsten des Ganzen, der Selbstzweck der
Einzelzelle zugunsten der funktionellen Auf-
gabe unterdrückt und vernichtet wird, sobald
die Silhouette die Herrschaft gewinnt, ist es
um die Vollkommenheit der Kunst geschehen
und irgendein Surrogat tritt an ihre Stelle.
Organismus ist immer natürliche Freiheit und
innere Notwendigkeit, Einheit und Mannigfaltig-
422