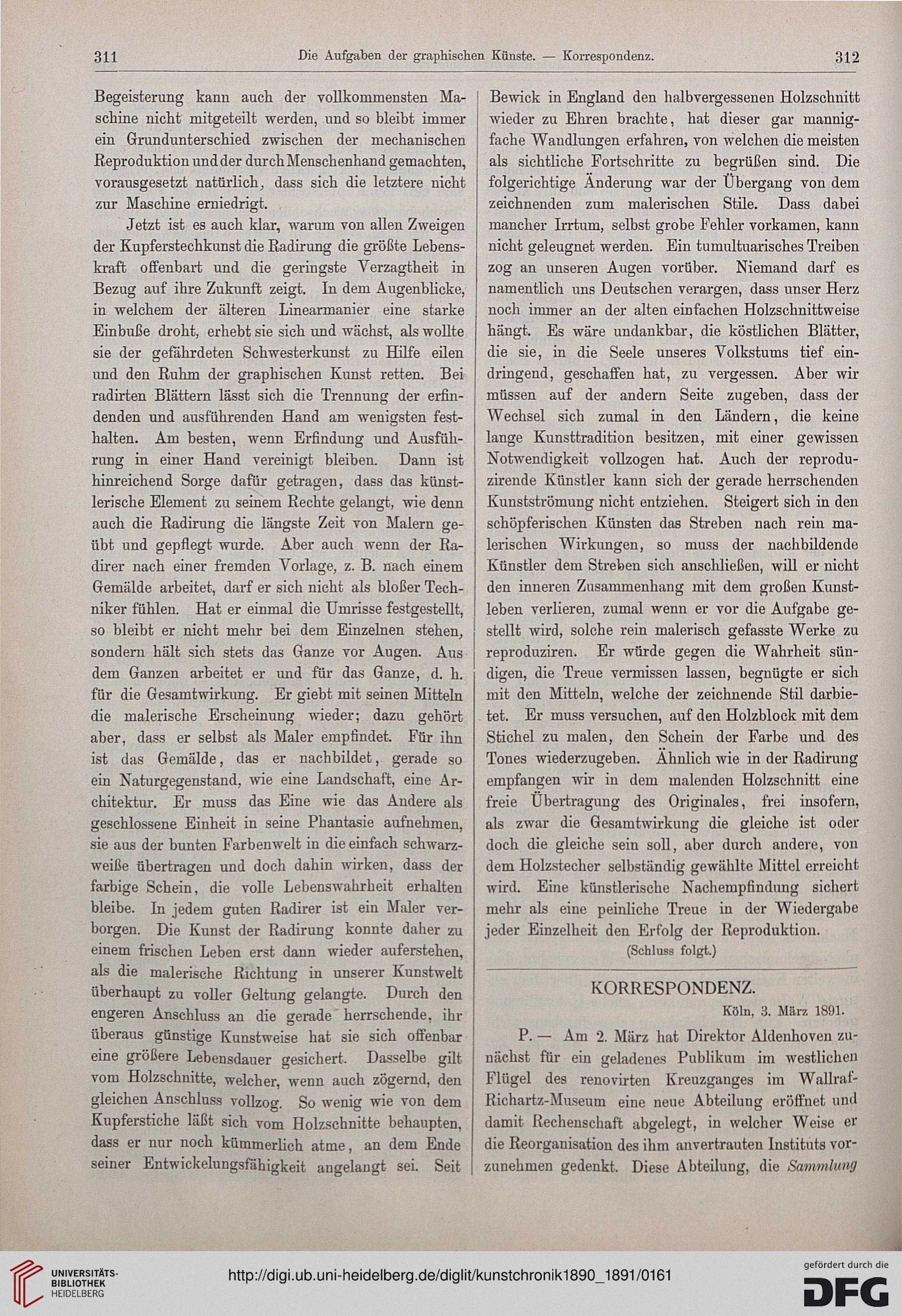311
Die Aufgaben der graphischen Künste. — Korrespondenz.
312
Begeisterung kann auch der vollkommensten Ma-
schine nicht mitgeteilt werden, und so bleibt immer
ein Grundunterschied zwischen der mechanischen
Reproduktion und der durch Menschenhand gemachten,
vorausgesetzt natürlich, dass sich die letztere nicht
zur Maschine erniedrigt.
Jetzt ist es auch klar, warum von allen Zweigen
der Kupferstechkunst die Radirung die größte Lebens-
kraft offenbart und die geringste Verzagtheit in
Bezug auf ihre Zukunft zeigt. In dem Augenblicke,
in welchem der älteren Linearmanier eine starke
Einbuße droht, erhebt sie sich und wächst, als wollte
sie der gefährdeten Schwesterkunst zu Hilfe eilen
und den Ruhm der graphischen Kunst retten. Bei
radirten Blättern lässt sich die Trennung der erfin-
denden und ausführenden Hand am wenigsten fest-
halten. Am besten, wenn Erfindung und Ausfüh-
rung in einer Hand vereinigt bleiben. Dann ist
hinreichend Sorge dafür getragen, dass das künst-
lerische Element zu seinem Rechte gelangt, wie denn
auch die Radirung die längste Zeit von Malern ge-
übt und gepflegt wurde. Aber auch wenn der Ra-
direr nach einer fremden Vorlage, z. B. nach einem
Gemälde arbeitet, darf er sich nicht als bloßer Tech-
niker fühlen. Hat er einmal die Umrisse festgestellt,
so bleibt er nicht mehr bei dem Einzelnen stehen,
sondern hält sich stets das Ganze vor Augen. Aus
dem Ganzen arbeitet er und für das Ganze, d. h.
für die Gesamtwirkung. Er giebt mit seinen Mitteln
die malerische Erscheinung wieder; dazu gehört
aber, dass er selbst als Maler empfindet. Für ihn
ist das Gemälde, das er nachbildet, gerade so
ein Naturgegenstand, wie eine Landschaft, eine Ar-
chitektur. Er muss das Eine wie das Andere als
geschlossene Einheit in seine Phantasie aufnehmen,
sie aus der bunten Farbenwelt in die einfach schwarz-
weiße übertragen und doch dahin wirken, dass der
farbige Schein, die volle Lebenswahrheit erhalten
bleibe. In jedem guten Radirer ist ein Maler ver-
borgen. Die Kunst der Radirung konnte daher zu
einem frischen Leben erst dann wieder auferstehen,
als die malerische Richtung in unserer Kunstwelt
überhaupt zu voller Geltung gelangte. Durch den
engeren Anschluss an die gerade herrschende, ihr
überaus günstige Kunstweise hat sie sich offenbar
eine größere Lebensdauer gesichert. Dasselbe gilt
vom Holzschnitte, welcher, wenn auch zögernd, den
gleichen Anschluss vollzog. So wenig wie von dem
Kupferstiche läßt sich vom Holzschnitte behaupten,
dass er nur noch kümmerlich atme, an dem Ende
seiner Entwicklungsfähigkeit angelangt sei. Seit
Bewick in England den halbvergessenen Holzschnitt
wieder zu Ehren brachte, hat dieser gar mannig-
fache Wandlungen erfahren, von welchen die meisten
als sichtliche Fortschritte zu begrüßen sind. Die
folgerichtige Änderung war der Übergang von dem
zeichnenden zum malerischen Stile. Dass dabei
mancher Irrtum, selbst grobe Fehler vorkamen, kann
nicht geleugnet werden. Ein tumultuarisches Treiben
zog an unseren Augen vorüber. Niemand darf es
namentlich uns Deutschen verargen, dass unser Herz
noch immer an der alten einfachen Holzschnittweise
hängt. Es wäre undankbar, die köstlichen Blätter,
die sie, in die Seele unseres Volkstums tief ein-
dringend, geschaffen hat, zu vergessen. Aber wir
müssen auf der andern Seite zugeben, dass der
Wechsel sich zumal in den Ländern, die keine
lange Kunsttradition besitzen, mit einer gewissen
Notwendigkeit vollzogen hat. Auch der reprodu-
zirende Künstler kann sich der gerade herrschenden
Kunstströmung nicht entziehen. Steigert sich in den
schöpferischen Künsten das Streben nach rein ma-
lerischen Wirkungen, so muss der nachbildende
Künstler dem Streben sich anschließen, will er nicht
den inneren Zusammenhang mit dem großen Kunst-
leben verlieren, zumal wenn er vor die Aufgabe ge-
stellt wird, solche rein malerisch gefasste Werke zu
reproduziren. Er würde gegen die Wahrheit sün-
digen, die Treue vermissen lassen, begnügte er sich
mit den Mitteln, welche der zeichnende Stil darbie-
tet. Er muss versuchen, auf den Holzblock mit dem
Stichel zu malen, den Schein der Farbe und des
Tones wiederzugeben. Ähnlich wie in der Radirung
empfangen wir in dem malenden Holzschnitt eine
freie Übertragung des Originales, frei insofern,
als zwar die Gesamtwirkung die gleiche ist oder
doch die gleiche sein soll, aber durch andere, von
dem Holzstecher selbständig gewählte Mittel erreicht
wird. Eine künstlerische Nachempfindung sichert
mehr als eine peinliche Treue in der Wiedergabe
jeder Einzelheit den Erfolg der Reproduktion.
(Schluss folgt.)
KORRESPONDENZ.
Köln, 3. März 1891.
P. — Am 2. März hat Direktor Aldenhoven zu-
nächst für ein geladenes Publikum im westlichen
Flügel des renovirten Kreuzganges im Wallraf-
Richartz-Museum eine neue Abteilung eröffnet und
damit Rechenschaft abgelegt, in welcher Weise er
die Reorganisation des ihm anvertrauten Instituts vor-
zunehmen gedenkt. Diese Abteilung, die Sammlung
Die Aufgaben der graphischen Künste. — Korrespondenz.
312
Begeisterung kann auch der vollkommensten Ma-
schine nicht mitgeteilt werden, und so bleibt immer
ein Grundunterschied zwischen der mechanischen
Reproduktion und der durch Menschenhand gemachten,
vorausgesetzt natürlich, dass sich die letztere nicht
zur Maschine erniedrigt.
Jetzt ist es auch klar, warum von allen Zweigen
der Kupferstechkunst die Radirung die größte Lebens-
kraft offenbart und die geringste Verzagtheit in
Bezug auf ihre Zukunft zeigt. In dem Augenblicke,
in welchem der älteren Linearmanier eine starke
Einbuße droht, erhebt sie sich und wächst, als wollte
sie der gefährdeten Schwesterkunst zu Hilfe eilen
und den Ruhm der graphischen Kunst retten. Bei
radirten Blättern lässt sich die Trennung der erfin-
denden und ausführenden Hand am wenigsten fest-
halten. Am besten, wenn Erfindung und Ausfüh-
rung in einer Hand vereinigt bleiben. Dann ist
hinreichend Sorge dafür getragen, dass das künst-
lerische Element zu seinem Rechte gelangt, wie denn
auch die Radirung die längste Zeit von Malern ge-
übt und gepflegt wurde. Aber auch wenn der Ra-
direr nach einer fremden Vorlage, z. B. nach einem
Gemälde arbeitet, darf er sich nicht als bloßer Tech-
niker fühlen. Hat er einmal die Umrisse festgestellt,
so bleibt er nicht mehr bei dem Einzelnen stehen,
sondern hält sich stets das Ganze vor Augen. Aus
dem Ganzen arbeitet er und für das Ganze, d. h.
für die Gesamtwirkung. Er giebt mit seinen Mitteln
die malerische Erscheinung wieder; dazu gehört
aber, dass er selbst als Maler empfindet. Für ihn
ist das Gemälde, das er nachbildet, gerade so
ein Naturgegenstand, wie eine Landschaft, eine Ar-
chitektur. Er muss das Eine wie das Andere als
geschlossene Einheit in seine Phantasie aufnehmen,
sie aus der bunten Farbenwelt in die einfach schwarz-
weiße übertragen und doch dahin wirken, dass der
farbige Schein, die volle Lebenswahrheit erhalten
bleibe. In jedem guten Radirer ist ein Maler ver-
borgen. Die Kunst der Radirung konnte daher zu
einem frischen Leben erst dann wieder auferstehen,
als die malerische Richtung in unserer Kunstwelt
überhaupt zu voller Geltung gelangte. Durch den
engeren Anschluss an die gerade herrschende, ihr
überaus günstige Kunstweise hat sie sich offenbar
eine größere Lebensdauer gesichert. Dasselbe gilt
vom Holzschnitte, welcher, wenn auch zögernd, den
gleichen Anschluss vollzog. So wenig wie von dem
Kupferstiche läßt sich vom Holzschnitte behaupten,
dass er nur noch kümmerlich atme, an dem Ende
seiner Entwicklungsfähigkeit angelangt sei. Seit
Bewick in England den halbvergessenen Holzschnitt
wieder zu Ehren brachte, hat dieser gar mannig-
fache Wandlungen erfahren, von welchen die meisten
als sichtliche Fortschritte zu begrüßen sind. Die
folgerichtige Änderung war der Übergang von dem
zeichnenden zum malerischen Stile. Dass dabei
mancher Irrtum, selbst grobe Fehler vorkamen, kann
nicht geleugnet werden. Ein tumultuarisches Treiben
zog an unseren Augen vorüber. Niemand darf es
namentlich uns Deutschen verargen, dass unser Herz
noch immer an der alten einfachen Holzschnittweise
hängt. Es wäre undankbar, die köstlichen Blätter,
die sie, in die Seele unseres Volkstums tief ein-
dringend, geschaffen hat, zu vergessen. Aber wir
müssen auf der andern Seite zugeben, dass der
Wechsel sich zumal in den Ländern, die keine
lange Kunsttradition besitzen, mit einer gewissen
Notwendigkeit vollzogen hat. Auch der reprodu-
zirende Künstler kann sich der gerade herrschenden
Kunstströmung nicht entziehen. Steigert sich in den
schöpferischen Künsten das Streben nach rein ma-
lerischen Wirkungen, so muss der nachbildende
Künstler dem Streben sich anschließen, will er nicht
den inneren Zusammenhang mit dem großen Kunst-
leben verlieren, zumal wenn er vor die Aufgabe ge-
stellt wird, solche rein malerisch gefasste Werke zu
reproduziren. Er würde gegen die Wahrheit sün-
digen, die Treue vermissen lassen, begnügte er sich
mit den Mitteln, welche der zeichnende Stil darbie-
tet. Er muss versuchen, auf den Holzblock mit dem
Stichel zu malen, den Schein der Farbe und des
Tones wiederzugeben. Ähnlich wie in der Radirung
empfangen wir in dem malenden Holzschnitt eine
freie Übertragung des Originales, frei insofern,
als zwar die Gesamtwirkung die gleiche ist oder
doch die gleiche sein soll, aber durch andere, von
dem Holzstecher selbständig gewählte Mittel erreicht
wird. Eine künstlerische Nachempfindung sichert
mehr als eine peinliche Treue in der Wiedergabe
jeder Einzelheit den Erfolg der Reproduktion.
(Schluss folgt.)
KORRESPONDENZ.
Köln, 3. März 1891.
P. — Am 2. März hat Direktor Aldenhoven zu-
nächst für ein geladenes Publikum im westlichen
Flügel des renovirten Kreuzganges im Wallraf-
Richartz-Museum eine neue Abteilung eröffnet und
damit Rechenschaft abgelegt, in welcher Weise er
die Reorganisation des ihm anvertrauten Instituts vor-
zunehmen gedenkt. Diese Abteilung, die Sammlung