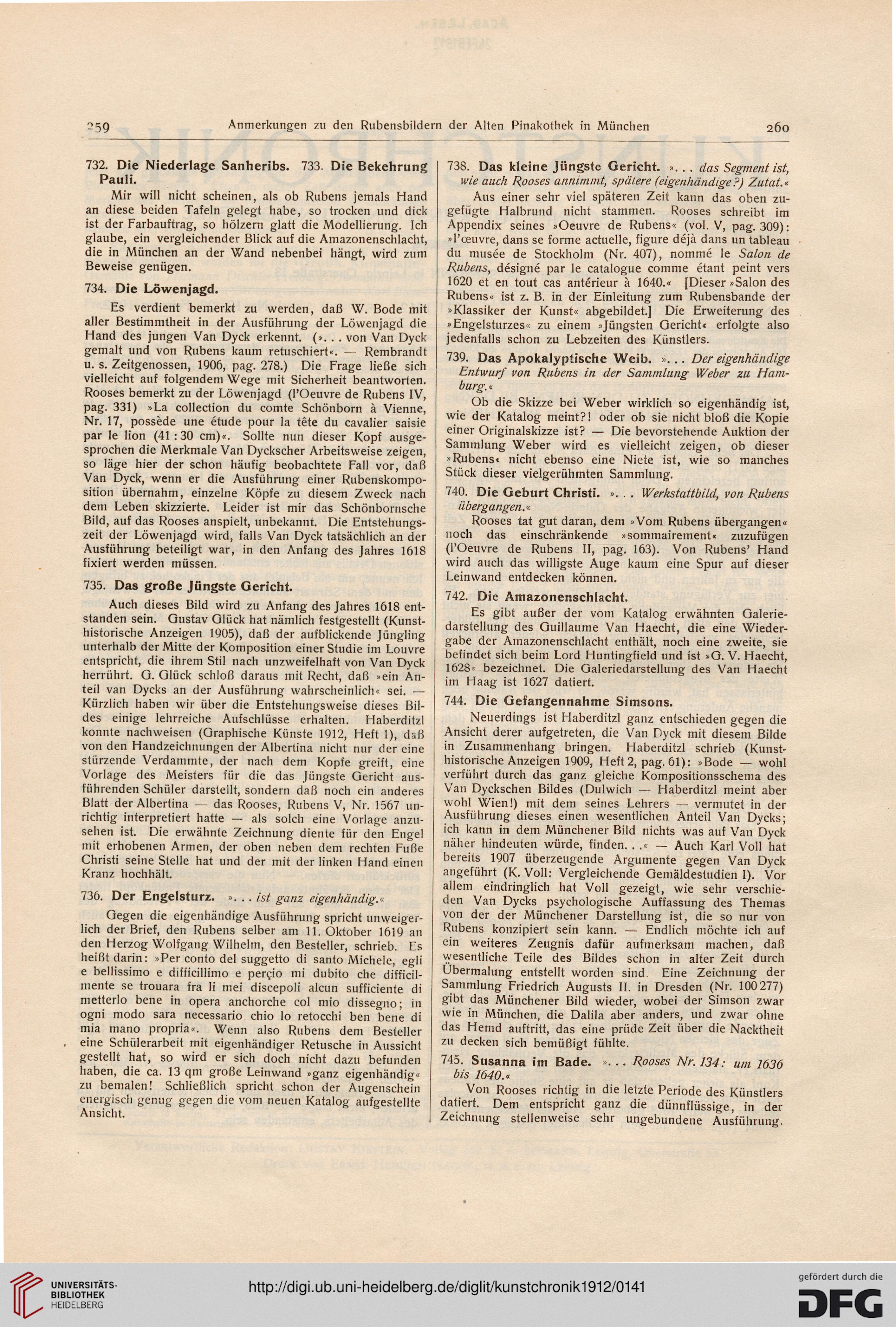Anmerkungen zu den Rubensbildern der Alten Pinakothek in München
260
732. Die Niederlage Sanheribs. 733. Die Bekehrung
Pauli.
Mir will nicht scheinen, als ob Rubens jemals Hand
an diese beiden Tafeln gelegt habe, so trocken und dick
ist der Farbauftrag, so hölzern glatt die Modellierung. Ich
glaube, ein vergleichender Blick auf die Amazonenschlacht,
die in München an der Wand nebenbei hängt, wird zum
Beweise genügen.
734. Die Löwenjagd.
Es verdient bemerkt zu werden, daß W. Bode mit
aller Bestimmtheit in der Ausführung der Löwenjagd die
Hand des jungen Van Dyck erkennt. (>. . . von Van Dyck
gemalt und von Rubens kaum retuschiert«. — Rembrandt
u. s. Zeitgenossen, 1906, pag. 278.) Die Frage ließe sich
vielleicht auf folgendem Wege mit Sicherheit beantworten.
Rooses bemerkt zu der Löwenjagd (l'Oeuvre de Rubens IV,
pag. 331) »La collection du comte Schönborn ä Vienne,
Nr. 17, possede une etude pour la tete du cavalier saisie
par le Hon (41:30 cm)«. Sollte nun dieser Kopf ausge-
sprochen die Merkmale Van Dyckscher Arbeitsweise zeigen,
so läge hier der schon häufig beobachtete Fall vor, daß
Van Dyck, wenn er die Ausführung einer Rubenskompo-
sition übernahm, einzelne Köpfe zu diesem Zweck nach
dem Leben skizzierte. Leider ist mir das Schönbornsche
Bild, auf das Rooses anspielt, unbekannt. Die Entstehungs-
zeit der Löwenjagd wird, falls Van Dyck tatsächlich an der
Ausführung beteiligt war, in den Anfang des Jahres 1618
fixiert werden müssen.
735. Das große Jüngste Gericht.
Auch dieses Bild wird zu Anfang des Jahres 1618 ent-
standen sein. Gustav Glück hat nämlich festgestellt (Kunst-
historische Anzeigen 1905), daß der aufblickende Jüngling
unterhalb der Mitte der Komposition einer Studie im Louvre
entspricht, die ihrem Stil nach unzweifelhaft von Van Dyck
herrührt. G. Glück schloß daraus mit Recht, daß »ein An-
teil van Dycks an der Ausführung wahrscheinlich« sei. —
Kürzlich haben wir über die Entstehungsweise dieses Bil-
des einige lehrreiche Aufschlüsse erhalten. Haberditzl
konnte nachweisen (Graphische Künste 1912, Heft 1), daß
von den Handzeichnungen der Albertina nicht nur der eine
stürzende Verdammte, der nach dem Kopfe greift, eine
Vorlage des Meisters für die das Jüngste Gericht aus-
führenden Schüler darstellt, sondern daß noch ein anderes
Blatt der Albertina — das Rooses, Rubens V, Nr. 1567 un-
richtig interpretiert hatte — als solch eine Vorlage anzu-
sehen ist. Die erwähnte Zeichnung diente für den Engel
mit erhobenen Armen, der oben neben dem rechten Fuße
Christi seine Stelle hat und der mit der linken Hand einen
Kranz hochhält.
736. Der Engelsturz. «... ist ganz eigenhändig.«
Gegen die eigenhändige Ausführung spricht unweiger-
lich der Brief, den Rubens selber am 11. Oktober 1619 an
den Herzog Wolfgang Wilhelm, den Besteller, schrieb. Es
heißt darin: »Per conto del suggetto di santo Michele, egli
e bellissimo e difficillimo e percio mi dubito che difficil-
mente se trouara fra Ii mei discepoli alcun sufficiente di
nietterlo bene in opera anchorche col mio dissegno; in
ogni modo sara necessario chio lo retocchi ben bene di
mia mano propria«. Wenn also Rubens dem Besteller
eine Schülerarbeit mit eigenhändiger Retusche in Aussicht
gestellt hat, so wird er sich doch nicht dazu befunden
haben, die ca. 13 qm große Leinwand »ganz eigenhändig«
zu bemalen! Schließlich spricht schon der Augenschein
energisch genug gegen die vom neuen Katalog aufgestellte
Ansicht.
738. Das kleine Jüngste Gericht. ». . . das Segment ist,
wie auch Rooses annimmt, spätere (eigenhändige ?) Zutat.«
Aus einer sehr viel späteren Zeit kann das oben zu-
gefügte Halbrund nicht stammen. Rooses schreibt im
Appendix seines »Oeuvre de Rubens« (vol. V, pag. 309):
»Poeuvre, dans se forme actuelle, figure dejä dans un tableau
du musee de Stockholm (Nr. 407), nomme le Salon de
Rubens, designe par le catalogue comme etant peint vers
1620 et en tout cas antdrieur ä 1640.« [Dieser »Salon des
Rubens« ist z. B. in der Einleitung zum Rubensbande der
»Klassiker der Kunst« abgebildet.] Die Erweiterung des
»Engelsturzes« zu einem »Jüngsten Gericht« erfolgte also
jedenfalls schon zu Lebzeiten des Künstlers.
739. Das Apokalyptische Weib. >... Der eigenhändige
Entwurf von Rubens in der Sammlung Weber zu Ham-
burg. ♦
Ob die Skizze bei Weber wirklich so eigenhändig ist,
wie der Katalog meint?! oder ob sie nicht bloß die Kopie
einer Originalskizze ist? — Die bevorstehende Auktion der
Sammlung Weber wird es vielleicht zeigen, ob dieser
»Rubens« nicht ebenso eine Niete ist, wie so manches
Stück dieser vielgerühmten Sammlung.
740. Die Geburt Christi. ». . . Werkstattbild, von Rubens
übergangen.«
Rooses tat gut daran, dem »Vom Rubens übergangen«
noch das einschränkende »sommairement« zuzufügen
(l'Oeuvre de Rubens II, pag. 163). Von Rubens' Hand
wird auch das willigste Auge kaum eine Spur auf dieser
Leinwand entdecken können.
742. Die Amazonenschlacht.
Es gibt außer der vom Katalog erwähnten Galerie-
darstellung des Guillaume Van Haecht, die eine Wieder-
gabe der Amazonenschlacht enthält, noch eine zweite, sie
befindet sich beim Lord Huntingfield und ist »G. V. Haecht,
1628« bezeichnet. Die Galeriedarstellung des Van Haecht
im Haag ist 1627 datiert.
744. Die Gefangennahme Simsons.
Neuerdings ist Haberditzl ganz entschieden gegen die
Ansicht derer aufgetreten, die Van Dyck mit diesem Bilde
in Zusammenhang bringen. Haberditzl schrieb (Kunst-
historische Anzeigen 1909, Heft 2, pag. 61): »Bode — wohl
verführt durch das ganz gleiche Kompositionsschema des
Van Dyckschen Bildes (Dulwich — Haberditzl meint aber
wohl Wien!) mit dem seines Lehrers — vermutet in der
Ausführung dieses einen wesentlichen Anteil Van Dycks;
ich kann in dem Münchener Bild nichts was auf Van Dyck
näher hindeuten würde, finden. . .« — Auch Karl Voll hat
bereits 1907 überzeugende Argumente gegen Van Dyck
angeführt (K. Voll: Vergleichende Gemäldestudien I). Vor
allem eindringlich hat Voll gezeigt, wie sehr verschie-
den Van Dycks psychologische Auffassung des Themas
von der der Münchener Darstellung ist, die so nur von
Rubens konzipiert sein kann. — Endlich möchte ich auf
ein weiteres Zeugnis dafür aufmerksam machen, daß
wesentliche Teile des Bildes schon in alter Zeit durch
Ubermalung entstellt worden sind. Eine Zeichnung der
Sammlung Friedrich Augusts II. in Dresden (Nr. 100277)
gibt das Münchener Bild wieder, wobei der Simson zwar
wie in München, die Dalila aber anders, und zwar ohne
das Hemd auftritt, das eine prüde Zeit über die Nacktheit
zu decken sich bemüßigt fühlte.
745. Susanna im Bade. ».. . . Rooses Nr. 134: um 1636
bis 1640."
Von Rooses richtig in die letzte Periode des Künstlers
datiert. Dem entspricht ganz die dünnflüssige, in der
Zeichnung stellenweise sehr ungebundene Ausführung.
260
732. Die Niederlage Sanheribs. 733. Die Bekehrung
Pauli.
Mir will nicht scheinen, als ob Rubens jemals Hand
an diese beiden Tafeln gelegt habe, so trocken und dick
ist der Farbauftrag, so hölzern glatt die Modellierung. Ich
glaube, ein vergleichender Blick auf die Amazonenschlacht,
die in München an der Wand nebenbei hängt, wird zum
Beweise genügen.
734. Die Löwenjagd.
Es verdient bemerkt zu werden, daß W. Bode mit
aller Bestimmtheit in der Ausführung der Löwenjagd die
Hand des jungen Van Dyck erkennt. (>. . . von Van Dyck
gemalt und von Rubens kaum retuschiert«. — Rembrandt
u. s. Zeitgenossen, 1906, pag. 278.) Die Frage ließe sich
vielleicht auf folgendem Wege mit Sicherheit beantworten.
Rooses bemerkt zu der Löwenjagd (l'Oeuvre de Rubens IV,
pag. 331) »La collection du comte Schönborn ä Vienne,
Nr. 17, possede une etude pour la tete du cavalier saisie
par le Hon (41:30 cm)«. Sollte nun dieser Kopf ausge-
sprochen die Merkmale Van Dyckscher Arbeitsweise zeigen,
so läge hier der schon häufig beobachtete Fall vor, daß
Van Dyck, wenn er die Ausführung einer Rubenskompo-
sition übernahm, einzelne Köpfe zu diesem Zweck nach
dem Leben skizzierte. Leider ist mir das Schönbornsche
Bild, auf das Rooses anspielt, unbekannt. Die Entstehungs-
zeit der Löwenjagd wird, falls Van Dyck tatsächlich an der
Ausführung beteiligt war, in den Anfang des Jahres 1618
fixiert werden müssen.
735. Das große Jüngste Gericht.
Auch dieses Bild wird zu Anfang des Jahres 1618 ent-
standen sein. Gustav Glück hat nämlich festgestellt (Kunst-
historische Anzeigen 1905), daß der aufblickende Jüngling
unterhalb der Mitte der Komposition einer Studie im Louvre
entspricht, die ihrem Stil nach unzweifelhaft von Van Dyck
herrührt. G. Glück schloß daraus mit Recht, daß »ein An-
teil van Dycks an der Ausführung wahrscheinlich« sei. —
Kürzlich haben wir über die Entstehungsweise dieses Bil-
des einige lehrreiche Aufschlüsse erhalten. Haberditzl
konnte nachweisen (Graphische Künste 1912, Heft 1), daß
von den Handzeichnungen der Albertina nicht nur der eine
stürzende Verdammte, der nach dem Kopfe greift, eine
Vorlage des Meisters für die das Jüngste Gericht aus-
führenden Schüler darstellt, sondern daß noch ein anderes
Blatt der Albertina — das Rooses, Rubens V, Nr. 1567 un-
richtig interpretiert hatte — als solch eine Vorlage anzu-
sehen ist. Die erwähnte Zeichnung diente für den Engel
mit erhobenen Armen, der oben neben dem rechten Fuße
Christi seine Stelle hat und der mit der linken Hand einen
Kranz hochhält.
736. Der Engelsturz. «... ist ganz eigenhändig.«
Gegen die eigenhändige Ausführung spricht unweiger-
lich der Brief, den Rubens selber am 11. Oktober 1619 an
den Herzog Wolfgang Wilhelm, den Besteller, schrieb. Es
heißt darin: »Per conto del suggetto di santo Michele, egli
e bellissimo e difficillimo e percio mi dubito che difficil-
mente se trouara fra Ii mei discepoli alcun sufficiente di
nietterlo bene in opera anchorche col mio dissegno; in
ogni modo sara necessario chio lo retocchi ben bene di
mia mano propria«. Wenn also Rubens dem Besteller
eine Schülerarbeit mit eigenhändiger Retusche in Aussicht
gestellt hat, so wird er sich doch nicht dazu befunden
haben, die ca. 13 qm große Leinwand »ganz eigenhändig«
zu bemalen! Schließlich spricht schon der Augenschein
energisch genug gegen die vom neuen Katalog aufgestellte
Ansicht.
738. Das kleine Jüngste Gericht. ». . . das Segment ist,
wie auch Rooses annimmt, spätere (eigenhändige ?) Zutat.«
Aus einer sehr viel späteren Zeit kann das oben zu-
gefügte Halbrund nicht stammen. Rooses schreibt im
Appendix seines »Oeuvre de Rubens« (vol. V, pag. 309):
»Poeuvre, dans se forme actuelle, figure dejä dans un tableau
du musee de Stockholm (Nr. 407), nomme le Salon de
Rubens, designe par le catalogue comme etant peint vers
1620 et en tout cas antdrieur ä 1640.« [Dieser »Salon des
Rubens« ist z. B. in der Einleitung zum Rubensbande der
»Klassiker der Kunst« abgebildet.] Die Erweiterung des
»Engelsturzes« zu einem »Jüngsten Gericht« erfolgte also
jedenfalls schon zu Lebzeiten des Künstlers.
739. Das Apokalyptische Weib. >... Der eigenhändige
Entwurf von Rubens in der Sammlung Weber zu Ham-
burg. ♦
Ob die Skizze bei Weber wirklich so eigenhändig ist,
wie der Katalog meint?! oder ob sie nicht bloß die Kopie
einer Originalskizze ist? — Die bevorstehende Auktion der
Sammlung Weber wird es vielleicht zeigen, ob dieser
»Rubens« nicht ebenso eine Niete ist, wie so manches
Stück dieser vielgerühmten Sammlung.
740. Die Geburt Christi. ». . . Werkstattbild, von Rubens
übergangen.«
Rooses tat gut daran, dem »Vom Rubens übergangen«
noch das einschränkende »sommairement« zuzufügen
(l'Oeuvre de Rubens II, pag. 163). Von Rubens' Hand
wird auch das willigste Auge kaum eine Spur auf dieser
Leinwand entdecken können.
742. Die Amazonenschlacht.
Es gibt außer der vom Katalog erwähnten Galerie-
darstellung des Guillaume Van Haecht, die eine Wieder-
gabe der Amazonenschlacht enthält, noch eine zweite, sie
befindet sich beim Lord Huntingfield und ist »G. V. Haecht,
1628« bezeichnet. Die Galeriedarstellung des Van Haecht
im Haag ist 1627 datiert.
744. Die Gefangennahme Simsons.
Neuerdings ist Haberditzl ganz entschieden gegen die
Ansicht derer aufgetreten, die Van Dyck mit diesem Bilde
in Zusammenhang bringen. Haberditzl schrieb (Kunst-
historische Anzeigen 1909, Heft 2, pag. 61): »Bode — wohl
verführt durch das ganz gleiche Kompositionsschema des
Van Dyckschen Bildes (Dulwich — Haberditzl meint aber
wohl Wien!) mit dem seines Lehrers — vermutet in der
Ausführung dieses einen wesentlichen Anteil Van Dycks;
ich kann in dem Münchener Bild nichts was auf Van Dyck
näher hindeuten würde, finden. . .« — Auch Karl Voll hat
bereits 1907 überzeugende Argumente gegen Van Dyck
angeführt (K. Voll: Vergleichende Gemäldestudien I). Vor
allem eindringlich hat Voll gezeigt, wie sehr verschie-
den Van Dycks psychologische Auffassung des Themas
von der der Münchener Darstellung ist, die so nur von
Rubens konzipiert sein kann. — Endlich möchte ich auf
ein weiteres Zeugnis dafür aufmerksam machen, daß
wesentliche Teile des Bildes schon in alter Zeit durch
Ubermalung entstellt worden sind. Eine Zeichnung der
Sammlung Friedrich Augusts II. in Dresden (Nr. 100277)
gibt das Münchener Bild wieder, wobei der Simson zwar
wie in München, die Dalila aber anders, und zwar ohne
das Hemd auftritt, das eine prüde Zeit über die Nacktheit
zu decken sich bemüßigt fühlte.
745. Susanna im Bade. ».. . . Rooses Nr. 134: um 1636
bis 1640."
Von Rooses richtig in die letzte Periode des Künstlers
datiert. Dem entspricht ganz die dünnflüssige, in der
Zeichnung stellenweise sehr ungebundene Ausführung.