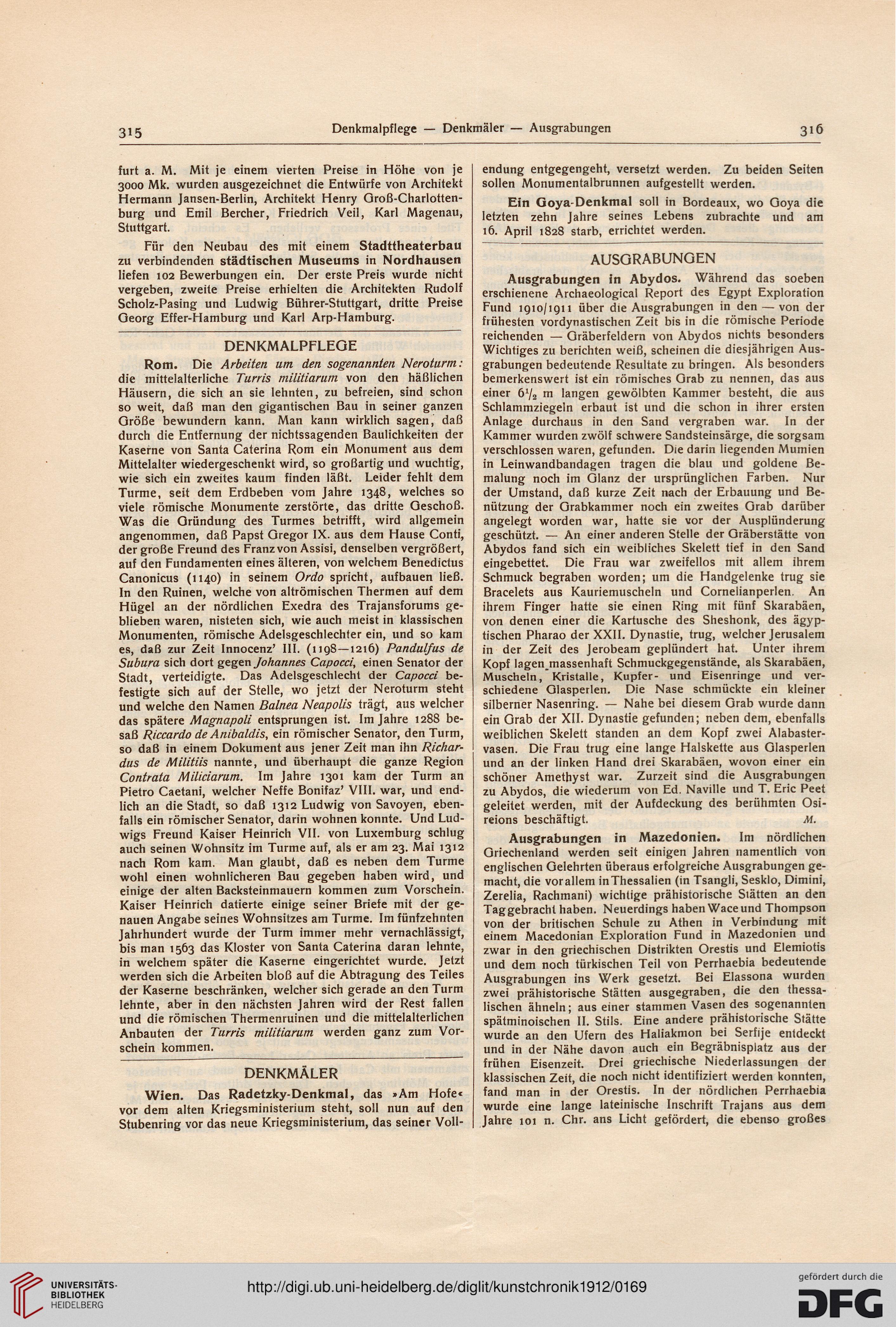315
Denkmalpflege — Denkmäler — Ausgrabungen
316
furt a. M. Mit je einem vierten Preise in Höhe von je
3000 Mk. wurden ausgezeichnet die Entwürfe von Architekt
Hermann Jansen-Berlin, Architekt Henry Groß-Charlotten-
burg und Emil Bercher, Friedrich Veil, Karl Magenau,
Stuttgart.
Für den Neubau des mit einem Stadttheaterbau
zu verbindenden städtischen Museums in Nordhausen
liefen 102 Bewerbungen ein. Der erste Preis wurde nicht
vergeben, zweite Preise erhielten die Architekten Rudolf
Scholz-Pasing und Ludwig Bührer-Stuttgart, dritte Preise
Oeorg Effer-Hamburg und Karl Arp-Hamburg.
DENKMALPFLEGE
Rom. Die Arbeiten um den sogenannten Neroturm:
die mittelalterliche Tunis militiarum von den häßlichen
Häusern, die sich an sie lehnten, zu befreien, sind schon
so weit, daß man den gigantischen Bau in seiner ganzen
Größe bewundern kann. Man kann wirklich sagen, daß
durch die Entfernung der nichtssagenden Baulichkeiten der
Kaserne von Santa Caterina Rom ein Monument aus dem
Mittelalter wiedergeschenkt wird, so großartig und wuchtig,
wie sich ein zweites kaum finden läßt. Leider fehlt dem
Turme, seit dem Erdbeben vom Jahre 1348, welches so
viele römische Monumente zerstörte, das dritte Qeschoß.
Was die Oründung des Turmes betrifft, wird allgemein
angenommen, daß Papst Gregor IX. aus dem Hause Conti,
der große Freund des Franz von Assisi, denselben vergrößert,
auf den Fundamenten eines älteren, von welchem Benedictus
Canonicus (1140) in seinem Ordo spricht, aufbauen ließ.
In den Ruinen, welche von altrömischen Thermen auf dem
Hügel an der nördlichen Exedra des Trajansforums ge-
blieben waren, nisteten sich, wie auch meist in klassischen
Monumenten, römische Adelsgeschlechter ein, und so kam
es, daß zur Zeit Innocenz' III. (1198 —1216) Pandulfus de
Subura sich dort gegen Johannes Capocci, einen Senator der
Stadt, verteidigte. Das Adelsgeschlecht der Capocci be-
festigte sich auf der Stelle, wo jetzt der Neroturm steht
und welche den Namen Balnea Neapolis trägt, aus welcher
das spätere Magnapoli entsprungen ist. Im Jahre 1288 be-
saß Riccardo de Anibaldis, ein römischer Senator, den Turm,
so daß in einem Dokument aus jener Zeit man ihn Richar-
dus de Militiis nannte, und überhaupt die ganze Region
Contrata Miliciarum. Im Jahre 1301 kam der Turm an
Pietro Caetani, welcher Neffe Bonifaz' VIII. war, und end-
lich an die Stadt, so daß 1312 Ludwig von Savoyen, eben-
falls ein römischer Senator, darin wohnen konnte. Und Lud-
wigs Freund Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg schlug
auch seinen Wohnsitz im Turme auf, als er am 23. Mai 1312
nach Rom kam. Man glaubt, daß es neben dem Turme
wohl einen wohnlicheren Bau gegeben haben wird, und
einige der alten Backsteinmauern kommen zum Vorschein.
Kaiser Heinrich datierte einige seiner Briefe mit der ge-
nauen Angabe seines Wohnsitzes am Turme. Im fünfzehnten
Jahrhundert wurde der Turm immer mehr vernachlässigt,
bis man 1563 das Kloster von Santa Caterina daran lehnte,
in welchem später die Kaserne eingerichtet wurde. Jetzt
werden sich die Arbeiten bloß auf die Abtragung des Teiles
der Kaserne beschränken, welcher sich gerade an den Turm
lehnte, aber in den nächsten Jahren wird der Rest fallen
und die römischen Thermenruinen und die mittelalterlichen
Anbauten der Turris militiarum werden ganz zum Vor-
schein kommen.
DENKMÄLER
Wien. Das Radetzky-Denkmal, das »Am Hofe«
vor dem alten Kriegsministerium steht, soll nun auf den
Stubenring vor das neue Kriegsministerium, das seiner Voll-
endung entgegengeht, versetzt werden. Zu beiden Seiten
sollen Monumentalbrunnen aufgestellt werden.
Ein Goya-Denkmal soll in Bordeaux, wo Goya die
letzten zehn Jahre seines Lebens zubrachte und am
16. April 1828 starb, errichtet werden.
AUSGRABUNGEN
Ausgrabungen in Abydos. Während das soeben
erschienene Archaeological Report des Egypt Exploration
Fund 1910/1911 über die Ausgrabungen in den — von der
frühesten vordynastischen Zeit bis in die römische Periode
reichenden — Gräberfeldern von Abydos nichts besonders
Wichtiges zu berichten weiß, scheinen die diesjährigen Aus-
grabungen bedeutende Resultate zu bringen. Als besonders
bemerkenswert ist ein römisches Grab zu nennen, das aus
einer 6y2 m langen gewölbten Kammer besteht, die aus
Schlammziegeln erbaut ist und die schon in ihrer ersten
Anlage durchaus in den Sand vergraben war. In der
Kammer wurden zwölf schwere Sandsteinsärge, die sorgsam
verschlossen waren, gefunden. Die darin liegenden Mumien
in Leinwandbandagen tragen die blau und goldene Be-
malung noch im Glanz der ursprünglichen Farben. Nur
der Umstand, daß kurze Zeit nach der Erbauung und Be-
nützung der Grabkammer noch ein zweites Grab darüber
angelegt worden war, hatte sie vor der Ausplünderung
geschützt. — An einer anderen Stelle der Gräberstätte von
Abydos fand sich ein weibliches Skelett tief in den Sand
eingebettet. Die Frau war zweifellos mit allem ihrem
Schmuck begraben worden; um die Handgelenke trug sie
Bracelets aus Kauriemuscheln und Cornelianperlen. An
ihrem Finger hatte sie einen Ring mit fünf Skarabäen,
von denen einer die Kartusche des Sheshonk, des ägyp-
tischen Pharao der XXII. Dynastie, trug, welcher Jerusalem
in der Zeit des Jerobeam geplündert hat. Unter ihrem
Kopf lagen^massenhaft Schmuckgegenstände, als Skarabäen,
Muscheln, Kristalle, Kupfer- und Eisenringe und ver-
schiedene Glasperlen. Die Nase schmückte ein kleiner
silberner Nasenring. — Nahe bei diesem Grab wurde dann
ein Grab der XII. Dynastie gefunden; neben dem, ebenfalls
weiblichen Skelett standen an dem Kopf zwei Alabaster-
vasen. Die Frau trug eine lange Halskette aus Glasperlen
und an der linken Hand drei Skarabäen, wovon einer ein
schöner Amethyst war. Zurzeit sind die Ausgrabungen
zu Abydos, die wiederum von Ed. Naville und T. Eric Peet
geleitet werden, mit der Aufdeckung des berühmten Osi-
reions beschäftigt. m.
Ausgrabungen in Mazedonien. Im nördlichen
Griechenland werden seit einigen Jahren namentlich von
englischen Gelehrten überaus erfolgreiche Ausgrabungen ge-
macht, die vorallem inThessalien (in Tsangli, Sesklo, Dimini,
Zerelia, Rachmani) wichtige prähistorische Stätten an den
Taggebracht haben. Neuerdings haben Wace und Thompson
von der britischen Schule zu Athen in Verbindung mit
einem Macedonian Exploration Fund in Mazedonien und
zwar in den griechischen Distrikten Orestis und Elemiotis
und dem noch türkischen Teil von Perrhaebia bedeutende
Ausgrabungen ins Werk gesetzt. Bei Elassona wurden
zwei prähistorische Stätten ausgegraben, die den thessa-
lischen ähneln; aus einer stammen Vasen des sogenannten
spätminoischen II. Stils. Eine andere prähistorische Stätte
wurde an den Ufern des Haliakmon bei Serfije entdeckt
und in der Nähe davon auch ein Begräbnisplatz aus der
frühen Eisenzeit. Drei griechische Niederlassungen der
klassischen Zeit, die noch nicht identifiziert werden konnten,
fand man in der Orestis. In der nördlichen Perrhaebia
wurde eine lange lateinische Inschrift Trajans aus dem
Jahre 101 n. Chr. ans Licht gefördert, die ebenso großes
Denkmalpflege — Denkmäler — Ausgrabungen
316
furt a. M. Mit je einem vierten Preise in Höhe von je
3000 Mk. wurden ausgezeichnet die Entwürfe von Architekt
Hermann Jansen-Berlin, Architekt Henry Groß-Charlotten-
burg und Emil Bercher, Friedrich Veil, Karl Magenau,
Stuttgart.
Für den Neubau des mit einem Stadttheaterbau
zu verbindenden städtischen Museums in Nordhausen
liefen 102 Bewerbungen ein. Der erste Preis wurde nicht
vergeben, zweite Preise erhielten die Architekten Rudolf
Scholz-Pasing und Ludwig Bührer-Stuttgart, dritte Preise
Oeorg Effer-Hamburg und Karl Arp-Hamburg.
DENKMALPFLEGE
Rom. Die Arbeiten um den sogenannten Neroturm:
die mittelalterliche Tunis militiarum von den häßlichen
Häusern, die sich an sie lehnten, zu befreien, sind schon
so weit, daß man den gigantischen Bau in seiner ganzen
Größe bewundern kann. Man kann wirklich sagen, daß
durch die Entfernung der nichtssagenden Baulichkeiten der
Kaserne von Santa Caterina Rom ein Monument aus dem
Mittelalter wiedergeschenkt wird, so großartig und wuchtig,
wie sich ein zweites kaum finden läßt. Leider fehlt dem
Turme, seit dem Erdbeben vom Jahre 1348, welches so
viele römische Monumente zerstörte, das dritte Qeschoß.
Was die Oründung des Turmes betrifft, wird allgemein
angenommen, daß Papst Gregor IX. aus dem Hause Conti,
der große Freund des Franz von Assisi, denselben vergrößert,
auf den Fundamenten eines älteren, von welchem Benedictus
Canonicus (1140) in seinem Ordo spricht, aufbauen ließ.
In den Ruinen, welche von altrömischen Thermen auf dem
Hügel an der nördlichen Exedra des Trajansforums ge-
blieben waren, nisteten sich, wie auch meist in klassischen
Monumenten, römische Adelsgeschlechter ein, und so kam
es, daß zur Zeit Innocenz' III. (1198 —1216) Pandulfus de
Subura sich dort gegen Johannes Capocci, einen Senator der
Stadt, verteidigte. Das Adelsgeschlecht der Capocci be-
festigte sich auf der Stelle, wo jetzt der Neroturm steht
und welche den Namen Balnea Neapolis trägt, aus welcher
das spätere Magnapoli entsprungen ist. Im Jahre 1288 be-
saß Riccardo de Anibaldis, ein römischer Senator, den Turm,
so daß in einem Dokument aus jener Zeit man ihn Richar-
dus de Militiis nannte, und überhaupt die ganze Region
Contrata Miliciarum. Im Jahre 1301 kam der Turm an
Pietro Caetani, welcher Neffe Bonifaz' VIII. war, und end-
lich an die Stadt, so daß 1312 Ludwig von Savoyen, eben-
falls ein römischer Senator, darin wohnen konnte. Und Lud-
wigs Freund Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg schlug
auch seinen Wohnsitz im Turme auf, als er am 23. Mai 1312
nach Rom kam. Man glaubt, daß es neben dem Turme
wohl einen wohnlicheren Bau gegeben haben wird, und
einige der alten Backsteinmauern kommen zum Vorschein.
Kaiser Heinrich datierte einige seiner Briefe mit der ge-
nauen Angabe seines Wohnsitzes am Turme. Im fünfzehnten
Jahrhundert wurde der Turm immer mehr vernachlässigt,
bis man 1563 das Kloster von Santa Caterina daran lehnte,
in welchem später die Kaserne eingerichtet wurde. Jetzt
werden sich die Arbeiten bloß auf die Abtragung des Teiles
der Kaserne beschränken, welcher sich gerade an den Turm
lehnte, aber in den nächsten Jahren wird der Rest fallen
und die römischen Thermenruinen und die mittelalterlichen
Anbauten der Turris militiarum werden ganz zum Vor-
schein kommen.
DENKMÄLER
Wien. Das Radetzky-Denkmal, das »Am Hofe«
vor dem alten Kriegsministerium steht, soll nun auf den
Stubenring vor das neue Kriegsministerium, das seiner Voll-
endung entgegengeht, versetzt werden. Zu beiden Seiten
sollen Monumentalbrunnen aufgestellt werden.
Ein Goya-Denkmal soll in Bordeaux, wo Goya die
letzten zehn Jahre seines Lebens zubrachte und am
16. April 1828 starb, errichtet werden.
AUSGRABUNGEN
Ausgrabungen in Abydos. Während das soeben
erschienene Archaeological Report des Egypt Exploration
Fund 1910/1911 über die Ausgrabungen in den — von der
frühesten vordynastischen Zeit bis in die römische Periode
reichenden — Gräberfeldern von Abydos nichts besonders
Wichtiges zu berichten weiß, scheinen die diesjährigen Aus-
grabungen bedeutende Resultate zu bringen. Als besonders
bemerkenswert ist ein römisches Grab zu nennen, das aus
einer 6y2 m langen gewölbten Kammer besteht, die aus
Schlammziegeln erbaut ist und die schon in ihrer ersten
Anlage durchaus in den Sand vergraben war. In der
Kammer wurden zwölf schwere Sandsteinsärge, die sorgsam
verschlossen waren, gefunden. Die darin liegenden Mumien
in Leinwandbandagen tragen die blau und goldene Be-
malung noch im Glanz der ursprünglichen Farben. Nur
der Umstand, daß kurze Zeit nach der Erbauung und Be-
nützung der Grabkammer noch ein zweites Grab darüber
angelegt worden war, hatte sie vor der Ausplünderung
geschützt. — An einer anderen Stelle der Gräberstätte von
Abydos fand sich ein weibliches Skelett tief in den Sand
eingebettet. Die Frau war zweifellos mit allem ihrem
Schmuck begraben worden; um die Handgelenke trug sie
Bracelets aus Kauriemuscheln und Cornelianperlen. An
ihrem Finger hatte sie einen Ring mit fünf Skarabäen,
von denen einer die Kartusche des Sheshonk, des ägyp-
tischen Pharao der XXII. Dynastie, trug, welcher Jerusalem
in der Zeit des Jerobeam geplündert hat. Unter ihrem
Kopf lagen^massenhaft Schmuckgegenstände, als Skarabäen,
Muscheln, Kristalle, Kupfer- und Eisenringe und ver-
schiedene Glasperlen. Die Nase schmückte ein kleiner
silberner Nasenring. — Nahe bei diesem Grab wurde dann
ein Grab der XII. Dynastie gefunden; neben dem, ebenfalls
weiblichen Skelett standen an dem Kopf zwei Alabaster-
vasen. Die Frau trug eine lange Halskette aus Glasperlen
und an der linken Hand drei Skarabäen, wovon einer ein
schöner Amethyst war. Zurzeit sind die Ausgrabungen
zu Abydos, die wiederum von Ed. Naville und T. Eric Peet
geleitet werden, mit der Aufdeckung des berühmten Osi-
reions beschäftigt. m.
Ausgrabungen in Mazedonien. Im nördlichen
Griechenland werden seit einigen Jahren namentlich von
englischen Gelehrten überaus erfolgreiche Ausgrabungen ge-
macht, die vorallem inThessalien (in Tsangli, Sesklo, Dimini,
Zerelia, Rachmani) wichtige prähistorische Stätten an den
Taggebracht haben. Neuerdings haben Wace und Thompson
von der britischen Schule zu Athen in Verbindung mit
einem Macedonian Exploration Fund in Mazedonien und
zwar in den griechischen Distrikten Orestis und Elemiotis
und dem noch türkischen Teil von Perrhaebia bedeutende
Ausgrabungen ins Werk gesetzt. Bei Elassona wurden
zwei prähistorische Stätten ausgegraben, die den thessa-
lischen ähneln; aus einer stammen Vasen des sogenannten
spätminoischen II. Stils. Eine andere prähistorische Stätte
wurde an den Ufern des Haliakmon bei Serfije entdeckt
und in der Nähe davon auch ein Begräbnisplatz aus der
frühen Eisenzeit. Drei griechische Niederlassungen der
klassischen Zeit, die noch nicht identifiziert werden konnten,
fand man in der Orestis. In der nördlichen Perrhaebia
wurde eine lange lateinische Inschrift Trajans aus dem
Jahre 101 n. Chr. ans Licht gefördert, die ebenso großes