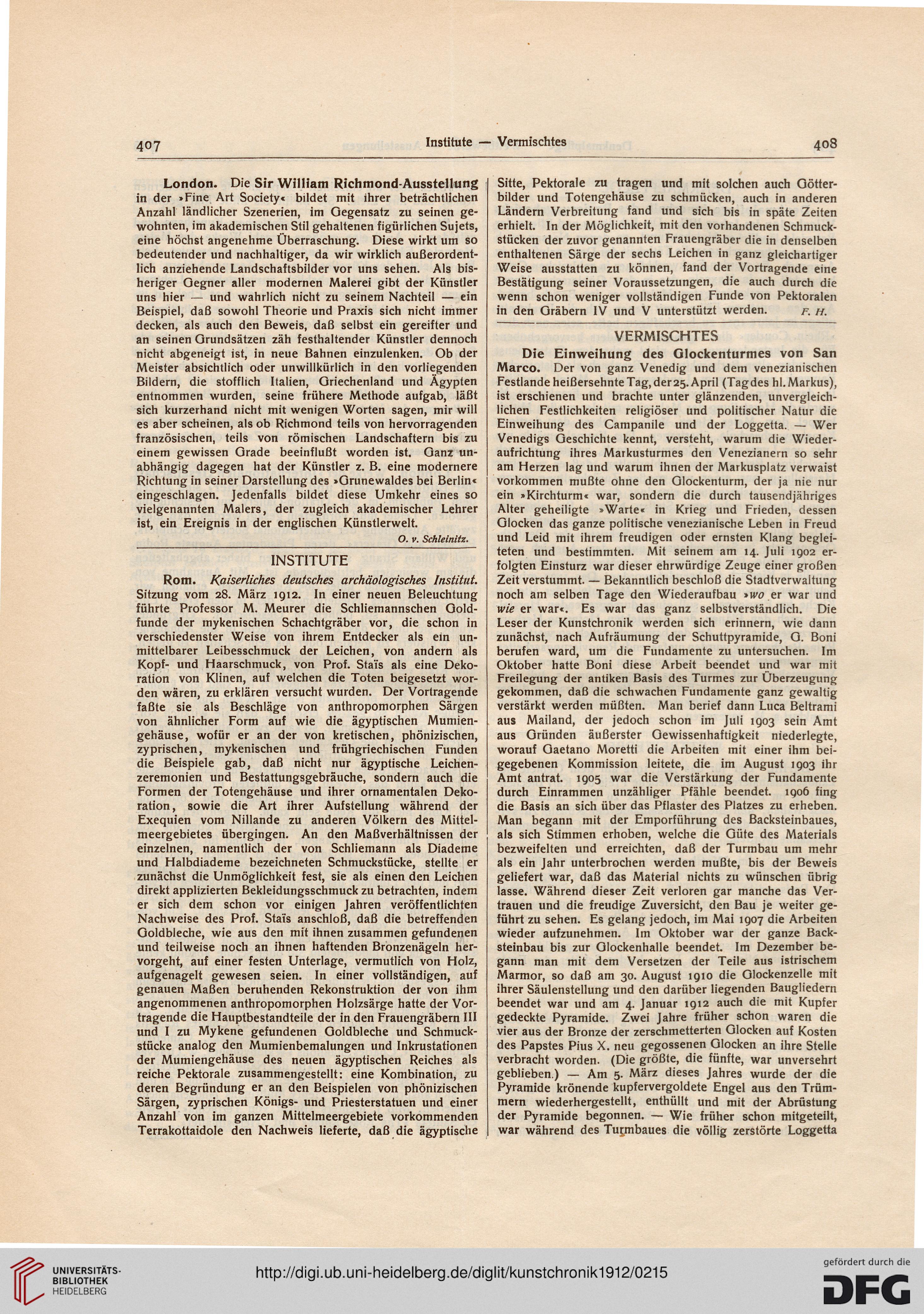407
Institute — Vermischtes
408
London. Die Sir William Richmond Ausstellung
in der »Fine Art Societyc bildet mit ihrer beträchtlichen
Anzahl ländlicher Szenerien, im Gegensatz zu seinen ge-
wohnten, im akademischen Stil gehaltenen figürlichen Sujets,
eine höchst angenehme Überraschung. Diese wirkt um so
bedeutender und nachhaltiger, da wir wirklich außerordent-
lich anziehende Landschaftsbilder vor uns sehen. Als bis-
heriger Gegner aller modernen Malerei gibt der Künstler
uns hier — und wahrlich nicht zu seinem Nachteil — ein
Beispiel, daß sowohl Theorie und Praxis sich nicht immer
decken, als auch den Beweis, daß selbst ein gereifter und
an seinen Grundsätzen zäh festhaltender Künstler dennoch
nicht abgeneigt ist, in neue Bahnen einzulenken. Ob der
Meister absichtlich oder unwillkürlich in den vorliegenden
Bildern, die stofflich Italien, Griechenland und Ägypten
entnommen wurden, seine frühere Methode aufgab, läßt
sich kurzerhand nicht mit wenigen Worten sagen, mir will
es aber scheinen, als ob Richmond teils von hervorragenden
französischen, teils von römischen Landschaftern bis zu
einem gewissen Grade beeinflußt worden ist. Ganz un-
abhängig dagegen hat der Künstler z. B. eine modernere
Richtung in seiner Darstellung des »Grunewaldes bei Berlin«
eingeschlagen. Jedenfalls bildet diese Umkehr eines so
vielgenannten Malers, der zugleich akademischer Lehrer
ist, ein Ereignis in der englischen Künstlerwelt.
O. v. Schleinitz.
INSTITUTE
Rom. Kaiserliches deutsches archäologisches Institut.
Sitzung vom 28. März igt2. In einer neuen Beleuchtung
führte Professor M. Meurer die Schliemannschen Gold-
funde der mykenischen Schachtgräber vor, die schon in
verschiedenster Weise von ihrem Entdecker als ein un-
mittelbarer Leibesschmuck der Leichen, von andern als
Kopf- und Haarschmuck, von Prof. Stai's als eine Deko-
ration von Klinen, auf welchen die Toten beigesetzt wor-
den wären, zu erklären versucht wurden. Der Vortragende
faßte sie als Beschläge von anthropomorphen Särgen
von ähnlicher Form auf wie die ägyptischen Mumien-
gehäuse, wofür er an der von kretischen, phönizischen,
zyprischen, mykenischen und frühgriechischen Funden
die Beispiele gab, daß nicht nur ägyptische Leichen-
zeremonien und Bestattungsgebräuche, sondern auch die
Formen der Totengehäuse und ihrer ornamentalen Deko-
ration, sowie die Art ihrer Aufstellung während der
Exequien vom Nillande zu anderen Völkern des Mittel-
meergebietes übergingen. An den Maßverhältnissen der
einzelnen, namentlich der von Schliemann als Diademe
und Halbdiademe bezeichneten Schmuckstücke, stellte er
zunächst die Unmöglichkeit fest, sie als einen den Leichen
direkt applizierten Bekleidungsschmuck zu betrachten, indem
er sich dem schon vor einigen Jahren veröffentlichten
Nachweise des Prof. Stais anschloß, daß die betreffenden
Goldbleche, wie aus den mit ihnen zusammen gefundenen
und teilweise noch an ihnen haftenden Bronzenägeln her-
vorgeht, auf einer festen Unterlage, vermutlich von Holz,
aufgenagelt gewesen seien. In einer vollständigen, auf
genauen Maßen beruhenden Rekonstruktion der von ihm
angenommenen anthropomorphen Holzsärge hatte der Vor-
tragende die Hauptbestandteile der in den Frauengräbern III
und I zu Mykene gefundenen Ooldbleche und Schmuck-
stücke analog den Mumienbemalungen und Inkrustationen
der Mumiengehäuse des neuen ägyptischen Reiches als
reiche Pektorale zusammengestellt: eine Kombination, zu
deren Begründung er an den Beispielen von phönizischen
Särgen, zyprischen Königs- und Priesterstatuen und einer
Anzahl von im ganzen Mittelmeergebiete vorkommenden
Terrakottaidole den Nachweis lieferte, daß die ägyptische
Sitte, Pektorale zu tragen und mit solchen auch Götter-
bilder und Totengehäuse zu schmücken, auch in anderen
Ländern Verbreitung fand und sich bis in späte Zeiten
erhielt. In der Möglichkeit, mit den vorhandenen Schmuck-
stücken der zuvor genannten Frauengräber die in denselben
enthaltenen Särge der sechs Leichen in ganz gleichartiger
Weise ausstatten zu können, fand der Vortragende eine
Bestätigung seiner Voraussetzungen, die auch durch die
wenn schon weniger vollständigen Funde von Pektoralen
in den Oräbern IV und V unterstützt werden. j» h.
VERMISCHTES
Die Einweihung des Glockenturmes von San
Marco. Der von ganz Venedig und dem venezianischen
Festlande heißersehnte Tag, der 25. April (Tagdes hl. Markus),
ist erschienen und brachte unter glänzenden, unvergleich-
lichen Festlichkeiten religiöser und politischer Natur die
Einweihung des Campanile und der Loggetta. — Wer
Venedigs Geschichte kennt, versteht, warum die Wieder-
aufrichtung ihres Markusturmes den Venezianern so sehr
am Herzen lag und warum ihnen der Markusplatz verwaist
vorkommen mußte ohne den Glockenturm, der ja nie nur
ein »Kirchturm« war, sondern die durch tausendjähriges
Alter geheiligte »Warte« in Krieg und Frieden, dessen
Glocken das ganze politische venezianische Leben in Freud
und Leid mit ihrem freudigen oder ernsten Klang beglei-
teten und bestimmten. Mit seinem am 14. Juli igo2 er-
folgten Einsturz war dieser ehrwürdige Zeuge einer großen
Zeit verstummt. — Bekanntlich beschloß die Stadtverwaltung
noch am selben Tage den Wiederaufbau »wo er war und
wie er war«. Es war das ganz selbstverständlich. Die
Leser der Kunstchronik werden sich erinnern, wie dann
zunächst, nach Aufräumung der Schuttpyramide, G. Boni
berufen ward, um die Fundamente zu untersuchen. Im
Oktober hatte Boni diese Arbeit beendet und war mit
Freilegung der antiken Basis des Turmes zur Überzeugung
gekommen, daß die schwachen Fundamente ganz gewaltig
verstärkt werden müßten. Man berief dann Luca Beltrami
aus Mailand, der jedoch schon im Juli 1903 sein Amt
aus Gründen äußerster Gewissenhaftigkeit niederlegte,
worauf Gaetano Moretti die Arbeiten mit einer ihm bei-
gegebenen Kommission leitete, die im August 1903 ihr
Amt antrat. 1905 war die Verstärkung der Fundamente
durch Einrammen unzähliger Pfähle beendet. 1906 fing
die Basis an sich über das Pflaster des Platzes zu erheben.
Man begann mit der Emporführung des Backsteinbaues,
als sich Stimmen erhoben, welche die Güte des Materials
bezweifelten und erreichten, daß der Turmbau um mehr
als ein Jahr unterbrochen werden mußte, bis der Beweis
geliefert war, daß das Material nichts zu wünschen übrig
lasse. Während dieser Zeit verloren gar manche das Ver-
trauen und die freudige Zuversicht, den Bau je weiter ge-
führt zu sehen. Es gelang jedoch, im Mai 1907 die Arbeiten
wieder aufzunehmen. Im Oktober war der ganze Back-
steinbau bis zur Glockenhalle beendet. Im Dezember be-
gann man mit dem Versetzen der Teile aus istrischem
Marmor, so daß am 30. August 1910 die Glockenzelle mit
ihrer Säulenstellung und den darüber liegenden Baugliedern
beendet war und am 4. Januar 1912 auch die mit Kupfer
gedeckte Pyramide. Zwei Jahre früher schon waren die
vier aus der Bronze der zerschmetterten Glocken auf Kosten
des Papstes Pius X. neu gegossenen Glocken an ihre Stelle
verbracht worden. (Die größte, die fünfte, war unversehrt
geblieben.) — Am 5. März dieses Jahres wurde der die
Pyramide krönende kupfervergoldete Engel aus den Trüm-
mern wiederhergestellt, enthüllt und mit der Abrüstung
der Pyramide begonnen. — Wie früher schon mitgeteilt,
war während des Turmbaues die völlig zerstörte Loggetta
Institute — Vermischtes
408
London. Die Sir William Richmond Ausstellung
in der »Fine Art Societyc bildet mit ihrer beträchtlichen
Anzahl ländlicher Szenerien, im Gegensatz zu seinen ge-
wohnten, im akademischen Stil gehaltenen figürlichen Sujets,
eine höchst angenehme Überraschung. Diese wirkt um so
bedeutender und nachhaltiger, da wir wirklich außerordent-
lich anziehende Landschaftsbilder vor uns sehen. Als bis-
heriger Gegner aller modernen Malerei gibt der Künstler
uns hier — und wahrlich nicht zu seinem Nachteil — ein
Beispiel, daß sowohl Theorie und Praxis sich nicht immer
decken, als auch den Beweis, daß selbst ein gereifter und
an seinen Grundsätzen zäh festhaltender Künstler dennoch
nicht abgeneigt ist, in neue Bahnen einzulenken. Ob der
Meister absichtlich oder unwillkürlich in den vorliegenden
Bildern, die stofflich Italien, Griechenland und Ägypten
entnommen wurden, seine frühere Methode aufgab, läßt
sich kurzerhand nicht mit wenigen Worten sagen, mir will
es aber scheinen, als ob Richmond teils von hervorragenden
französischen, teils von römischen Landschaftern bis zu
einem gewissen Grade beeinflußt worden ist. Ganz un-
abhängig dagegen hat der Künstler z. B. eine modernere
Richtung in seiner Darstellung des »Grunewaldes bei Berlin«
eingeschlagen. Jedenfalls bildet diese Umkehr eines so
vielgenannten Malers, der zugleich akademischer Lehrer
ist, ein Ereignis in der englischen Künstlerwelt.
O. v. Schleinitz.
INSTITUTE
Rom. Kaiserliches deutsches archäologisches Institut.
Sitzung vom 28. März igt2. In einer neuen Beleuchtung
führte Professor M. Meurer die Schliemannschen Gold-
funde der mykenischen Schachtgräber vor, die schon in
verschiedenster Weise von ihrem Entdecker als ein un-
mittelbarer Leibesschmuck der Leichen, von andern als
Kopf- und Haarschmuck, von Prof. Stai's als eine Deko-
ration von Klinen, auf welchen die Toten beigesetzt wor-
den wären, zu erklären versucht wurden. Der Vortragende
faßte sie als Beschläge von anthropomorphen Särgen
von ähnlicher Form auf wie die ägyptischen Mumien-
gehäuse, wofür er an der von kretischen, phönizischen,
zyprischen, mykenischen und frühgriechischen Funden
die Beispiele gab, daß nicht nur ägyptische Leichen-
zeremonien und Bestattungsgebräuche, sondern auch die
Formen der Totengehäuse und ihrer ornamentalen Deko-
ration, sowie die Art ihrer Aufstellung während der
Exequien vom Nillande zu anderen Völkern des Mittel-
meergebietes übergingen. An den Maßverhältnissen der
einzelnen, namentlich der von Schliemann als Diademe
und Halbdiademe bezeichneten Schmuckstücke, stellte er
zunächst die Unmöglichkeit fest, sie als einen den Leichen
direkt applizierten Bekleidungsschmuck zu betrachten, indem
er sich dem schon vor einigen Jahren veröffentlichten
Nachweise des Prof. Stais anschloß, daß die betreffenden
Goldbleche, wie aus den mit ihnen zusammen gefundenen
und teilweise noch an ihnen haftenden Bronzenägeln her-
vorgeht, auf einer festen Unterlage, vermutlich von Holz,
aufgenagelt gewesen seien. In einer vollständigen, auf
genauen Maßen beruhenden Rekonstruktion der von ihm
angenommenen anthropomorphen Holzsärge hatte der Vor-
tragende die Hauptbestandteile der in den Frauengräbern III
und I zu Mykene gefundenen Ooldbleche und Schmuck-
stücke analog den Mumienbemalungen und Inkrustationen
der Mumiengehäuse des neuen ägyptischen Reiches als
reiche Pektorale zusammengestellt: eine Kombination, zu
deren Begründung er an den Beispielen von phönizischen
Särgen, zyprischen Königs- und Priesterstatuen und einer
Anzahl von im ganzen Mittelmeergebiete vorkommenden
Terrakottaidole den Nachweis lieferte, daß die ägyptische
Sitte, Pektorale zu tragen und mit solchen auch Götter-
bilder und Totengehäuse zu schmücken, auch in anderen
Ländern Verbreitung fand und sich bis in späte Zeiten
erhielt. In der Möglichkeit, mit den vorhandenen Schmuck-
stücken der zuvor genannten Frauengräber die in denselben
enthaltenen Särge der sechs Leichen in ganz gleichartiger
Weise ausstatten zu können, fand der Vortragende eine
Bestätigung seiner Voraussetzungen, die auch durch die
wenn schon weniger vollständigen Funde von Pektoralen
in den Oräbern IV und V unterstützt werden. j» h.
VERMISCHTES
Die Einweihung des Glockenturmes von San
Marco. Der von ganz Venedig und dem venezianischen
Festlande heißersehnte Tag, der 25. April (Tagdes hl. Markus),
ist erschienen und brachte unter glänzenden, unvergleich-
lichen Festlichkeiten religiöser und politischer Natur die
Einweihung des Campanile und der Loggetta. — Wer
Venedigs Geschichte kennt, versteht, warum die Wieder-
aufrichtung ihres Markusturmes den Venezianern so sehr
am Herzen lag und warum ihnen der Markusplatz verwaist
vorkommen mußte ohne den Glockenturm, der ja nie nur
ein »Kirchturm« war, sondern die durch tausendjähriges
Alter geheiligte »Warte« in Krieg und Frieden, dessen
Glocken das ganze politische venezianische Leben in Freud
und Leid mit ihrem freudigen oder ernsten Klang beglei-
teten und bestimmten. Mit seinem am 14. Juli igo2 er-
folgten Einsturz war dieser ehrwürdige Zeuge einer großen
Zeit verstummt. — Bekanntlich beschloß die Stadtverwaltung
noch am selben Tage den Wiederaufbau »wo er war und
wie er war«. Es war das ganz selbstverständlich. Die
Leser der Kunstchronik werden sich erinnern, wie dann
zunächst, nach Aufräumung der Schuttpyramide, G. Boni
berufen ward, um die Fundamente zu untersuchen. Im
Oktober hatte Boni diese Arbeit beendet und war mit
Freilegung der antiken Basis des Turmes zur Überzeugung
gekommen, daß die schwachen Fundamente ganz gewaltig
verstärkt werden müßten. Man berief dann Luca Beltrami
aus Mailand, der jedoch schon im Juli 1903 sein Amt
aus Gründen äußerster Gewissenhaftigkeit niederlegte,
worauf Gaetano Moretti die Arbeiten mit einer ihm bei-
gegebenen Kommission leitete, die im August 1903 ihr
Amt antrat. 1905 war die Verstärkung der Fundamente
durch Einrammen unzähliger Pfähle beendet. 1906 fing
die Basis an sich über das Pflaster des Platzes zu erheben.
Man begann mit der Emporführung des Backsteinbaues,
als sich Stimmen erhoben, welche die Güte des Materials
bezweifelten und erreichten, daß der Turmbau um mehr
als ein Jahr unterbrochen werden mußte, bis der Beweis
geliefert war, daß das Material nichts zu wünschen übrig
lasse. Während dieser Zeit verloren gar manche das Ver-
trauen und die freudige Zuversicht, den Bau je weiter ge-
führt zu sehen. Es gelang jedoch, im Mai 1907 die Arbeiten
wieder aufzunehmen. Im Oktober war der ganze Back-
steinbau bis zur Glockenhalle beendet. Im Dezember be-
gann man mit dem Versetzen der Teile aus istrischem
Marmor, so daß am 30. August 1910 die Glockenzelle mit
ihrer Säulenstellung und den darüber liegenden Baugliedern
beendet war und am 4. Januar 1912 auch die mit Kupfer
gedeckte Pyramide. Zwei Jahre früher schon waren die
vier aus der Bronze der zerschmetterten Glocken auf Kosten
des Papstes Pius X. neu gegossenen Glocken an ihre Stelle
verbracht worden. (Die größte, die fünfte, war unversehrt
geblieben.) — Am 5. März dieses Jahres wurde der die
Pyramide krönende kupfervergoldete Engel aus den Trüm-
mern wiederhergestellt, enthüllt und mit der Abrüstung
der Pyramide begonnen. — Wie früher schon mitgeteilt,
war während des Turmbaues die völlig zerstörte Loggetta