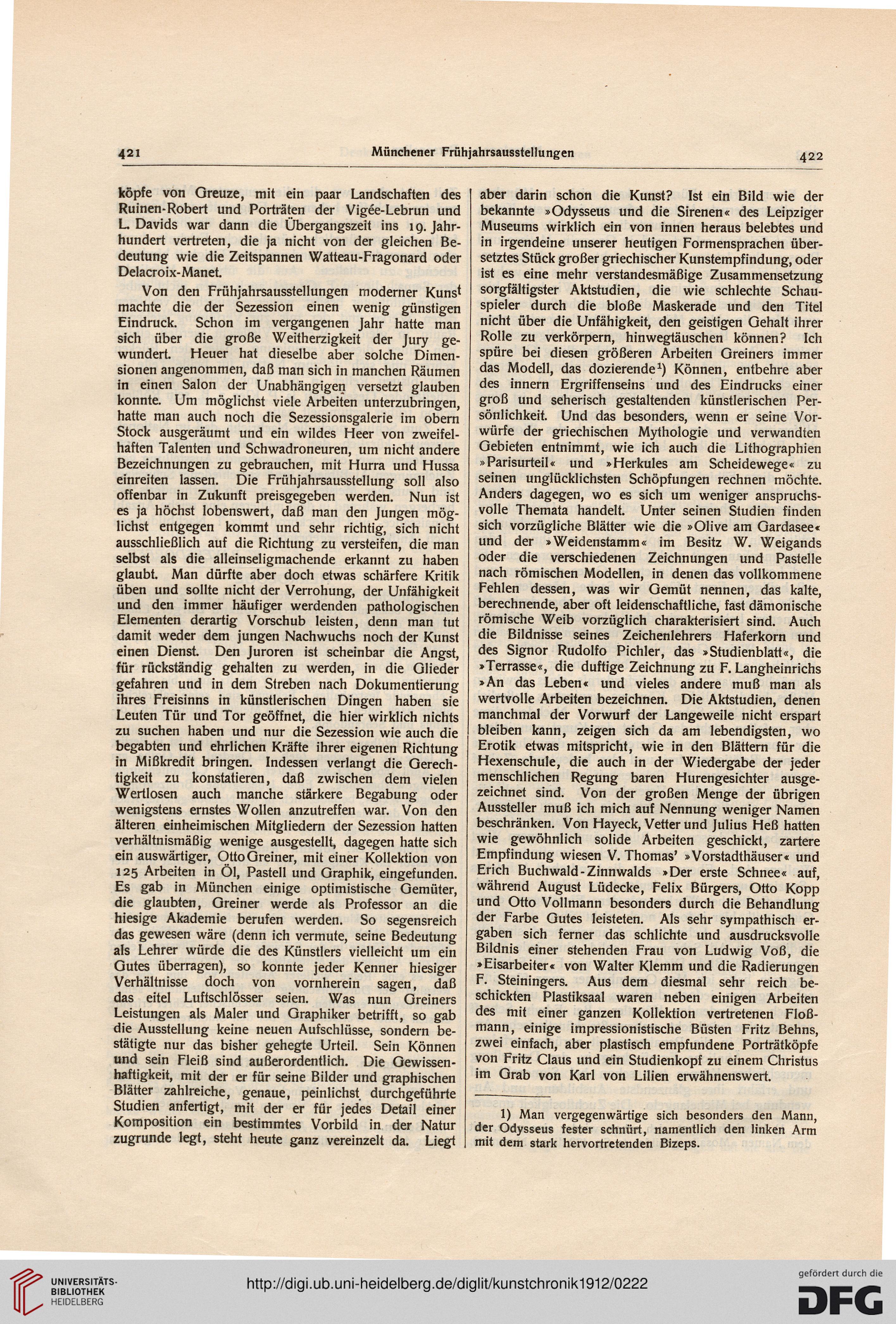421
Münchener Frühjahrsausstellungen
422
köpfe von Greuze, mit ein paar Landschaften des
Ruinen-Robert und Porträten der Vigee-Lebrun und
L. Davids war dann die Übergangszeit ins 19. Jahr-
hundert vertreten, die ja nicht von der gleichen Be-
deutung wie die Zeitspannen Watteau-Fragonard oder
Delacroix-Manet.
Von den Frühjahrsausstellungen moderner Kuns*
machte die der Sezession einen wenig günstigen
Eindruck. Schon im vergangenen Jahr hatte man
sich über die große Weitherzigkeit der Jury ge-
wundert. Heuer hat dieselbe aber solche Dimen-
sionen angenommen, daß man sich in manchen Räumen
in einen Salon der Unabhängigen versetzt glauben
konnte. Um möglichst viele Arbeiten unterzubringen,
hatte man auch noch die Sezessionsgalerie im obern
Stock ausgeräumt und ein wildes Heer von zweifel-
haften Talenten und Schwadroneuren, um nicht andere
Bezeichnungen zu gebrauchen, mit Hurra und Hussa
einreiten lassen. Die Frühjahrsausstellung soll also
offenbar in Zukunft preisgegeben werden. Nun ist
es ja höchst lobenswert, daß man den Jungen mög-
lichst entgegen kommt und sehr richtig, sich nicht
ausschließlich auf die Richtung zu versteifen, die man
selbst als die alleinseligmachende erkannt zu haben
glaubt. Man dürfte aber doch etwas schärfere Kritik
üben und sollte nicht der Verrohung, der Unfähigkeit
und den immer häufiger werdenden pathologischen
Elementen derartig Vorschub leisten, denn man tut
damit weder dem jungen Nachwuchs noch der Kunst
einen Dienst. Den Juroren ist scheinbar die Angst,
für rückständig gehalten zu werden, in die Glieder
gefahren und in dem Streben nach Dokumentierung
ihres Freisinns in künstlerischen Dingen haben sie
Leuten Tür und Tor geöffnet, die hier wirklich nichts
zu suchen haben und nur die Sezession wie auch die
begabten und ehrlichen Kräfte ihrer eigenen Richtung
in Mißkredit bringen. Indessen verlangt die Gerech-
tigkeit zu konstatieren, daß zwischen dem vielen
Wertlosen auch manche stärkere Begabung oder
wenigstens ernstes Wollen anzutreffen war. Von den
älteren einheimischen Mitgliedern der Sezession hatten
verhältnismäßig wenige ausgestellt, dagegen hatte sich
ein auswärtiger, Otto Greiner, mit einer Kollektion von
125 Arbeiten in Öl, Pastell und Graphik, eingefunden.
Es gab in München einige optimistische Gemüter,
die glaubten, Greiner werde als Professor an die
hiesige Akademie berufen werden. So segensreich
das gewesen wäre (denn ich vermute, seine Bedeutung
als Lehrer würde die des Künstlers vielleicht um ein
Gutes überragen), so konnte jeder Kenner hiesiger
Verhältnisse doch von vornherein sagen, daß
das eitel Luftschlösser seien. Was nun Greiners
Leistungen als Maler und Graphiker betrifft, so gab
die Ausstellung keine neuen Aufschlüsse, sondern be-
stätigte nur das bisher gehegte Urteil. Sein Können
und sein Fleiß sind außerordentlich. Die Gewissen-
haftigkeit, mit der er für seine Bilder und graphischen
Blätter zahlreiche, genaue, peinlichst durchgeführte
Studien anfertigt, mit der er für jedes Detail einer
Komposition ein bestimmtes Vorbild in der Natur
zugrunde legt, steht heute ganz vereinzelt da. Liegt
aber darin schon die Kunst? Ist ein Bild wie der
bekannte »Odysseus und die Sirenen« des Leipziger
Museums wirklich ein von innen heraus belebtes und
in irgendeine unserer heutigen Formensprachen über-
setztes Stück großer griechischer Kunstempfindung, oder
ist es eine mehr verstandesmäßige Zusammensetzung
sorgfältigster Aktstudien, die wie schlechte Schau-
spieler durch die bloße Maskerade und den Titel
nicht über die Unfähigkeit, den geistigen Gehalt ihrer
Rolle zu verkörpern, hinwegtäuschen können? Ich
spüre bei diesen größeren Arbeiten Greiners immer
das Modell, das dozierende1) Können, entbehre aber
des innern Ergriffenseins und des Eindrucks einer
groß und seherisch gestaltenden künstlerischen Per-
sönlichkeit. Und das besonders, wenn er seine Vor-
würfe der griechischen Mythologie und verwandten
Gebieten entnimmt, wie ich auch die Lithographien
»Parisurteil« und »Herkules am Scheidewege« zu
seinen unglücklichsten Schöpfungen rechnen möchte.
Anders dagegen, wo es sich um weniger anspruchs-
volle Themata handelt. Unter seinen Studien finden
sich vorzügliche Blätter wie die »Olive am Gardasee«
und der »Weidenstamm« im Besitz W. Weigands
oder die verschiedenen Zeichnungen und Pastelle
nach römischen Modellen, in denen das vollkommene
Fehlen dessen, was wir Gemüt nennen, das kalte,
berechnende, aber oft leidenschaftliche, fast dämonische
römische Weib vorzüglich charakterisiert sind. Auch
die Bildnisse seines Zeichenlehrers Haferkorn und
des Signor Rudolfo Pichler, das »Studienblatt«, die
»Terrasse«, die duftige Zeichnung zu F. Langheinrichs
»An das Leben« und vieles andere muß man als
wertvolle Arbeiten bezeichnen. Die Aktstudien, denen
manchmal der Vorwurf der Langeweile nicht erspart
bleiben kann, zeigen sich da am lebendigsten, wo
Erotik etwas mitspricht, wie in den Blättern für die
Hexenschule, die auch in der Wiedergabe der jeder
menschlichen Regung baren Hurengesichter ausge-
zeichnet sind. Von der großen Menge der übrigen
Aussteller muß ich mich auf Nennung weniger Namen
beschränken. Von Hayeck, Vetter und Julius Heß hatten
wie gewöhnlich solide Arbeiten geschickt, zartere
Empfindung wiesen V. Thomas' »Vorstadthäuser« und
Erich Buchwald - Zinnwalds »Der erste Schnee« auf,
während August Lüdecke, Felix Bürgers, Otto Kopp
und Otto Vollmann besonders durch die Behandlung
der Farbe Gutes leisteten. Als sehr sympathisch er-
gaben sich ferner das schlichte und ausdrucksvolle
Bildnis einer stehenden Frau von Ludwig Voß, die
»Eisarbeiter« von Walter Klemm und die Radierungen
F. Steiningers. Aus dem diesmal sehr reich be-
schickten Plastiksaal waren neben einigen Arbeiten
des mit einer ganzen Kollektion vertretenen Floß-
mann, einige impressionistische Büsten Fritz Behns,
zwei einfach, aber plastisch empfundene Porträtköpfe
von Fritz Claus und ein Studienkopf zu einem Christus
im Grab von Karl von Lilien erwähnenswert.
1) Man vergegenwärtige sich besonders den Mann,
der Odysseus fester schnürt, namentlich den linken Arm
mit dem stark hervortretenden Bizeps.
Münchener Frühjahrsausstellungen
422
köpfe von Greuze, mit ein paar Landschaften des
Ruinen-Robert und Porträten der Vigee-Lebrun und
L. Davids war dann die Übergangszeit ins 19. Jahr-
hundert vertreten, die ja nicht von der gleichen Be-
deutung wie die Zeitspannen Watteau-Fragonard oder
Delacroix-Manet.
Von den Frühjahrsausstellungen moderner Kuns*
machte die der Sezession einen wenig günstigen
Eindruck. Schon im vergangenen Jahr hatte man
sich über die große Weitherzigkeit der Jury ge-
wundert. Heuer hat dieselbe aber solche Dimen-
sionen angenommen, daß man sich in manchen Räumen
in einen Salon der Unabhängigen versetzt glauben
konnte. Um möglichst viele Arbeiten unterzubringen,
hatte man auch noch die Sezessionsgalerie im obern
Stock ausgeräumt und ein wildes Heer von zweifel-
haften Talenten und Schwadroneuren, um nicht andere
Bezeichnungen zu gebrauchen, mit Hurra und Hussa
einreiten lassen. Die Frühjahrsausstellung soll also
offenbar in Zukunft preisgegeben werden. Nun ist
es ja höchst lobenswert, daß man den Jungen mög-
lichst entgegen kommt und sehr richtig, sich nicht
ausschließlich auf die Richtung zu versteifen, die man
selbst als die alleinseligmachende erkannt zu haben
glaubt. Man dürfte aber doch etwas schärfere Kritik
üben und sollte nicht der Verrohung, der Unfähigkeit
und den immer häufiger werdenden pathologischen
Elementen derartig Vorschub leisten, denn man tut
damit weder dem jungen Nachwuchs noch der Kunst
einen Dienst. Den Juroren ist scheinbar die Angst,
für rückständig gehalten zu werden, in die Glieder
gefahren und in dem Streben nach Dokumentierung
ihres Freisinns in künstlerischen Dingen haben sie
Leuten Tür und Tor geöffnet, die hier wirklich nichts
zu suchen haben und nur die Sezession wie auch die
begabten und ehrlichen Kräfte ihrer eigenen Richtung
in Mißkredit bringen. Indessen verlangt die Gerech-
tigkeit zu konstatieren, daß zwischen dem vielen
Wertlosen auch manche stärkere Begabung oder
wenigstens ernstes Wollen anzutreffen war. Von den
älteren einheimischen Mitgliedern der Sezession hatten
verhältnismäßig wenige ausgestellt, dagegen hatte sich
ein auswärtiger, Otto Greiner, mit einer Kollektion von
125 Arbeiten in Öl, Pastell und Graphik, eingefunden.
Es gab in München einige optimistische Gemüter,
die glaubten, Greiner werde als Professor an die
hiesige Akademie berufen werden. So segensreich
das gewesen wäre (denn ich vermute, seine Bedeutung
als Lehrer würde die des Künstlers vielleicht um ein
Gutes überragen), so konnte jeder Kenner hiesiger
Verhältnisse doch von vornherein sagen, daß
das eitel Luftschlösser seien. Was nun Greiners
Leistungen als Maler und Graphiker betrifft, so gab
die Ausstellung keine neuen Aufschlüsse, sondern be-
stätigte nur das bisher gehegte Urteil. Sein Können
und sein Fleiß sind außerordentlich. Die Gewissen-
haftigkeit, mit der er für seine Bilder und graphischen
Blätter zahlreiche, genaue, peinlichst durchgeführte
Studien anfertigt, mit der er für jedes Detail einer
Komposition ein bestimmtes Vorbild in der Natur
zugrunde legt, steht heute ganz vereinzelt da. Liegt
aber darin schon die Kunst? Ist ein Bild wie der
bekannte »Odysseus und die Sirenen« des Leipziger
Museums wirklich ein von innen heraus belebtes und
in irgendeine unserer heutigen Formensprachen über-
setztes Stück großer griechischer Kunstempfindung, oder
ist es eine mehr verstandesmäßige Zusammensetzung
sorgfältigster Aktstudien, die wie schlechte Schau-
spieler durch die bloße Maskerade und den Titel
nicht über die Unfähigkeit, den geistigen Gehalt ihrer
Rolle zu verkörpern, hinwegtäuschen können? Ich
spüre bei diesen größeren Arbeiten Greiners immer
das Modell, das dozierende1) Können, entbehre aber
des innern Ergriffenseins und des Eindrucks einer
groß und seherisch gestaltenden künstlerischen Per-
sönlichkeit. Und das besonders, wenn er seine Vor-
würfe der griechischen Mythologie und verwandten
Gebieten entnimmt, wie ich auch die Lithographien
»Parisurteil« und »Herkules am Scheidewege« zu
seinen unglücklichsten Schöpfungen rechnen möchte.
Anders dagegen, wo es sich um weniger anspruchs-
volle Themata handelt. Unter seinen Studien finden
sich vorzügliche Blätter wie die »Olive am Gardasee«
und der »Weidenstamm« im Besitz W. Weigands
oder die verschiedenen Zeichnungen und Pastelle
nach römischen Modellen, in denen das vollkommene
Fehlen dessen, was wir Gemüt nennen, das kalte,
berechnende, aber oft leidenschaftliche, fast dämonische
römische Weib vorzüglich charakterisiert sind. Auch
die Bildnisse seines Zeichenlehrers Haferkorn und
des Signor Rudolfo Pichler, das »Studienblatt«, die
»Terrasse«, die duftige Zeichnung zu F. Langheinrichs
»An das Leben« und vieles andere muß man als
wertvolle Arbeiten bezeichnen. Die Aktstudien, denen
manchmal der Vorwurf der Langeweile nicht erspart
bleiben kann, zeigen sich da am lebendigsten, wo
Erotik etwas mitspricht, wie in den Blättern für die
Hexenschule, die auch in der Wiedergabe der jeder
menschlichen Regung baren Hurengesichter ausge-
zeichnet sind. Von der großen Menge der übrigen
Aussteller muß ich mich auf Nennung weniger Namen
beschränken. Von Hayeck, Vetter und Julius Heß hatten
wie gewöhnlich solide Arbeiten geschickt, zartere
Empfindung wiesen V. Thomas' »Vorstadthäuser« und
Erich Buchwald - Zinnwalds »Der erste Schnee« auf,
während August Lüdecke, Felix Bürgers, Otto Kopp
und Otto Vollmann besonders durch die Behandlung
der Farbe Gutes leisteten. Als sehr sympathisch er-
gaben sich ferner das schlichte und ausdrucksvolle
Bildnis einer stehenden Frau von Ludwig Voß, die
»Eisarbeiter« von Walter Klemm und die Radierungen
F. Steiningers. Aus dem diesmal sehr reich be-
schickten Plastiksaal waren neben einigen Arbeiten
des mit einer ganzen Kollektion vertretenen Floß-
mann, einige impressionistische Büsten Fritz Behns,
zwei einfach, aber plastisch empfundene Porträtköpfe
von Fritz Claus und ein Studienkopf zu einem Christus
im Grab von Karl von Lilien erwähnenswert.
1) Man vergegenwärtige sich besonders den Mann,
der Odysseus fester schnürt, namentlich den linken Arm
mit dem stark hervortretenden Bizeps.