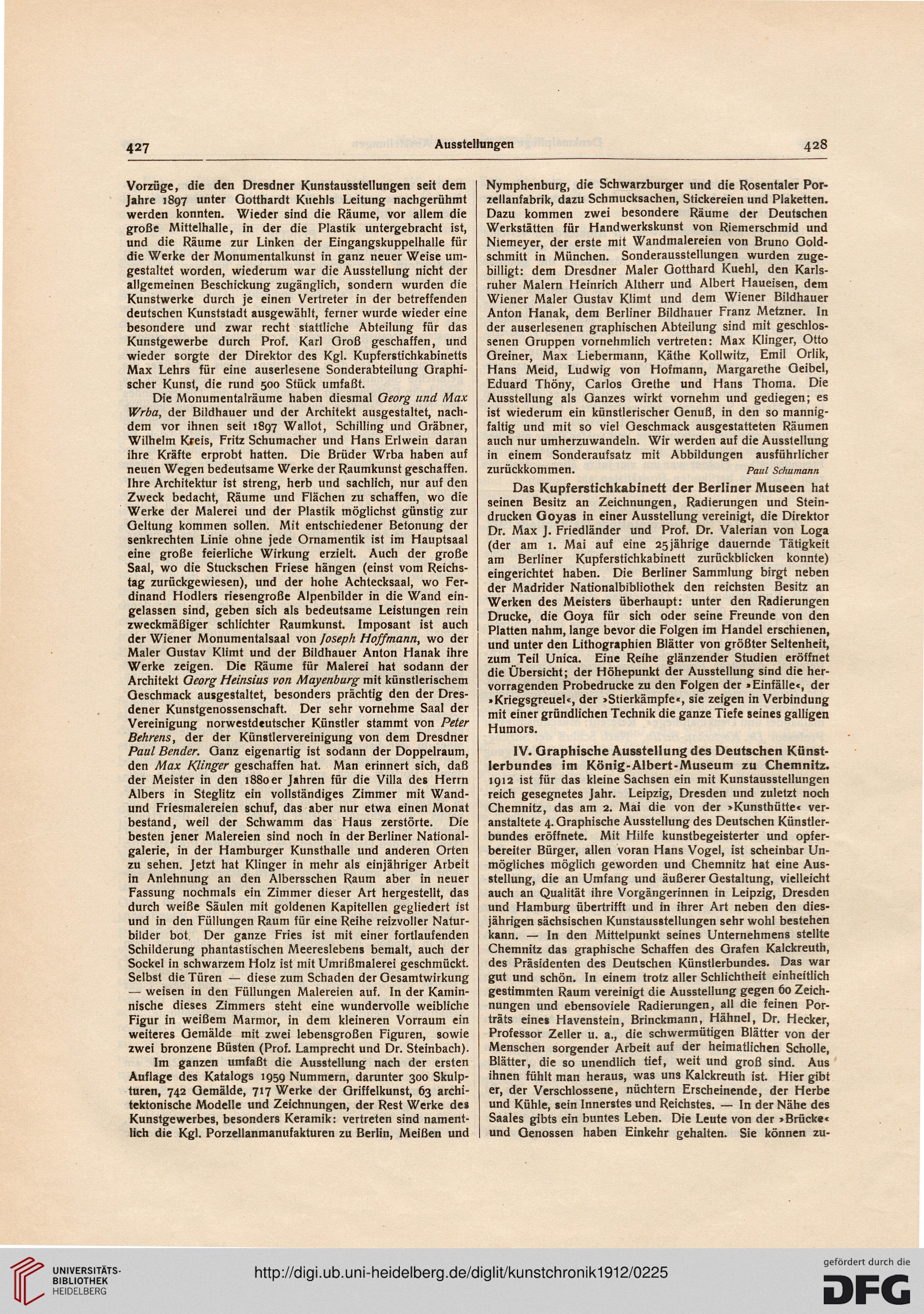427
Aussiellungen
428
Vorzüge, die den Dresdner Kunstausstellungen seit dem
Jahre 1897 unter Ootthardt Kuehls Leitung nachgerühmt
werden konnten. Wieder sind die Räume, vor allem die
große Mittelhalle, in der die Plastik untergebracht ist,
und die Räume zur Linken der Eingangskuppelhalle für
die Werke der Monumentalkunst in ganz neuer Weise um-
gestaltet worden, wiederum war die Ausstellung nicht der
allgemeinen Beschickung zugänglich, sondern wurden die
Kunstwerke durch je einen Vertreter in der betreffenden
deutschen Kunststadt ausgewählt, ferner wurde wieder eine
besondere und zwar recht stattliche Abteilung für das
Kunstgewerbe durch Prof. Karl Groß geschaffen, und
wieder sorgte der Direktor des Kgl. Kupferstichkabinetts
Max Lehrs für eine auserlesene Sonderabteilung Graphi-
scher Kunst, die rund 500 Stück umfaßt.
Die Monumentalräume haben diesmal Georg und Max
Wrba, der Bildhauer und der Architekt ausgestaltet, nach-
dem vor ihnen seit 1897 Wallot, Schilling und Gräbner,
Wilhelm Kreis, Fritz Schumacher und Hans Erlwein daran
ihre Kräfte erprobt hatten. Die Brüder Wrba haben auf
neuen Wegen bedeutsame Werke der Raumkunst geschaffen.
Ihre Architektur ist streng, herb und sachlich, nur auf den
Zweck bedacht, Räume und Flächen zu schaffen, wo die
Werke der Malerei und der Plastik möglichst günstig zur
Geltung kommen sollen. Mit entschiedener Betonung der
senkrechten Linie ohne jede Ornamentik ist im Hauptsaal
eine große feierliche Wirkung erzielt. Auch der große
Saal, wo die Stuckschen Friese hängen (einst vom Reichs-
tag zurückgewiesen), und der hohe Achtecksaal, wo Fer-
dinand Hodlers riesengroße Alpenbilder in die Wand ein-
gelassen sind, geben sich als bedeutsame Leistungen rein
zweckmäßiger schlichter Raumkunst. Imposant ist auch
der Wiener Monumentalsaal von Joseph Hoffmann, wo der
Maler Gustav Klimt und der Bildhauer Anton Hanak ihre
Werke zeigen. Die Räume für Malerei hat sodann der
Architekt Oeorg Heinsius von Mayenburg mit künstlerischem
Geschmack ausgestaltet, besonders prächtig den der Dres-
dener Kunstgenossenschaft. Der sehr vornehme Saal der
Vereinigung norwestdeutscher Künstler stammt von Peter
Behrens, der der Künstlervereinigung von dem Dresdner
Paul Bender. Ganz eigenartig ist sodann der Doppelraum,
den Max Klinger geschaffen hat. Man erinnert sich, daß
der Meister in den 1880 er Jahren für die Villa des Herrn
Albers in Steglitz ein vollständiges Zimmer mit Wand-
und Friesmalereien schuf, das aber nur etwa einen Monat
bestand, weil der Schwamm das Haus zerstörte. Die
besten jener Malereien sind noch in der Berliner National-
galerie, in der Hamburger Kunsthalle und anderen Orten
zu sehen. Jetzt hat Klinger in mehr als einjähriger Arbeit
in Anlehnung an den Albersschen Raum aber in neuer
Fassung nochmals ein Zimmer dieser Art hergestellt, das
durch weiße Säulen mit goldenen Kapitellen gegliedert ist
und in den Füllungen Raum für eine Reihe reizvoller Natur-
bilder bot Der ganze Fries ist mit einer fortlaufenden
Schilderung phantastischen Meereslebens bemalt, auch der
Sockel in schwarzem Holz ist mit Umrißmalerei geschmückt.
Selbst die Türen — diese zum Schaden der Gesamtwirkung
— weisen in den Füllungen Malereien auf. In der Kamin-
nische dieses Zimmers steht eine wundervolle weibliche
Figur in weißem Marmor, in dem kleineren Vorraum ein
weiteres Gemälde mit zwei lebensgroßen Figuren, sowie
zwei bronzene Büsten (Prof. Lamprecht und Dr. Steinbach).
Im ganzen umfaßt die Ausstellung nach der ersten
Auflage des Katalogs 1959 Nummern, darunter 300 Skulp-
turen, 742 Gemälde, 717 Werke der Griffelkunst, 63 archi-
tektonische Modelle und Zeichnungen, der Rest Werke des
Kunstgewerbes, besonders Keramik: vertreten sind nament-
lich die Kgl. Porzellanmanufakturen zu Berlin, Meißen und
Nymphenburg, die Schwarzburger und die Rosentaler Por-
zellanfabrik, dazu Schmucksachen, Stickereien und Plaketten.
Dazu kommen zwei besondere Räume der Deutschen
Werkstätten für Handwerkskunst von Riemerschmid und
Niemeyer, der erste mit Wandmalereien von Bruno Gold-
schmilt in München. Sonderausstellungen wurden zuge-
billigt: dem Dresdner Maler Gotthard Kuehl, den Karls-
ruher Malern Heinrich Altherr und Albert Haueisen, dem
Wiener Maler Gustav Klimt und dem Wiener Bildhauer
Anton Hanak, dem Berliner Bildhauer Franz Metzner. In
der auserlesenen graphischen Abteilung sind mit geschlos-
senen Gruppen vornehmlich vertreten: Max Klinger, Otto
Greiner, Max Liebermann, Käthe Kollwitz, Emil Orlik,
Hans Meid, Ludwig von Hofmann, Margarethe Geibel,
Eduard Thöny, Carlos Grethe und Hans Thoma. Die
Ausstellung als Ganzes wirkt vornehm und gediegen; es
ist wiederum ein künstlerischer Genuß, in den so mannig-
faltig und mit so viel Geschmack ausgestatteten Räumen
auch nur umherzuwandeln. Wir werden auf die Ausstellung
in einem Sonderaufsatz mit Abbildungen ausführlicher
zurückkommen. Paul Schumann
Das Kupferstichkabinett der Berliner Museen hat
seinen Besitz an Zeichnungen, Radierungen und Stein-
drucken Goyas in einer Ausstellung vereinigt, die Direktor
Dr. Max J. Friedländer und Prof. Dr. Valerian von Loga
(der am 1. Mai auf eine 25 jährige dauernde Tätigkeit
am Berliner Kupferstichkabinett zurückblicken konnte)
eingerichtet haben. Die Berliner Sammlung birgt neben
der Madrider Nationalbibliothek den reichsten Besitz an
Werken des Meisters überhaupt: unter den Radierungen
Drucke, die Goya für sich oder seine Freunde von den
Platten nahm, lange bevor die Folgen im Handel erschienen,
und unter den Lithographien Blätter von größter Seltenheit,
zum Teil Unica. Eine Reihe glänzender Studien eröffnet
die Übersicht; der Höhepunkt der Ausstellung sind die her-
vorragenden Probedrucke zu den Folgen der »Einfälle«, der
»Kriegsgreuel«, der »Stierkämpfe«, sie zeigen in Verbindung
mit einer gründlichen Technik die ganze Tiefe seines galligen
Humors.
IV. Graphische Ausstellung des Deutschen Künst-
lerbundes im König-Albert-Museum zu Chemnitz.
1912 ist für das kleine Sachsen ein mit Kunstausstellungen
reich gesegnetes Jahr. Leipzig, Dresden und zuletzt noch
Chemnitz, das am 2. Mai die von der »Kunsthütte« ver-
anstaltete 4. Graphische Ausstellung des Deutschen Künstler-
bundes eröffnete. Mit Hilfe kunstbegeisterter und opfer-
bereiter Bürger, allen voran Hans Vogel, ist scheinbar Un-
mögliches möglich geworden und Chemnitz hat eine Aus-
stellung, die an Umfang und äußerer Gestaltung, vielleicht
auch an Qualität ihre Vorgängerinnen in Leipzig, Dresden
und Hamburg übertrifft und in ihrer Art neben den dies-
jährigen sächsischen Kunstausstellungen sehr wohl bestehen
kann. — In den Mittelpunkt seines Unternehmens stellte
Chemnitz das graphische Schaffen des Grafen Kalckreuth,
des Präsidenten des Deutschen Künstlerbundes. Das war
gut und schön. In einem trotz aller Schlichtheit einheitlich
gestimmten Raum vereinigt die Ausstellung gegen 60 Zeich-
nungen und ebensoviele Radierungen, all die feinen Por-
träts eines Havenstein, Brinckmann, Hähnel, Dr. Hecker,
Professor Zeller u. a., die schwermütigen Blätter von der
Menschen sorgender Arbeit auf der heimatlichen Scholle,
Blätter, die so unendlich tief, weit und groß sind. Aus
ihnen fühlt man heraus, was uns Kalckreuth ist. Hier gibt
er, der Verschlossene, nüchtern Erscheinende, der Herbe
und Kühle, sein Innerstes und Reichstes. — In der Nähe des
Saales gibts ein buntes Leben. Die Leute von der »Brücke«
I und Genossen haben Einkehr gehalten. Sie können zu-
Aussiellungen
428
Vorzüge, die den Dresdner Kunstausstellungen seit dem
Jahre 1897 unter Ootthardt Kuehls Leitung nachgerühmt
werden konnten. Wieder sind die Räume, vor allem die
große Mittelhalle, in der die Plastik untergebracht ist,
und die Räume zur Linken der Eingangskuppelhalle für
die Werke der Monumentalkunst in ganz neuer Weise um-
gestaltet worden, wiederum war die Ausstellung nicht der
allgemeinen Beschickung zugänglich, sondern wurden die
Kunstwerke durch je einen Vertreter in der betreffenden
deutschen Kunststadt ausgewählt, ferner wurde wieder eine
besondere und zwar recht stattliche Abteilung für das
Kunstgewerbe durch Prof. Karl Groß geschaffen, und
wieder sorgte der Direktor des Kgl. Kupferstichkabinetts
Max Lehrs für eine auserlesene Sonderabteilung Graphi-
scher Kunst, die rund 500 Stück umfaßt.
Die Monumentalräume haben diesmal Georg und Max
Wrba, der Bildhauer und der Architekt ausgestaltet, nach-
dem vor ihnen seit 1897 Wallot, Schilling und Gräbner,
Wilhelm Kreis, Fritz Schumacher und Hans Erlwein daran
ihre Kräfte erprobt hatten. Die Brüder Wrba haben auf
neuen Wegen bedeutsame Werke der Raumkunst geschaffen.
Ihre Architektur ist streng, herb und sachlich, nur auf den
Zweck bedacht, Räume und Flächen zu schaffen, wo die
Werke der Malerei und der Plastik möglichst günstig zur
Geltung kommen sollen. Mit entschiedener Betonung der
senkrechten Linie ohne jede Ornamentik ist im Hauptsaal
eine große feierliche Wirkung erzielt. Auch der große
Saal, wo die Stuckschen Friese hängen (einst vom Reichs-
tag zurückgewiesen), und der hohe Achtecksaal, wo Fer-
dinand Hodlers riesengroße Alpenbilder in die Wand ein-
gelassen sind, geben sich als bedeutsame Leistungen rein
zweckmäßiger schlichter Raumkunst. Imposant ist auch
der Wiener Monumentalsaal von Joseph Hoffmann, wo der
Maler Gustav Klimt und der Bildhauer Anton Hanak ihre
Werke zeigen. Die Räume für Malerei hat sodann der
Architekt Oeorg Heinsius von Mayenburg mit künstlerischem
Geschmack ausgestaltet, besonders prächtig den der Dres-
dener Kunstgenossenschaft. Der sehr vornehme Saal der
Vereinigung norwestdeutscher Künstler stammt von Peter
Behrens, der der Künstlervereinigung von dem Dresdner
Paul Bender. Ganz eigenartig ist sodann der Doppelraum,
den Max Klinger geschaffen hat. Man erinnert sich, daß
der Meister in den 1880 er Jahren für die Villa des Herrn
Albers in Steglitz ein vollständiges Zimmer mit Wand-
und Friesmalereien schuf, das aber nur etwa einen Monat
bestand, weil der Schwamm das Haus zerstörte. Die
besten jener Malereien sind noch in der Berliner National-
galerie, in der Hamburger Kunsthalle und anderen Orten
zu sehen. Jetzt hat Klinger in mehr als einjähriger Arbeit
in Anlehnung an den Albersschen Raum aber in neuer
Fassung nochmals ein Zimmer dieser Art hergestellt, das
durch weiße Säulen mit goldenen Kapitellen gegliedert ist
und in den Füllungen Raum für eine Reihe reizvoller Natur-
bilder bot Der ganze Fries ist mit einer fortlaufenden
Schilderung phantastischen Meereslebens bemalt, auch der
Sockel in schwarzem Holz ist mit Umrißmalerei geschmückt.
Selbst die Türen — diese zum Schaden der Gesamtwirkung
— weisen in den Füllungen Malereien auf. In der Kamin-
nische dieses Zimmers steht eine wundervolle weibliche
Figur in weißem Marmor, in dem kleineren Vorraum ein
weiteres Gemälde mit zwei lebensgroßen Figuren, sowie
zwei bronzene Büsten (Prof. Lamprecht und Dr. Steinbach).
Im ganzen umfaßt die Ausstellung nach der ersten
Auflage des Katalogs 1959 Nummern, darunter 300 Skulp-
turen, 742 Gemälde, 717 Werke der Griffelkunst, 63 archi-
tektonische Modelle und Zeichnungen, der Rest Werke des
Kunstgewerbes, besonders Keramik: vertreten sind nament-
lich die Kgl. Porzellanmanufakturen zu Berlin, Meißen und
Nymphenburg, die Schwarzburger und die Rosentaler Por-
zellanfabrik, dazu Schmucksachen, Stickereien und Plaketten.
Dazu kommen zwei besondere Räume der Deutschen
Werkstätten für Handwerkskunst von Riemerschmid und
Niemeyer, der erste mit Wandmalereien von Bruno Gold-
schmilt in München. Sonderausstellungen wurden zuge-
billigt: dem Dresdner Maler Gotthard Kuehl, den Karls-
ruher Malern Heinrich Altherr und Albert Haueisen, dem
Wiener Maler Gustav Klimt und dem Wiener Bildhauer
Anton Hanak, dem Berliner Bildhauer Franz Metzner. In
der auserlesenen graphischen Abteilung sind mit geschlos-
senen Gruppen vornehmlich vertreten: Max Klinger, Otto
Greiner, Max Liebermann, Käthe Kollwitz, Emil Orlik,
Hans Meid, Ludwig von Hofmann, Margarethe Geibel,
Eduard Thöny, Carlos Grethe und Hans Thoma. Die
Ausstellung als Ganzes wirkt vornehm und gediegen; es
ist wiederum ein künstlerischer Genuß, in den so mannig-
faltig und mit so viel Geschmack ausgestatteten Räumen
auch nur umherzuwandeln. Wir werden auf die Ausstellung
in einem Sonderaufsatz mit Abbildungen ausführlicher
zurückkommen. Paul Schumann
Das Kupferstichkabinett der Berliner Museen hat
seinen Besitz an Zeichnungen, Radierungen und Stein-
drucken Goyas in einer Ausstellung vereinigt, die Direktor
Dr. Max J. Friedländer und Prof. Dr. Valerian von Loga
(der am 1. Mai auf eine 25 jährige dauernde Tätigkeit
am Berliner Kupferstichkabinett zurückblicken konnte)
eingerichtet haben. Die Berliner Sammlung birgt neben
der Madrider Nationalbibliothek den reichsten Besitz an
Werken des Meisters überhaupt: unter den Radierungen
Drucke, die Goya für sich oder seine Freunde von den
Platten nahm, lange bevor die Folgen im Handel erschienen,
und unter den Lithographien Blätter von größter Seltenheit,
zum Teil Unica. Eine Reihe glänzender Studien eröffnet
die Übersicht; der Höhepunkt der Ausstellung sind die her-
vorragenden Probedrucke zu den Folgen der »Einfälle«, der
»Kriegsgreuel«, der »Stierkämpfe«, sie zeigen in Verbindung
mit einer gründlichen Technik die ganze Tiefe seines galligen
Humors.
IV. Graphische Ausstellung des Deutschen Künst-
lerbundes im König-Albert-Museum zu Chemnitz.
1912 ist für das kleine Sachsen ein mit Kunstausstellungen
reich gesegnetes Jahr. Leipzig, Dresden und zuletzt noch
Chemnitz, das am 2. Mai die von der »Kunsthütte« ver-
anstaltete 4. Graphische Ausstellung des Deutschen Künstler-
bundes eröffnete. Mit Hilfe kunstbegeisterter und opfer-
bereiter Bürger, allen voran Hans Vogel, ist scheinbar Un-
mögliches möglich geworden und Chemnitz hat eine Aus-
stellung, die an Umfang und äußerer Gestaltung, vielleicht
auch an Qualität ihre Vorgängerinnen in Leipzig, Dresden
und Hamburg übertrifft und in ihrer Art neben den dies-
jährigen sächsischen Kunstausstellungen sehr wohl bestehen
kann. — In den Mittelpunkt seines Unternehmens stellte
Chemnitz das graphische Schaffen des Grafen Kalckreuth,
des Präsidenten des Deutschen Künstlerbundes. Das war
gut und schön. In einem trotz aller Schlichtheit einheitlich
gestimmten Raum vereinigt die Ausstellung gegen 60 Zeich-
nungen und ebensoviele Radierungen, all die feinen Por-
träts eines Havenstein, Brinckmann, Hähnel, Dr. Hecker,
Professor Zeller u. a., die schwermütigen Blätter von der
Menschen sorgender Arbeit auf der heimatlichen Scholle,
Blätter, die so unendlich tief, weit und groß sind. Aus
ihnen fühlt man heraus, was uns Kalckreuth ist. Hier gibt
er, der Verschlossene, nüchtern Erscheinende, der Herbe
und Kühle, sein Innerstes und Reichstes. — In der Nähe des
Saales gibts ein buntes Leben. Die Leute von der »Brücke«
I und Genossen haben Einkehr gehalten. Sie können zu-