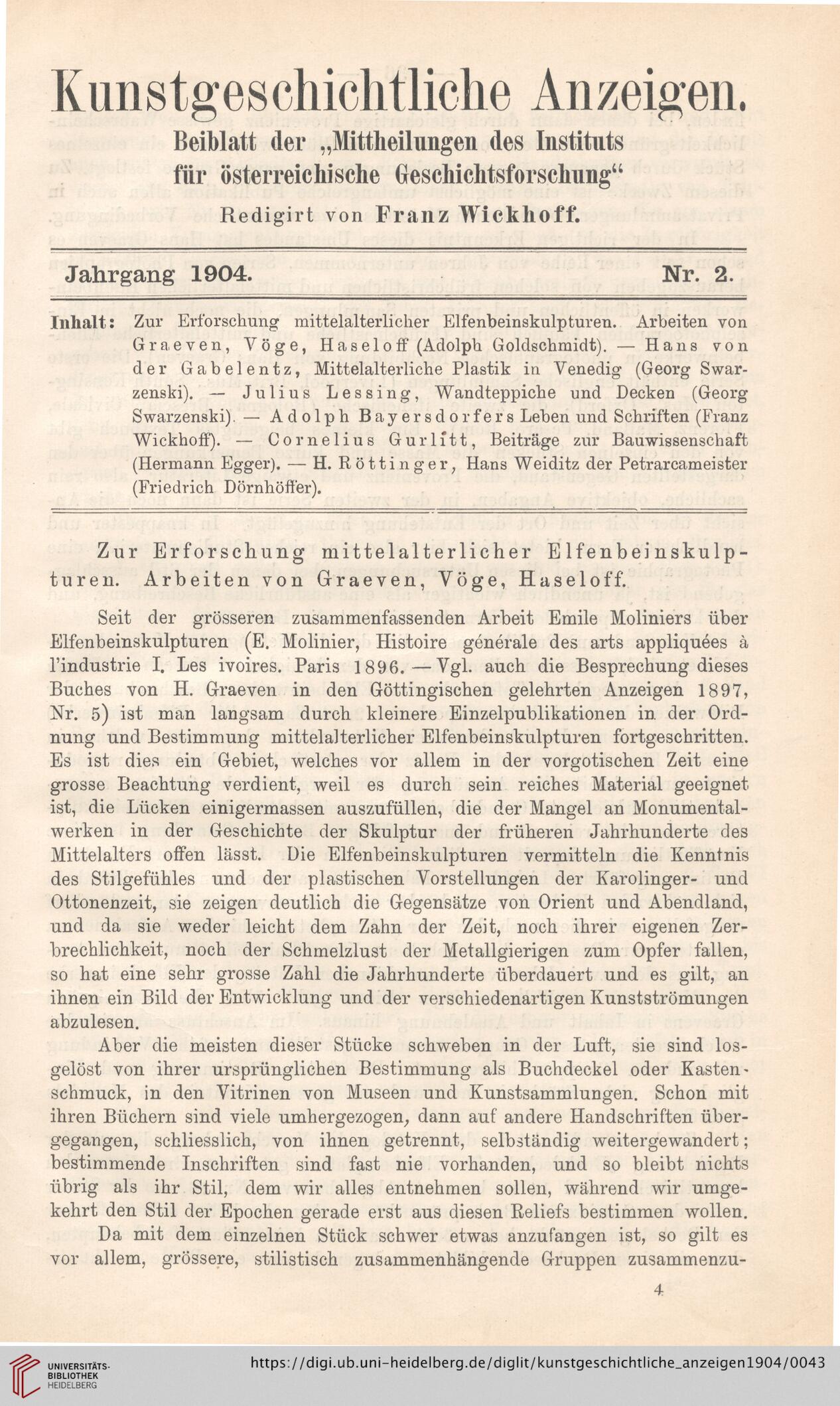Kunstgeschichtliche Anzeigen.
Beiblatt der „Mittheilungen des Instituts
für österreichische Geschichtsforschung“
Redigirt von Franz Wickhoff.
Jahrgang 1904. Nr. 2.
Inhalt: Zur Erforschung mittelalterlicher Elfenbeinskulpturen. Arbeiten von
Graeven, Vöge, Haseloff (Adolph Goldschmidt). — Hans von
der Gabelentz, Mittelalterliche Plastik in Venedig (Georg Swar-
zenski). — Julius Lessing, Wandteppiche und Decken (Georg
Swarzenski). — Adolph Bayersdor fers Leben und Schriften (Franz
Wickhoff). — Cornelius Gur litt, Beiträge zur Bauwissenschaft
(Hermann Egger). — H. Röttinger, Hans Weiditz der Petrarcameister
(Friedrich Dörnhöffer).
Zur Erforschung mittelalterlicher Elfenbeinskulp-
turen. Arbeiten von Graeven, Vöge, Haseloff.
Seit der grösseren zusammenfassenden Arbeit Emile Moliniers über
Elfenbeinskulpturen (E. Molinier, Histoire generale des arts appliquees ä
l’industrie I. Les ivoires. Paris 1896.—Vgl. auch die Besprechung dieses
Buches von H. Graeven in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1897,
Nr. 5) ist man langsam durch kleinere Einzelpublikationen in. der Ord-
nung und Bestimmung mittelalterlicher Elfenbeinskulpturen fortgeschritten.
Es ist dies ein Gebiet, welches vor allem in der vorgotischen Zeit eine
grosse Beachtung verdient, weil es durch sein reiches Material geeignet
ist, die Lücken einigermassen auszufüllen, die der Mangel an Monumental-
werken in der Geschichte der Skulptur der früheren Jahrhunderte des
Mittelalters offen lässt. Die Elfenbeinskulpturen vermitteln die Kenntnis
des Stilgefühles und der plastischen Vorstellungen der Karolinger- und
Ottonenzeit, sie zeigen deutlich die Gegensätze von Orient und Abendland,
und da sie weder leicht dem Zahn der Zeit, noch ihrer eigenen Zer-
brechlichkeit, noch der Schmelzlust der Metallgierigen zum Opfer fallen,
so hat eine sehr grosse Zahl die Jahrhunderte überdauert und es gilt, an
ihnen ein Bild der Entwicklung und der verschiedenartigen Kunstströmungen
abzulesen.
Aber die meisten dieser Stücke schweben in der Luft, sie sind los-
gelöst von ihrer ursprünglichen Bestimmung als Buchdeckel oder Kasten-
schmuck, in den Vitrinen von Museen und Kunstsammlungen. Schon mit
ihren Büchern sind viele umhergezogen, dann auf andere Handschriften über-
gegangen, schliesslich, von ihnen getrennt, selbständig weitergewandert;
bestimmende Inschriften sind fast nie vorhanden, und so bleibt nichts
übrig als ihr Stil, dem wir alles entnehmen sollen, während wir umge-
kehrt den Stil der Epochen gerade erst aus diesen Reliefs bestimmen wollen.
Da mit dem einzelnen Stück schwer etwas anzufangen ist, so gilt es
vor allem, grössere, stilistisch zusammenhängende Gruppen zusammenzu-
4
Beiblatt der „Mittheilungen des Instituts
für österreichische Geschichtsforschung“
Redigirt von Franz Wickhoff.
Jahrgang 1904. Nr. 2.
Inhalt: Zur Erforschung mittelalterlicher Elfenbeinskulpturen. Arbeiten von
Graeven, Vöge, Haseloff (Adolph Goldschmidt). — Hans von
der Gabelentz, Mittelalterliche Plastik in Venedig (Georg Swar-
zenski). — Julius Lessing, Wandteppiche und Decken (Georg
Swarzenski). — Adolph Bayersdor fers Leben und Schriften (Franz
Wickhoff). — Cornelius Gur litt, Beiträge zur Bauwissenschaft
(Hermann Egger). — H. Röttinger, Hans Weiditz der Petrarcameister
(Friedrich Dörnhöffer).
Zur Erforschung mittelalterlicher Elfenbeinskulp-
turen. Arbeiten von Graeven, Vöge, Haseloff.
Seit der grösseren zusammenfassenden Arbeit Emile Moliniers über
Elfenbeinskulpturen (E. Molinier, Histoire generale des arts appliquees ä
l’industrie I. Les ivoires. Paris 1896.—Vgl. auch die Besprechung dieses
Buches von H. Graeven in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1897,
Nr. 5) ist man langsam durch kleinere Einzelpublikationen in. der Ord-
nung und Bestimmung mittelalterlicher Elfenbeinskulpturen fortgeschritten.
Es ist dies ein Gebiet, welches vor allem in der vorgotischen Zeit eine
grosse Beachtung verdient, weil es durch sein reiches Material geeignet
ist, die Lücken einigermassen auszufüllen, die der Mangel an Monumental-
werken in der Geschichte der Skulptur der früheren Jahrhunderte des
Mittelalters offen lässt. Die Elfenbeinskulpturen vermitteln die Kenntnis
des Stilgefühles und der plastischen Vorstellungen der Karolinger- und
Ottonenzeit, sie zeigen deutlich die Gegensätze von Orient und Abendland,
und da sie weder leicht dem Zahn der Zeit, noch ihrer eigenen Zer-
brechlichkeit, noch der Schmelzlust der Metallgierigen zum Opfer fallen,
so hat eine sehr grosse Zahl die Jahrhunderte überdauert und es gilt, an
ihnen ein Bild der Entwicklung und der verschiedenartigen Kunstströmungen
abzulesen.
Aber die meisten dieser Stücke schweben in der Luft, sie sind los-
gelöst von ihrer ursprünglichen Bestimmung als Buchdeckel oder Kasten-
schmuck, in den Vitrinen von Museen und Kunstsammlungen. Schon mit
ihren Büchern sind viele umhergezogen, dann auf andere Handschriften über-
gegangen, schliesslich, von ihnen getrennt, selbständig weitergewandert;
bestimmende Inschriften sind fast nie vorhanden, und so bleibt nichts
übrig als ihr Stil, dem wir alles entnehmen sollen, während wir umge-
kehrt den Stil der Epochen gerade erst aus diesen Reliefs bestimmen wollen.
Da mit dem einzelnen Stück schwer etwas anzufangen ist, so gilt es
vor allem, grössere, stilistisch zusammenhängende Gruppen zusammenzu-
4