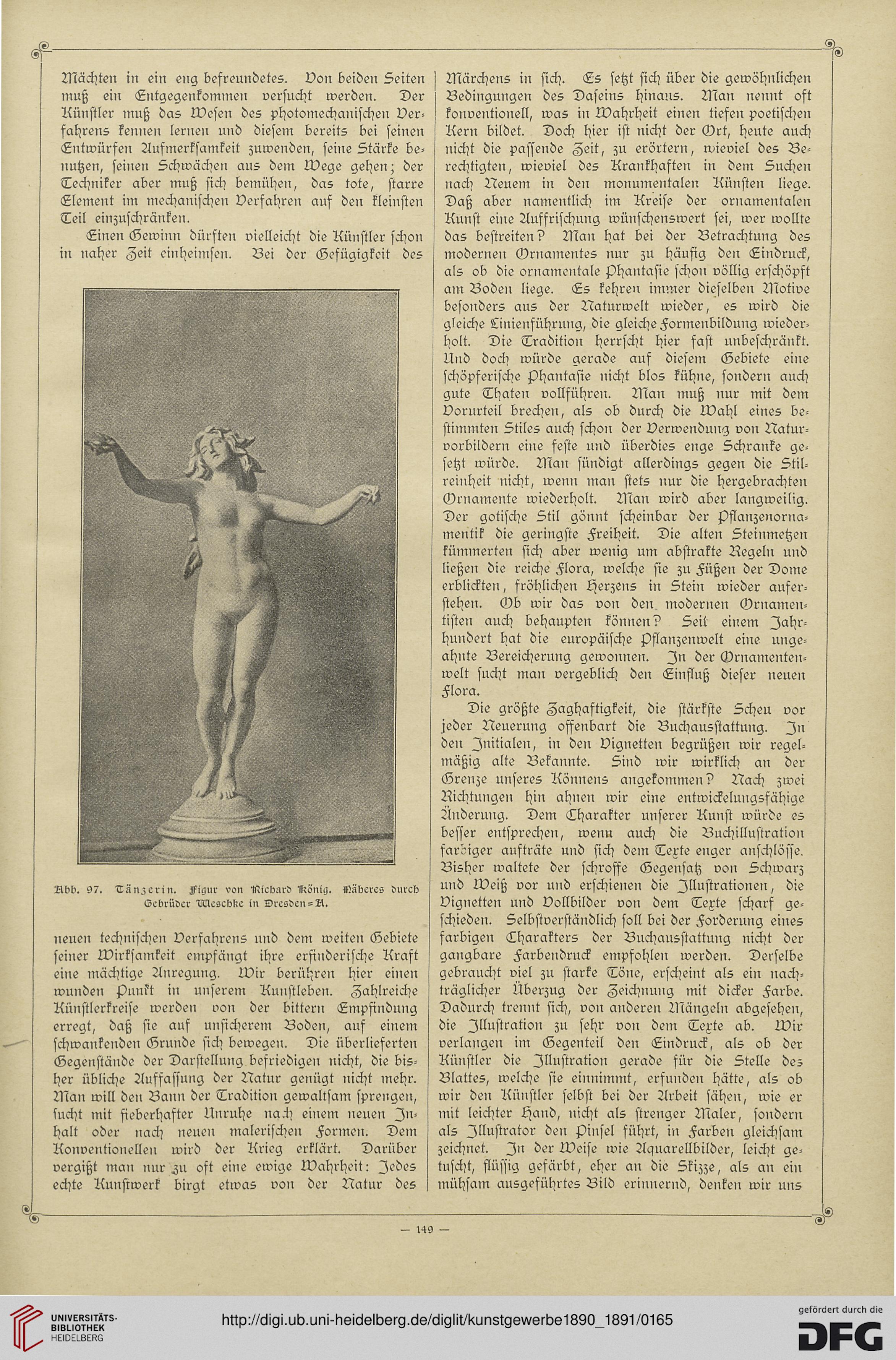Mächten in ein eng befrsundetes. von beiden Seiten
muß ein Lntgegenkommen versucht werden. Der
Rünstler muß das Mesen des photomechanischen Ver-
fahrens kennen lernen und diesem bereits bci seinen
Lntwürfen Aufmerksamkeit zuwenden, seine Stärke be-
nutzen, seinen Schwächen aus dem kVege gehen; der
Techniker aber muß sich bemühen, das tote, starre
Element im mechanischen Verfahren auf den kleinsten
Teil einzuschränken.
Tinen Gewinn dürften vielleicht die Rünstler schon
in naher Zeit cinheimsen. Bei der Gefügigkcit des
7-
Nbb. S7. HÄnzcri». zfigul' vo» Ikicburd IKZnig. «Iribcrcs diN'cb
Gcbrüdcr riAcscblic in Drcsdc»-N.
neuen technischen Verfahrens und dem weiten Gebiete
seiner lVirksamkeit cmpfängt ihre erfinderische Rraft
eine mächtige Anregung. lvir berühren hier einen
wunden punkt in unserem Runstleben. Zahlreiche
Rünstlerkreise werden von der bittern Lmpfindung
erregt, daß sie auf unsicherem Boden, auf einem
schwankenden Grunde sich bewegen. Die überlieferten
Gegenstände der Darstellung befriedigen nicht, die bis-
her übliche Auffassung der Natur genügt nicht mehr.
Nan will den Bann der Tradition gewaltsam sprengen,
iucht mit fieberhafter Unruhe nach einem neuen Zn-
halt oder nach neuen malerischen Forme». Dem
Ronoentionellen wird der Rrieg erklärt. Darüber
vergißt man nur ^u oft eine ewige kvahrheit: Zedes
echte Runsiwerk birgt etwas von der Natur des
Märchens in sich. Ls setzt sich über die gewöhnlichen
Bedingungen des Daseins hinans. Nkan nennt oft
konventionell, was in lVahrheit einen tiefen poetischen
Rern bildet. Doch hier ist nicht der Grt, heute auch
nicht die passende Zeit, zu erörtern, wieviel des Be-
rechtigten, wieoiel des Rrankhaften in dem Buchen
nach Neuem in den monumentalen Rünsten liege.
Daß aber namentlich im Rreise der ornamentalen
Runst eine Auffrischung wünschenswert sei, wer wollte
das bestreiten? Man hat bei der Betrachtung des
modernen Grnamentes nur zu häufig den Lindruck,
als ob die ornamcntale phantasie schon vollig erschöpft
am Äoden liege. Ls kehren immer dieselben B'kotive
besonders aus der Naturwelt wieder, es wird die
gleiche Linienführung, dis gleiche Formenbildung wieder-
holt. Die Tradition herrscht hier fast unbeschränkt.
Und doch würde gerade auf diesem Gebiete eine
schöpferische s)hantasie nicht blos kühne, sondern auch
gute Thaten vollführen. Nkan muß nur mit dem
Vorurteil brechen, als ob durch die lVahl eines be-
stimmten Btiles auch schon der verwendung von Natur-
vorbildern eine feste und überdies enge Schranke ge-
setzt würde. Ukan sündigt allerdings gegen die Btil-
reinheit nicht, wenn man stets nur dis hergebrachten
Grnamente wiederholt. Nkan wird aber langweilig.
Der gotische Btil gönnt scheinbar der pflanzenorna-
mentik die geringste Freiheit. Die alten Steinmetzen
kümmerten sich aber wenig um abstrakte Regeln und
ließen die reiche Llora, welche sie zu Mßen der Dome
erblickten, fröhlichen Lserzens in Stein wieder aufer-
stehen. Gb wir das von den modernen Vrnamen-
tisten auch behaupten können? Beit einem Zahr-
hundert hat die europäische pflanzenwelt eine unge-
ahnte Bereicherung gewonnen. Zn der Grnamenten-
welt sncht man vergeblich den Linfluß dieser neuen
Flora.
Die größte Zaghaftigkeit, die stärkste Scheu vor
jeder Neuerung offenbart die Buchausstattung. Zn
den Znitialen, in den vignetten begrüßen wir rcgel-
mäßig alte Bekannte. Bind wir wirklich an der
Grenze unseres Rönnens angekommen? Nach zwei
Nichtungen hin ahnen wir eine entwickelungsfähige
Änderung. Dem Lharakter unsercr Runst würde es
besser entsprechen, wenn auch die Buchillustration
sarbiger aufträte und sich dem Texte enger anschlösse.
Bisher waltete der schroffe Gegensatz von Bchwarz
und bveiß vor und erschienen dis Zllustrationen, die
vignetten und vollbilder von dem Texte scharf ge-
schieden. Selbstverständlich soll bei der Forderung eines
farbigen Tharakters der Buchausstattung nicht der
gangbare Farbendruck empfohlen werden. Derselbe
gebraucht viel zu starke Töne, erscheint als ein nach-
träglicher Überzug der Zeichnung mit dicker Farbe.
Dadurch trennt sich, von anderen Rkängcln abgesehen,
die Zllustration zu sehr von dem Texts ab. kvir
verlangen im Gegenteil den Lindruck, als ob der
Rünstler die Zllustration gerade für die Btelle de;
Blattes, welche sie einnimmt, erfunden hätte, als ob
wir den Rünstler selbst bei der Arbeit sähen, wie er
mit leichter Lsand, nicht als strenger Maler, sondern
als Zllustrator den pinsel führt, in Farben gleichsam
zeichnet. Zn der kveise wie Aquarellbilder, leicht ge-
tuscht, flüssig gefärbt, eher an die Skizze, als an ein
mühsam ausgeführtes Bild erinnernd, denken wir uns
— I4S —
muß ein Lntgegenkommen versucht werden. Der
Rünstler muß das Mesen des photomechanischen Ver-
fahrens kennen lernen und diesem bereits bci seinen
Lntwürfen Aufmerksamkeit zuwenden, seine Stärke be-
nutzen, seinen Schwächen aus dem kVege gehen; der
Techniker aber muß sich bemühen, das tote, starre
Element im mechanischen Verfahren auf den kleinsten
Teil einzuschränken.
Tinen Gewinn dürften vielleicht die Rünstler schon
in naher Zeit cinheimsen. Bei der Gefügigkcit des
7-
Nbb. S7. HÄnzcri». zfigul' vo» Ikicburd IKZnig. «Iribcrcs diN'cb
Gcbrüdcr riAcscblic in Drcsdc»-N.
neuen technischen Verfahrens und dem weiten Gebiete
seiner lVirksamkeit cmpfängt ihre erfinderische Rraft
eine mächtige Anregung. lvir berühren hier einen
wunden punkt in unserem Runstleben. Zahlreiche
Rünstlerkreise werden von der bittern Lmpfindung
erregt, daß sie auf unsicherem Boden, auf einem
schwankenden Grunde sich bewegen. Die überlieferten
Gegenstände der Darstellung befriedigen nicht, die bis-
her übliche Auffassung der Natur genügt nicht mehr.
Nan will den Bann der Tradition gewaltsam sprengen,
iucht mit fieberhafter Unruhe nach einem neuen Zn-
halt oder nach neuen malerischen Forme». Dem
Ronoentionellen wird der Rrieg erklärt. Darüber
vergißt man nur ^u oft eine ewige kvahrheit: Zedes
echte Runsiwerk birgt etwas von der Natur des
Märchens in sich. Ls setzt sich über die gewöhnlichen
Bedingungen des Daseins hinans. Nkan nennt oft
konventionell, was in lVahrheit einen tiefen poetischen
Rern bildet. Doch hier ist nicht der Grt, heute auch
nicht die passende Zeit, zu erörtern, wieviel des Be-
rechtigten, wieoiel des Rrankhaften in dem Buchen
nach Neuem in den monumentalen Rünsten liege.
Daß aber namentlich im Rreise der ornamentalen
Runst eine Auffrischung wünschenswert sei, wer wollte
das bestreiten? Man hat bei der Betrachtung des
modernen Grnamentes nur zu häufig den Lindruck,
als ob die ornamcntale phantasie schon vollig erschöpft
am Äoden liege. Ls kehren immer dieselben B'kotive
besonders aus der Naturwelt wieder, es wird die
gleiche Linienführung, dis gleiche Formenbildung wieder-
holt. Die Tradition herrscht hier fast unbeschränkt.
Und doch würde gerade auf diesem Gebiete eine
schöpferische s)hantasie nicht blos kühne, sondern auch
gute Thaten vollführen. Nkan muß nur mit dem
Vorurteil brechen, als ob durch die lVahl eines be-
stimmten Btiles auch schon der verwendung von Natur-
vorbildern eine feste und überdies enge Schranke ge-
setzt würde. Ukan sündigt allerdings gegen die Btil-
reinheit nicht, wenn man stets nur dis hergebrachten
Grnamente wiederholt. Nkan wird aber langweilig.
Der gotische Btil gönnt scheinbar der pflanzenorna-
mentik die geringste Freiheit. Die alten Steinmetzen
kümmerten sich aber wenig um abstrakte Regeln und
ließen die reiche Llora, welche sie zu Mßen der Dome
erblickten, fröhlichen Lserzens in Stein wieder aufer-
stehen. Gb wir das von den modernen Vrnamen-
tisten auch behaupten können? Beit einem Zahr-
hundert hat die europäische pflanzenwelt eine unge-
ahnte Bereicherung gewonnen. Zn der Grnamenten-
welt sncht man vergeblich den Linfluß dieser neuen
Flora.
Die größte Zaghaftigkeit, die stärkste Scheu vor
jeder Neuerung offenbart die Buchausstattung. Zn
den Znitialen, in den vignetten begrüßen wir rcgel-
mäßig alte Bekannte. Bind wir wirklich an der
Grenze unseres Rönnens angekommen? Nach zwei
Nichtungen hin ahnen wir eine entwickelungsfähige
Änderung. Dem Lharakter unsercr Runst würde es
besser entsprechen, wenn auch die Buchillustration
sarbiger aufträte und sich dem Texte enger anschlösse.
Bisher waltete der schroffe Gegensatz von Bchwarz
und bveiß vor und erschienen dis Zllustrationen, die
vignetten und vollbilder von dem Texte scharf ge-
schieden. Selbstverständlich soll bei der Forderung eines
farbigen Tharakters der Buchausstattung nicht der
gangbare Farbendruck empfohlen werden. Derselbe
gebraucht viel zu starke Töne, erscheint als ein nach-
träglicher Überzug der Zeichnung mit dicker Farbe.
Dadurch trennt sich, von anderen Rkängcln abgesehen,
die Zllustration zu sehr von dem Texts ab. kvir
verlangen im Gegenteil den Lindruck, als ob der
Rünstler die Zllustration gerade für die Btelle de;
Blattes, welche sie einnimmt, erfunden hätte, als ob
wir den Rünstler selbst bei der Arbeit sähen, wie er
mit leichter Lsand, nicht als strenger Maler, sondern
als Zllustrator den pinsel führt, in Farben gleichsam
zeichnet. Zn der kveise wie Aquarellbilder, leicht ge-
tuscht, flüssig gefärbt, eher an die Skizze, als an ein
mühsam ausgeführtes Bild erinnernd, denken wir uns
— I4S —