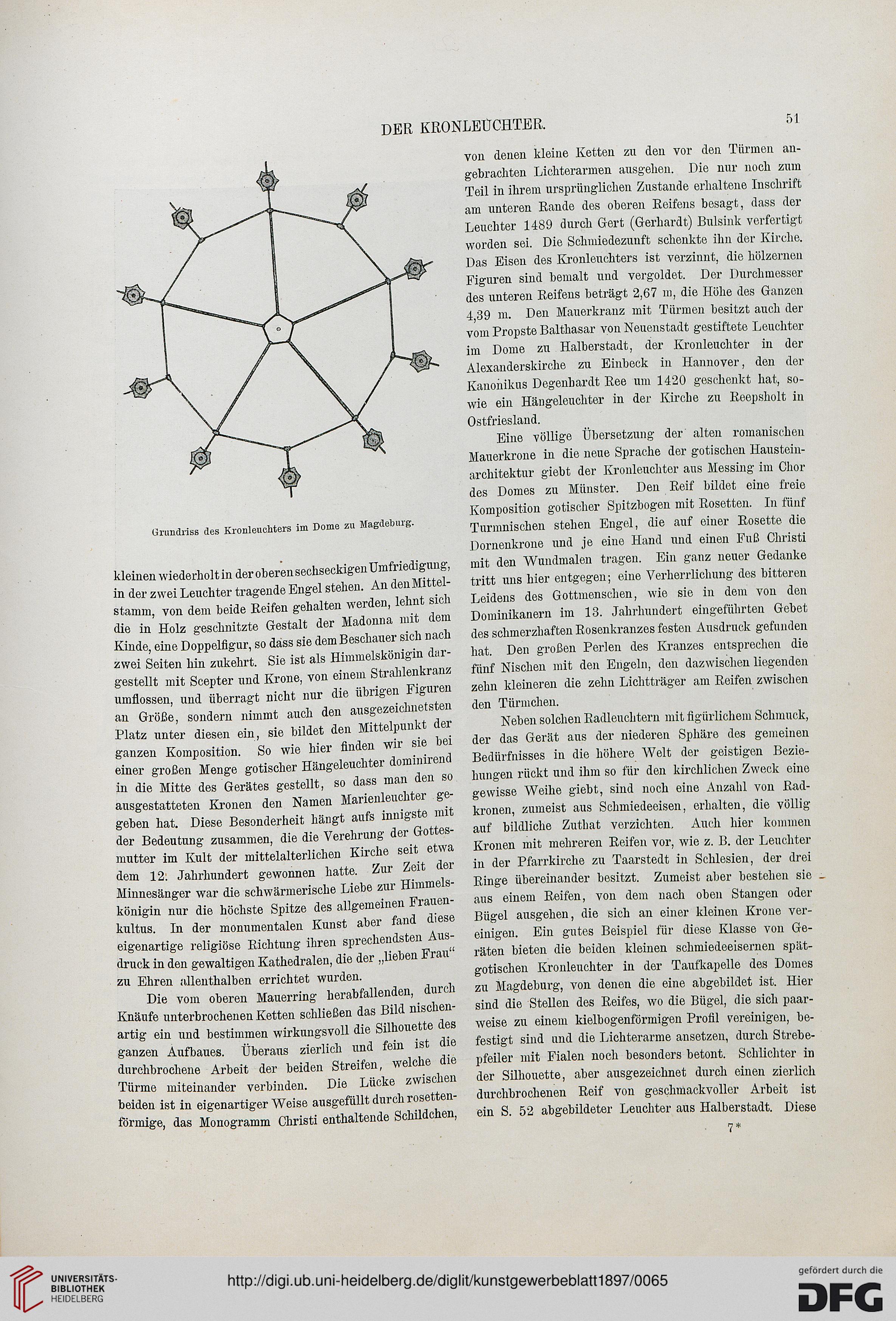DER KRONLEUCHTER.
51
Grundriss
des Kronleuchters im Dome zu Magdeburg.
kleinen wiederholtinderoberensechseckigeaUmfnedigung,
in der zwei Leuchter tragende Engel stehen. An den Mittel-
stamm, von dem beide Keifen gehalten werden, lehnt ich
die in Holz geschnitzte Gestalt der Madonna mit dem
Kinde, eine Doppelfigur, so dass sie dem Beschauer sich nach
zwei Seiten hin zukehrt. Sie ist als Himmelskonigin dar-
gestellt mit Scepter und Krone, von einem Strahlenkranz
umflossen, und überragt nicht nur die übrigen Figuren
an Größe, sondern nimmt auch den ausgezeichnetsten
Platz unter diesen ein, sie bildet den Mittelpunkt der
ganzen Komposition. So wie hier finden wir sie m
einer großen Menge gotischer Hängeleuchter domimrend
in die Mitte des Gerätes gestellt, so dass man den so
ausgestatteten Kronen den Namen Marienleuchter ge-
geben hat. Diese Besonderheit hängt aufs innigste mu
der Bedeutung zusammen, die die Verehrung der Gottes-
mutter im Kult der mittelalterlichen Kirche seit.etwa
dem 12. Jahrhundert gewonnen hatte. Zur Zei
Minnesänger war die schwärmerische Liebe zur Himmeis-
königin nur die höchste Spitze des allgemeinen Frauen-
kultus. In der monumentalen Kunst aber fand diese
eigenartige religiöse Richtung ihren sprechendsten Auf-
druck in den gewaltigen Kathedralen, die der „lieben .brau
zu Ehren allenthalben errichtet wurden.
Die vom oberen Mauerring herabfallenden, _ duren
Knäufe unterbrochenen Ketten schließen das Bild nischen-
artig ein und bestimmen wirkungsvoll die Silhouette des
ganzen Aufbaues. Überaus zierlich und fein ist e
durchbrochene Arbeit der beiden Streifen, welche die
Türme miteinander verbinden. Die Lücke zwischen
beiden ist in eigenartigerweise ausgefüllt durch rosetten-
förmige, das Monogramm Christi enthaltende Schildchen,
von denen kleine Ketten zu den vor den Türmen an-
gebrachten Lichterarmen ausgehen. Die nur noch zum
Teil in ihrem ursprünglichen Zustande erhaltene Inschrift
am unteren Rande dos oberen Reifens besagt, dass der
Leuchter 1489 durch Gort (Gerhardt) Bulsink verfertigt
worden sei. Die Schmiedezuuft schenkte ihn der Kirche.
Das Eisen des Kronleuchters ist verzinnt, die hölzernen
Figuren sind bemalt und vergoldet. Der Durchmesser
des unteren Reifens beträgt 2,67 m, die Höhe des Ganzen
4 39 m. Den Mauerkranz mit Türmen besitzt auch der
vom Propste Balthasar von Neuenstadt gestiftete Leuchter
im Dome zu Halberstadt, der Kronleuchter in der
Alexanderskirche zu Einbeck in Hannover, den der
Kanonikus Degenhardt Ree um 14.20 geschenkt hat, so-
wie ein Hängeleuchter in der Kirche zu Reepsholt in
Ostfriesland.
Eine völlige Übersetzung der alten romanischen
Mauerkrone in die neue Sprache der gotischen Haustein-
architektur giebt der Kronleuchter aus Messing im Chor
des Domes zu Münster. Den Reif bildet eine freie
Komposition gotischer Spitzbogen mit Rosetten. In fünf
Turmnischen stehen Engel, die auf einer Rosette die
Dornenkrone und je eine Hand und einen Fuß Christi
mit den Wundmalen tragen. Ein ganz neuer Gedanke
tritt uns hier entgegen; eine Verherrlichung des bitteren
Leidens des Gottmenschen, wie sie in dem von den
Dominikanern im 13. Jahrhundert eingeführten Gebet
des schmerzhaften Rosenkranzes festen Ausdruck gefunden
hat. Den großen Perlen des Kranzes entsprechen die
fünf Nischen mit den Engeln, den dazwischen liegenden
zehn kleineren die zehn Lichtträger am Reifen zwischen
den Türmchen.
Neben solchen Badleuchtern mit figürlichem Schmuck,
der das Gerät aus der niederen Sphäre des gemeinen
Bedürfnisses in die höhere Welt der geistigen Bezie-
hungen rückt und ihm so für den kirchlichen Zweck eine
gewisse Weihe giebt, sind noch eine Anzahl von Rad-
kronen, zumeist aus Schmiedeeisen, erhalten, die völlig
auf bildliche Zuthat verzichten. Auch hier kommen
Kronen mit mehreren Reifen vor, wie z. B. der Leuchter
in der Pfarrkirche zu Taarstedt in Schlesien, der drei
Ringe übereinander besitzt. Zumeist aber bestehen sie
aus einem Reifen, von dem nach oben Stangen oder
Bügel ausgehen, die sich an einer kleinen Krone ver-
einigen. Ein gutes Beispiel für diese Klasse von Ge-
räten bieten die beiden kleinen schmiedeeisernen spät-
gotischen Kronleuchter in der Taufkapelle des Domes
zu Magdeburg, von denen die eine abgebildet ist. Hier
sind die Stellen des Reifes, wo die Bügel, die sich paar-
weise zu einem kielbogenförmigen Profil vereinigen, be-
festigt sind und die Lichterarme ansetzen, durch Strebe-
pfeiler mit Fialen noch besonders betont. Schlichter in
der Silhouette, aber ausgezeichnet durch einen zierlich
durchbrochenen Reif von geschmackvoller Arbeit ist
ein S. 52 abgebildeter Leuchter aus Halberstadt. Diese
7 *
51
Grundriss
des Kronleuchters im Dome zu Magdeburg.
kleinen wiederholtinderoberensechseckigeaUmfnedigung,
in der zwei Leuchter tragende Engel stehen. An den Mittel-
stamm, von dem beide Keifen gehalten werden, lehnt ich
die in Holz geschnitzte Gestalt der Madonna mit dem
Kinde, eine Doppelfigur, so dass sie dem Beschauer sich nach
zwei Seiten hin zukehrt. Sie ist als Himmelskonigin dar-
gestellt mit Scepter und Krone, von einem Strahlenkranz
umflossen, und überragt nicht nur die übrigen Figuren
an Größe, sondern nimmt auch den ausgezeichnetsten
Platz unter diesen ein, sie bildet den Mittelpunkt der
ganzen Komposition. So wie hier finden wir sie m
einer großen Menge gotischer Hängeleuchter domimrend
in die Mitte des Gerätes gestellt, so dass man den so
ausgestatteten Kronen den Namen Marienleuchter ge-
geben hat. Diese Besonderheit hängt aufs innigste mu
der Bedeutung zusammen, die die Verehrung der Gottes-
mutter im Kult der mittelalterlichen Kirche seit.etwa
dem 12. Jahrhundert gewonnen hatte. Zur Zei
Minnesänger war die schwärmerische Liebe zur Himmeis-
königin nur die höchste Spitze des allgemeinen Frauen-
kultus. In der monumentalen Kunst aber fand diese
eigenartige religiöse Richtung ihren sprechendsten Auf-
druck in den gewaltigen Kathedralen, die der „lieben .brau
zu Ehren allenthalben errichtet wurden.
Die vom oberen Mauerring herabfallenden, _ duren
Knäufe unterbrochenen Ketten schließen das Bild nischen-
artig ein und bestimmen wirkungsvoll die Silhouette des
ganzen Aufbaues. Überaus zierlich und fein ist e
durchbrochene Arbeit der beiden Streifen, welche die
Türme miteinander verbinden. Die Lücke zwischen
beiden ist in eigenartigerweise ausgefüllt durch rosetten-
förmige, das Monogramm Christi enthaltende Schildchen,
von denen kleine Ketten zu den vor den Türmen an-
gebrachten Lichterarmen ausgehen. Die nur noch zum
Teil in ihrem ursprünglichen Zustande erhaltene Inschrift
am unteren Rande dos oberen Reifens besagt, dass der
Leuchter 1489 durch Gort (Gerhardt) Bulsink verfertigt
worden sei. Die Schmiedezuuft schenkte ihn der Kirche.
Das Eisen des Kronleuchters ist verzinnt, die hölzernen
Figuren sind bemalt und vergoldet. Der Durchmesser
des unteren Reifens beträgt 2,67 m, die Höhe des Ganzen
4 39 m. Den Mauerkranz mit Türmen besitzt auch der
vom Propste Balthasar von Neuenstadt gestiftete Leuchter
im Dome zu Halberstadt, der Kronleuchter in der
Alexanderskirche zu Einbeck in Hannover, den der
Kanonikus Degenhardt Ree um 14.20 geschenkt hat, so-
wie ein Hängeleuchter in der Kirche zu Reepsholt in
Ostfriesland.
Eine völlige Übersetzung der alten romanischen
Mauerkrone in die neue Sprache der gotischen Haustein-
architektur giebt der Kronleuchter aus Messing im Chor
des Domes zu Münster. Den Reif bildet eine freie
Komposition gotischer Spitzbogen mit Rosetten. In fünf
Turmnischen stehen Engel, die auf einer Rosette die
Dornenkrone und je eine Hand und einen Fuß Christi
mit den Wundmalen tragen. Ein ganz neuer Gedanke
tritt uns hier entgegen; eine Verherrlichung des bitteren
Leidens des Gottmenschen, wie sie in dem von den
Dominikanern im 13. Jahrhundert eingeführten Gebet
des schmerzhaften Rosenkranzes festen Ausdruck gefunden
hat. Den großen Perlen des Kranzes entsprechen die
fünf Nischen mit den Engeln, den dazwischen liegenden
zehn kleineren die zehn Lichtträger am Reifen zwischen
den Türmchen.
Neben solchen Badleuchtern mit figürlichem Schmuck,
der das Gerät aus der niederen Sphäre des gemeinen
Bedürfnisses in die höhere Welt der geistigen Bezie-
hungen rückt und ihm so für den kirchlichen Zweck eine
gewisse Weihe giebt, sind noch eine Anzahl von Rad-
kronen, zumeist aus Schmiedeeisen, erhalten, die völlig
auf bildliche Zuthat verzichten. Auch hier kommen
Kronen mit mehreren Reifen vor, wie z. B. der Leuchter
in der Pfarrkirche zu Taarstedt in Schlesien, der drei
Ringe übereinander besitzt. Zumeist aber bestehen sie
aus einem Reifen, von dem nach oben Stangen oder
Bügel ausgehen, die sich an einer kleinen Krone ver-
einigen. Ein gutes Beispiel für diese Klasse von Ge-
räten bieten die beiden kleinen schmiedeeisernen spät-
gotischen Kronleuchter in der Taufkapelle des Domes
zu Magdeburg, von denen die eine abgebildet ist. Hier
sind die Stellen des Reifes, wo die Bügel, die sich paar-
weise zu einem kielbogenförmigen Profil vereinigen, be-
festigt sind und die Lichterarme ansetzen, durch Strebe-
pfeiler mit Fialen noch besonders betont. Schlichter in
der Silhouette, aber ausgezeichnet durch einen zierlich
durchbrochenen Reif von geschmackvoller Arbeit ist
ein S. 52 abgebildeter Leuchter aus Halberstadt. Diese
7 *