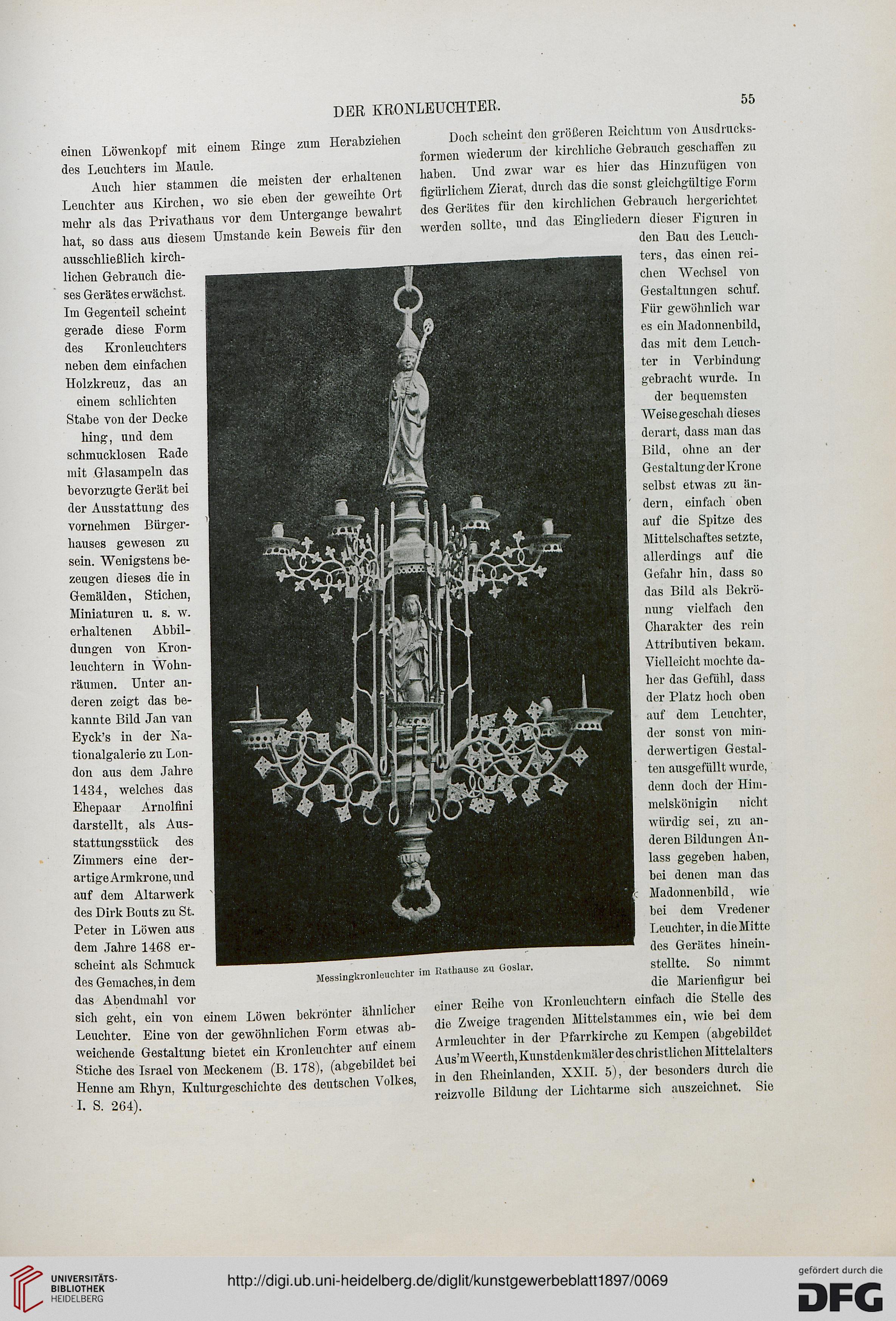DER KRONLEUCHTER.
55
einen Löwenkopf mit einem Ringe zum Herabziehen
des Leuchters im Maule.
Auch hier stammen die meisten der erhaltenen
Leuchter aus Kirchen, wo sie eben der geweihte Ort
mehr als das Privathaus vor dem Untergänge bewahrt
hat, so dass aus diesem Umstände kein Beweis für den
ausschließlich kirch-
lichen Gebrauch die-
ses Gerätes erwächst.
Im Gegenteil scheint
gerade diese Form
des Kronleuchters
neben dem einfachen
Holzkreuz, das an
einem schlichten
Stabe von der Decke
hing, und dem
schmucklosen Rade
mit Glasampeln das
bevorzugte Gerät bei
der Ausstattung des
vornehmen Bürger-
hauses gewesen zu
sein. Wenigstens be-
zeugen dieses die in
Gemälden, Stichen,
Miniaturen u. s. w.
erhaltenen Abbil-
dungen von Kron-
leuchtern in Wohn-
räumen. Unter an-
deren zeigt das be-
kannte Bild Jan van
Eyck's in der Na-
tionalgalerie zu Lon-
don aus dem Jahre
1434, welches das
Ehepaar Arnolflni
darstellt, als Aus-
stattungsstück des
Zimmers eine der-
artige Armkrone, und
auf dem Altarwerk
des Dirk Bouts zu St.
Peter in Löwen aus
dem Jahre 1468 er-
scheint als Schmuck
des Gemaches, in dem
das Abendmahl vor
sich geht, ein von einem Löwen bekrönter ähnlicher
Leuchter. Eine von der gewöhnlichen Form etwas ab-
weichende Gestaltung bietet ein Kronleuchter auf einem
Stiche des Israel von Meckenem (B. 178), (abgebildet bei
Henne am Rlryn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes,
I. S. 264).
Messingkronleucliter I
Doch scheint den größeren Reichtum von Ausdrucks-
formen wiederum der kirchliche Gebrauch geschaffen zu
haben. Und zwar war es hier das Hinzufügen von
figürlichem Zierat, durch das die sonst gleichgültige Form
des Gerätes für den kirchlichen Gebrauch hergerichtet
werden sollte, und das Eingliedern dieser Figuren in
den Bau des Leuch-
ters, das einen rei-
chen Wechsel von
Gestaltungen schuf.
Für gewöhnlich war
es ein Madonnenbild,
das mit dem Leuch-
ter in Verbindung
gebracht wurde. In
der bequemsten
Weise geschah dieses
derart, dass man das
Bild, ohne an der
Gestaltungder Krone
selbst etwas zu än-
dern, einfach oben
auf die Spitze des
Mittelschaftes setzte,
allerdings auf die
Gefahr hin, dass so
das Bild als Bekrö-
nung vielfach den
Charakter des rein
Attributiven bekam.
Vielleicht mochte da-
her das Gefühl, dass
der Platz hoch oben
auf dem Leuchter,
der sonst von min-
derwertigen Gestal-
ten ausgefüllt wurde,
denn doch der Him-
melskönigin nicht
würdig sei, zu an-
deren Bildungen An-
lass gegeben haben,
bei denen man das
Madonnenbild, wie
bei dem Vredener
Leuchter, in die Mitte
des Gerätes hinein-
stellte. So nimmt
die Marienfigur bei
einer Reihe von Kronleuchtern einfach die Stelle des
die Zweige tragenden Mittelstammes ein, wie bei dem
Armleuchter in der Pfarrkirche zu Kempen (abgebildet
Aus'mWeerth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters
in den Rheinlanden, XXII. 5), der besonders durch die
reizvolle Bildung der lichtarme sich auszeichnet. Sie
Ratbftuse zu Goslar.
55
einen Löwenkopf mit einem Ringe zum Herabziehen
des Leuchters im Maule.
Auch hier stammen die meisten der erhaltenen
Leuchter aus Kirchen, wo sie eben der geweihte Ort
mehr als das Privathaus vor dem Untergänge bewahrt
hat, so dass aus diesem Umstände kein Beweis für den
ausschließlich kirch-
lichen Gebrauch die-
ses Gerätes erwächst.
Im Gegenteil scheint
gerade diese Form
des Kronleuchters
neben dem einfachen
Holzkreuz, das an
einem schlichten
Stabe von der Decke
hing, und dem
schmucklosen Rade
mit Glasampeln das
bevorzugte Gerät bei
der Ausstattung des
vornehmen Bürger-
hauses gewesen zu
sein. Wenigstens be-
zeugen dieses die in
Gemälden, Stichen,
Miniaturen u. s. w.
erhaltenen Abbil-
dungen von Kron-
leuchtern in Wohn-
räumen. Unter an-
deren zeigt das be-
kannte Bild Jan van
Eyck's in der Na-
tionalgalerie zu Lon-
don aus dem Jahre
1434, welches das
Ehepaar Arnolflni
darstellt, als Aus-
stattungsstück des
Zimmers eine der-
artige Armkrone, und
auf dem Altarwerk
des Dirk Bouts zu St.
Peter in Löwen aus
dem Jahre 1468 er-
scheint als Schmuck
des Gemaches, in dem
das Abendmahl vor
sich geht, ein von einem Löwen bekrönter ähnlicher
Leuchter. Eine von der gewöhnlichen Form etwas ab-
weichende Gestaltung bietet ein Kronleuchter auf einem
Stiche des Israel von Meckenem (B. 178), (abgebildet bei
Henne am Rlryn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes,
I. S. 264).
Messingkronleucliter I
Doch scheint den größeren Reichtum von Ausdrucks-
formen wiederum der kirchliche Gebrauch geschaffen zu
haben. Und zwar war es hier das Hinzufügen von
figürlichem Zierat, durch das die sonst gleichgültige Form
des Gerätes für den kirchlichen Gebrauch hergerichtet
werden sollte, und das Eingliedern dieser Figuren in
den Bau des Leuch-
ters, das einen rei-
chen Wechsel von
Gestaltungen schuf.
Für gewöhnlich war
es ein Madonnenbild,
das mit dem Leuch-
ter in Verbindung
gebracht wurde. In
der bequemsten
Weise geschah dieses
derart, dass man das
Bild, ohne an der
Gestaltungder Krone
selbst etwas zu än-
dern, einfach oben
auf die Spitze des
Mittelschaftes setzte,
allerdings auf die
Gefahr hin, dass so
das Bild als Bekrö-
nung vielfach den
Charakter des rein
Attributiven bekam.
Vielleicht mochte da-
her das Gefühl, dass
der Platz hoch oben
auf dem Leuchter,
der sonst von min-
derwertigen Gestal-
ten ausgefüllt wurde,
denn doch der Him-
melskönigin nicht
würdig sei, zu an-
deren Bildungen An-
lass gegeben haben,
bei denen man das
Madonnenbild, wie
bei dem Vredener
Leuchter, in die Mitte
des Gerätes hinein-
stellte. So nimmt
die Marienfigur bei
einer Reihe von Kronleuchtern einfach die Stelle des
die Zweige tragenden Mittelstammes ein, wie bei dem
Armleuchter in der Pfarrkirche zu Kempen (abgebildet
Aus'mWeerth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters
in den Rheinlanden, XXII. 5), der besonders durch die
reizvolle Bildung der lichtarme sich auszeichnet. Sie
Ratbftuse zu Goslar.