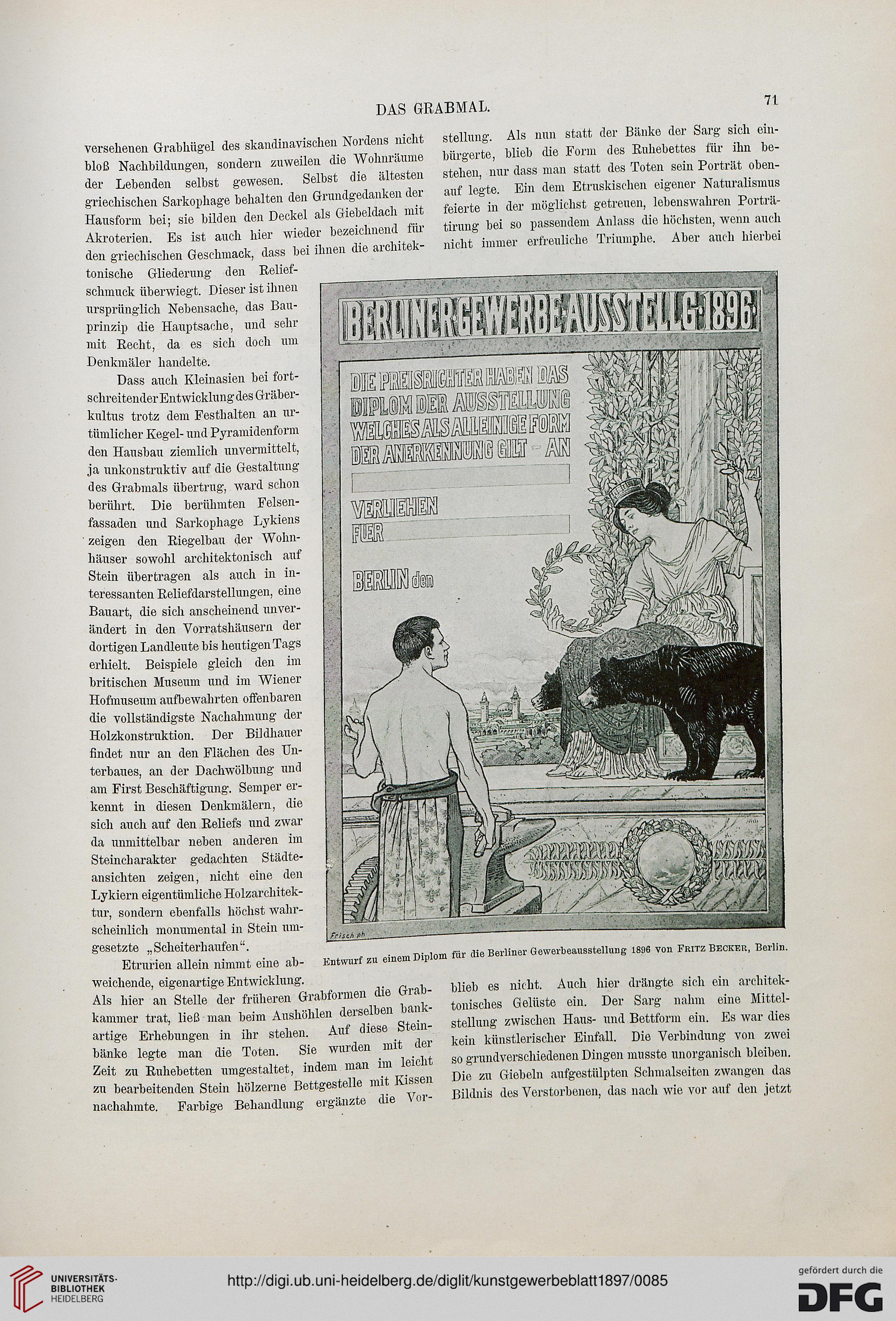DAS GRABMAL.
7t
versehenen Grabhügel des skandinavischen Nordens nicht
bloß Nachbildungen, sondern zuweilen die Wohnräume
der Lebenden selbst gewesen. Selbst die ältesten
griechischen Sarkophage behalten den Grundgedanken der
Hausform bei; sie bilden den Deckel als Giebeldach mit
Akroterien. Es ist auch hier wieder bezeichnend lin-
den griechischen Geschmack, dass bei ihnen die architek-
tonische Gliederung den Relief-
schmuck überwiegt. Dieser ist ihnen
ursprünglich Nebensache, das Bau-
prinzip die Hauptsache, und sehr
mit Recht, da es sich doch um
Denkmäler handelte.
Dass auch Kleinasien bei fort-
schreitender Entwicklung des Gräber-
kultus trotz dem Festhalten an ur-
tümlicher Kegel- und Pyramidenform
den Hausbau ziemlich unvermittelt,
ja unkonstruktiv auf die Gestaltung
des Grabmals übertrug, ward schon
berührt. Die berühmten Felsen-
fassaden und Sarkophage Lykiens
zeigen den Riegelbau der Wohn-
häuser sowohl architektonisch auf
Stein übertragen als auch in in-
teressanten Eeliefdarstellungen, eine
Bauart, die sich anscheinend unver-
ändert in den Vorratshäusern der
dortigen Landleute bis heutigen Tags
erhielt. Beispiele gleich den im
britischen Museum und im Wiener
Hofmuseum aufbewahrten offenbaren
die vollständigste Nachahmung der
Holzkonstrnktion. Der Bildhauer
findet nur an den Flächen des Un-
terbaues, an der Dachwölbung und
am First Beschäftigung. Semper er-
kennt in diesen Denkmälern, die
sich auch auf den Eeliefs und zwar
da unmittelbar neben anderen im
Steincharakter gedachten Städte-
ansichten zeigen, nicht eine den
Lykiern eigentümliche Holzarchitek-
tur, sondern ebenfalls höchst wahr-
scheinlich monumental in Stein um-
gesetzte „Scheiterhaufen".
Etrurien allein nimmt eine ab- ^^^^
weichende, eigenartige Entwicklung. _
Als hier an Stelle der früheren Grabformen die WraD-
kammer trat, ließ man beim Aushöhlen derselben bank-
artige Erhebungen in ihr stehen. Auf diese ^ein-
baute legte man die Toten. Sie wurden mit der
Zeit zu Enhebetten umgestaltet, indem man im leicht
zu bearbeitenden Stein hölzerne Bettgestelle mit Kissen
nachahmte. Farbige Behandlung ergänzte die 01-
stellung. Als nun statt der Bänke der Sarg sich ein-
bürgerte, blieb die Form des Ruhebettes für ihn be-
stehen, nur dass man statt des Toten sein Porträt oben-
auf legte. Ein dem Etruskischen eigener Naturalismus
feierte in der möglichst getreuen, lebenswahren Porträ-
tirung bei so passendem Anlass die höchsten, wenn auch
nicht immer erfreuliche Triumphe. Aber auch hierbei
iliiitiilllfiiilf
Entwurf zu einem
Diplom für die Berliner Gewerbeausstellung 189G von Fmtz Becker, Berlin.
blieb es nicht. Auch hier drängte sich ein architek-
tonisches Gelüste ein. Der Sarg nahm eine Mittel-
stellung zwischen Haus- und Bettform ein. Es war dies
kein künstlerischer Einfall. Die Verbindung von zwei
so grundverschiedenen Dingen musste unorganisch bleiben.
Die zu Giebeln aufgestülpten Schmalseiten zwangen das
Bildnis des Verstorbenen, das nach wie vor auf den jetzt
7t
versehenen Grabhügel des skandinavischen Nordens nicht
bloß Nachbildungen, sondern zuweilen die Wohnräume
der Lebenden selbst gewesen. Selbst die ältesten
griechischen Sarkophage behalten den Grundgedanken der
Hausform bei; sie bilden den Deckel als Giebeldach mit
Akroterien. Es ist auch hier wieder bezeichnend lin-
den griechischen Geschmack, dass bei ihnen die architek-
tonische Gliederung den Relief-
schmuck überwiegt. Dieser ist ihnen
ursprünglich Nebensache, das Bau-
prinzip die Hauptsache, und sehr
mit Recht, da es sich doch um
Denkmäler handelte.
Dass auch Kleinasien bei fort-
schreitender Entwicklung des Gräber-
kultus trotz dem Festhalten an ur-
tümlicher Kegel- und Pyramidenform
den Hausbau ziemlich unvermittelt,
ja unkonstruktiv auf die Gestaltung
des Grabmals übertrug, ward schon
berührt. Die berühmten Felsen-
fassaden und Sarkophage Lykiens
zeigen den Riegelbau der Wohn-
häuser sowohl architektonisch auf
Stein übertragen als auch in in-
teressanten Eeliefdarstellungen, eine
Bauart, die sich anscheinend unver-
ändert in den Vorratshäusern der
dortigen Landleute bis heutigen Tags
erhielt. Beispiele gleich den im
britischen Museum und im Wiener
Hofmuseum aufbewahrten offenbaren
die vollständigste Nachahmung der
Holzkonstrnktion. Der Bildhauer
findet nur an den Flächen des Un-
terbaues, an der Dachwölbung und
am First Beschäftigung. Semper er-
kennt in diesen Denkmälern, die
sich auch auf den Eeliefs und zwar
da unmittelbar neben anderen im
Steincharakter gedachten Städte-
ansichten zeigen, nicht eine den
Lykiern eigentümliche Holzarchitek-
tur, sondern ebenfalls höchst wahr-
scheinlich monumental in Stein um-
gesetzte „Scheiterhaufen".
Etrurien allein nimmt eine ab- ^^^^
weichende, eigenartige Entwicklung. _
Als hier an Stelle der früheren Grabformen die WraD-
kammer trat, ließ man beim Aushöhlen derselben bank-
artige Erhebungen in ihr stehen. Auf diese ^ein-
baute legte man die Toten. Sie wurden mit der
Zeit zu Enhebetten umgestaltet, indem man im leicht
zu bearbeitenden Stein hölzerne Bettgestelle mit Kissen
nachahmte. Farbige Behandlung ergänzte die 01-
stellung. Als nun statt der Bänke der Sarg sich ein-
bürgerte, blieb die Form des Ruhebettes für ihn be-
stehen, nur dass man statt des Toten sein Porträt oben-
auf legte. Ein dem Etruskischen eigener Naturalismus
feierte in der möglichst getreuen, lebenswahren Porträ-
tirung bei so passendem Anlass die höchsten, wenn auch
nicht immer erfreuliche Triumphe. Aber auch hierbei
iliiitiilllfiiilf
Entwurf zu einem
Diplom für die Berliner Gewerbeausstellung 189G von Fmtz Becker, Berlin.
blieb es nicht. Auch hier drängte sich ein architek-
tonisches Gelüste ein. Der Sarg nahm eine Mittel-
stellung zwischen Haus- und Bettform ein. Es war dies
kein künstlerischer Einfall. Die Verbindung von zwei
so grundverschiedenen Dingen musste unorganisch bleiben.
Die zu Giebeln aufgestülpten Schmalseiten zwangen das
Bildnis des Verstorbenen, das nach wie vor auf den jetzt