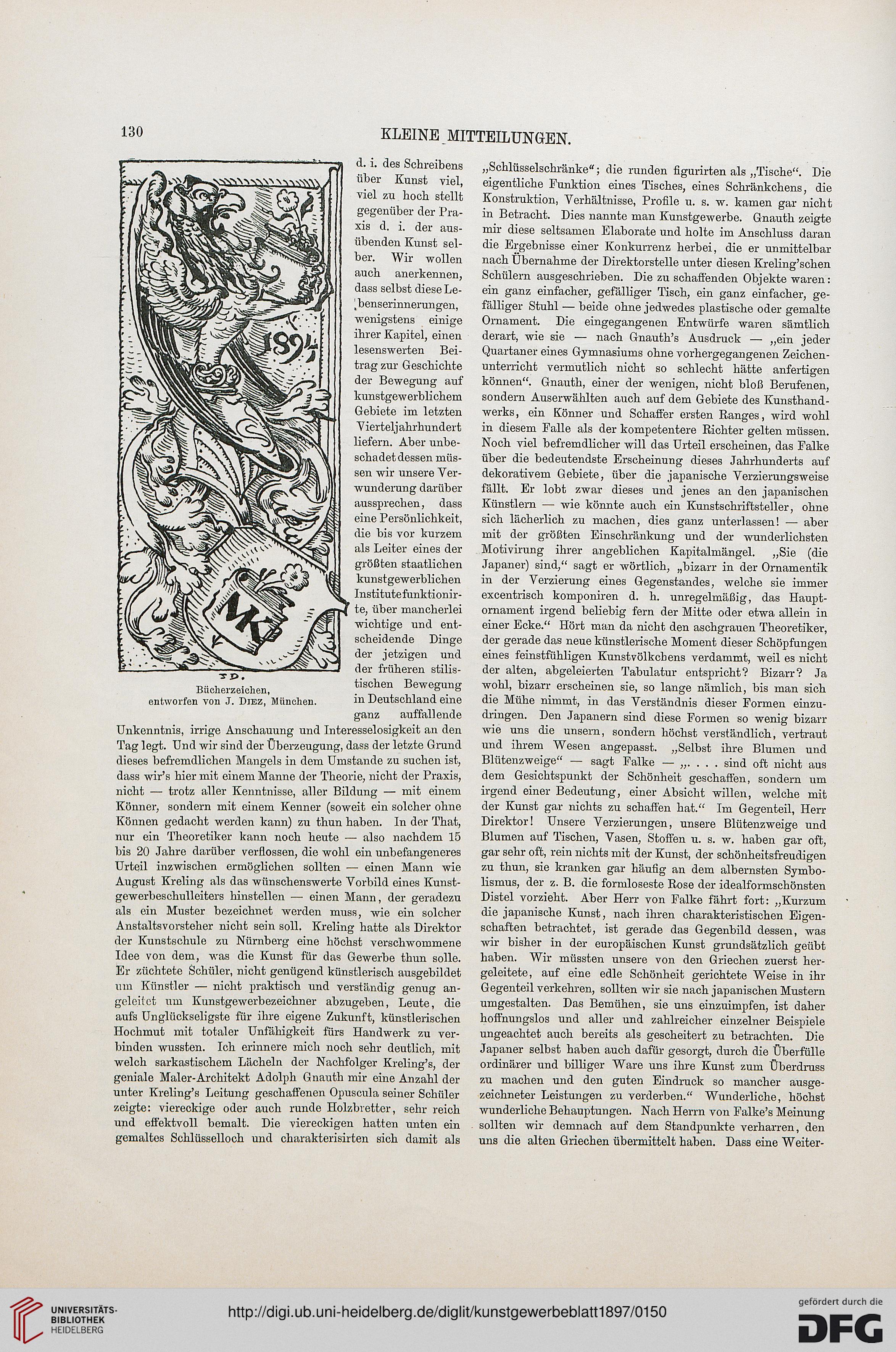130
KLEINE MITTEILUNGEN.
d. i. des Schreibens
über Kunst viel,
viel zu hoch stellt
gegenüber der Pra-
xis d. i. der aus-
übenden Kunst sel-
ber. Wir wollen
auch anerkennen,
dass selbst diese Le-
^benserinnerungen,
wenigstens einige
ihrer Kapitel, einen
lesenswerten Bei-
trag zur Geschichte
der Bewegung auf
kunstgewerblichem
Gebiete im letzten
Vierteljahrhundert
liefern. Aber unbe-
schadetdessen müs-
sen wir unsere Ver-
wunderung darüber
aussprechen, dass
eine Persönlichkeit,
die bis vor kurzem
als Leiter eines der
größten staatlichen
kunstgewerblichen
Institute funktionir-
te, über mancherlei
wichtige und ent-
scheidende Dinge
der jetzigen und
der früheren stilis-
tischen Bewegung
in Deutschland eine
ganz auffallende
Unkenntnis, irrige Anschauung und Interesselosigkeit an den
Tag legt. Und wir sind der Überzeugung, dass der letzte Grand
dieses befremdlichen Mangels in dem umstände zu suchen ist,
dass wir's hier mit einem Manne der Theorie, nicht der Praxis,
nicht — trotz aller Kenntnisse, aller Bildung — mit einem
Könner, sondern mit einem Kenner (soweit ein solcher ohne
Können gedacht werden kann) zu thun haben. In der That,
nur ein Theoretiker kann noch heute — also nachdem 15
bis 20 Jahre darüber verflossen, die wohl ein unbefangeneres
Urteil inzwischen ermöglichen sollten — einen Mann wie
August Kreling als das wünschenswerte Vorbild eines Kunst-
gewerbeschullciters hinstellen — einen Mann, der geradezu
als ein Muster bezeichnet werden muss, wie ein solcher
Anstaltsvorsteher nicht sein soll. Kreling hatte als Direktor
der Kunstschule zu Nürnberg eine höchst verschwommene
Idee von dem, was die Kunst für das Gewerbe thun solle.
Er züchtete Schüler, nicht genügend künstlerisch ausgebildet
um Künstler — nicht praktisch und verständig genug an-
geleitet um Kunstgewerbezeichnor abzugeben, Leute, die
aufs Unglückseligste für ihre eigene Zukunft, künstlerischen
Hochmut mit totaler Unfähigkeit fürs Handwerk zu ver-
binden wussten. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, mit
welch sarkastischem Lächeln der Nachfolger Kreling's, der
geniale Maler-Architekt Adolph Gnauth mir eine Anzahl der
unter Kreling's Leitung geschaffenen Opuscula seiner Schüler
zeigte: viereckige oder auch runde Holzbvetter, sehr reich
und effektvoll bemalt. Die viereckigen hatten unten ein
gemaltes Schlüsselloch und eharakterisirten sich damit als
Bücherzeichen,
entworfen von J. Diez, München.
„Schlüsselsehränke"; die runden flgurirten als „Tische". Die
eigentliche Funktion eines Tisches, eines Schränkchens, die
Konstruktion, Verhältnisse, Profile u. s. w. kamen gar nicht
in Betracht. Dies nannte man Kunstgewerbe. Gnauth zeigte
mir diese seltsamen Elaborate und holte im Anschluss daran
die Ergebnisse einer Konkurrenz herbei, die er unmittelbar
nach Übernahme der Direktorstelle unter diesen Kreling'schen
Schülern ausgeschrieben. Die zu schaffenden Objekte waren:
ein ganz einfacher, gefälliger Tisch, ein ganz einfacher, ge-
fälliger Stuhl — beide ohne jedwedes plastische oder gemalte
Ornament. Die eingegangenen Entwürfe waren sämtlich
derart, wie sie — nach Gnauth's Ausdruck — „ein jeder
Quartaner eines Gymnasiums ohne vorhergegangenen Zeichen-
unterricht vermutlich nicht so schlecht hätte anfertigen
können". Gnauth, einer der wenigen, nicht bloß Berufenen,
sondern Auserwählten auch auf dem Gebiete des Kunsthand-
werks , ein Könner und Schaffer ersten Ranges, wird wohl
in diesem Falle als der kompetentere Richter gelten müssen.
Noch viel befremdlicher will das Urteil erscheinen, das Falke
über die bedeutendste Erscheinung dieses Jahrhunderts auf
dekorativem Gebiete, über die japanische Verzierungsweise
fällt. Er lobt zwar dieses und jenes an den japanischen
Künstlern — wie könnte auch ein Kunstschriftsteller, ohne
sich lächerlich zu machen, dies ganz unterlassen! — aber
mit der größten Einschränkung und der wunderlichsten
Motivirung ihrer angeblichen Kapitalmängel. „Sie (die
Japaner) sind," sagt er wörtlich, „bizarr in der Ornamentik
in der Verzierung eines Gegenstandes, welche sie immer
excentrisch komponiren d. h. unregelmäßig, das Haupt-
ornament irgend beliebig fern der Mitte oder etwa allein in
einer Ecke." Hört man da nicht den aschgrauen Theoretiker,
der gerade das neue künstlerische Moment dieser Schöpfungen
eines feinstfühligen Kunstvölkchens verdammt, weil es nicht
der alten, abgeleierten Tabulatur entspricht? Bizarr? Ja
wohl, bizarr erscheinen sie, so lange nämlich, bis man sich
die Mühe nimmt, in das Verständnis dieser Formen einzu-
dringen. Den Japanern sind diese Formen so wenig bizarr
wie uns die unsern, sondern höchst verständlich, vertraut
und ihrem Wesen angepasst. „Selbst ihre Blumen und
Blütenzweige" — sagt Falke — „. . . . sind oft nicht aus
dem Gesichtspunkt der Schönheit geschaffen, sondern um
irgend einer Bedeutung, einer Absicht willen, welche mit
der Kunst gar nichts zu schaffen hat." Im Gegenteil, Herr
Direktor! Unsere Verzierungen, unsere Blütenzweige und
Blumen auf Tischen, Vasen, Stoffen u. s. w. haben gar oft,
gar sehr oft, rein nichts mit der Kunst, der sehönheitsfreudigen
zu thun, sie kranken gar häufig an dem albernsten Symbo-
lismus, der z. B. die formloseste Rose der idealformschönsten
Distel vorzieht. Aber Herr von Falke fährt fort: „Kurzum
die japanische Kunst, nach ihren charakteristischen Eigen-
schaften betrachtet, ist gerade das Gegenbild dessen, was
wir bisher in der europäischen Kunst grundsätzlich geübt
haben. Wir müssten unsere von den Griechen zuerst her-
geleitete, auf eine edle Schönheit gerichtete Weise in ihr
Gegenteil verkehren, sollten wir sie nach japanischen Mustern
umgestalten. Das Bemühen, sie uns einzuimpfen, ist daher
hoffnungslos und aller und zahlreicher einzelner Beispiele
ungeachtet auch bereits als gescheitert zu betrachten. Die
Japaner selbst haben auch dafür gesorgt, durch die Überfülle
ordinärer und billiger Ware uns ihre Kunst zum Überdruss
zu machen und den guten Eindruck so mancher ausge-
zeichneter Leistungen zu verderben." Wunderliche, höchst
wunderliche Behauptungen. Nach Herrn von Falke's Meinung
sollten wir demnach auf dem Standpunkte verharren, den
uns die alten Griechen übermittelt haben. Dass eine Weiter-
KLEINE MITTEILUNGEN.
d. i. des Schreibens
über Kunst viel,
viel zu hoch stellt
gegenüber der Pra-
xis d. i. der aus-
übenden Kunst sel-
ber. Wir wollen
auch anerkennen,
dass selbst diese Le-
^benserinnerungen,
wenigstens einige
ihrer Kapitel, einen
lesenswerten Bei-
trag zur Geschichte
der Bewegung auf
kunstgewerblichem
Gebiete im letzten
Vierteljahrhundert
liefern. Aber unbe-
schadetdessen müs-
sen wir unsere Ver-
wunderung darüber
aussprechen, dass
eine Persönlichkeit,
die bis vor kurzem
als Leiter eines der
größten staatlichen
kunstgewerblichen
Institute funktionir-
te, über mancherlei
wichtige und ent-
scheidende Dinge
der jetzigen und
der früheren stilis-
tischen Bewegung
in Deutschland eine
ganz auffallende
Unkenntnis, irrige Anschauung und Interesselosigkeit an den
Tag legt. Und wir sind der Überzeugung, dass der letzte Grand
dieses befremdlichen Mangels in dem umstände zu suchen ist,
dass wir's hier mit einem Manne der Theorie, nicht der Praxis,
nicht — trotz aller Kenntnisse, aller Bildung — mit einem
Könner, sondern mit einem Kenner (soweit ein solcher ohne
Können gedacht werden kann) zu thun haben. In der That,
nur ein Theoretiker kann noch heute — also nachdem 15
bis 20 Jahre darüber verflossen, die wohl ein unbefangeneres
Urteil inzwischen ermöglichen sollten — einen Mann wie
August Kreling als das wünschenswerte Vorbild eines Kunst-
gewerbeschullciters hinstellen — einen Mann, der geradezu
als ein Muster bezeichnet werden muss, wie ein solcher
Anstaltsvorsteher nicht sein soll. Kreling hatte als Direktor
der Kunstschule zu Nürnberg eine höchst verschwommene
Idee von dem, was die Kunst für das Gewerbe thun solle.
Er züchtete Schüler, nicht genügend künstlerisch ausgebildet
um Künstler — nicht praktisch und verständig genug an-
geleitet um Kunstgewerbezeichnor abzugeben, Leute, die
aufs Unglückseligste für ihre eigene Zukunft, künstlerischen
Hochmut mit totaler Unfähigkeit fürs Handwerk zu ver-
binden wussten. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, mit
welch sarkastischem Lächeln der Nachfolger Kreling's, der
geniale Maler-Architekt Adolph Gnauth mir eine Anzahl der
unter Kreling's Leitung geschaffenen Opuscula seiner Schüler
zeigte: viereckige oder auch runde Holzbvetter, sehr reich
und effektvoll bemalt. Die viereckigen hatten unten ein
gemaltes Schlüsselloch und eharakterisirten sich damit als
Bücherzeichen,
entworfen von J. Diez, München.
„Schlüsselsehränke"; die runden flgurirten als „Tische". Die
eigentliche Funktion eines Tisches, eines Schränkchens, die
Konstruktion, Verhältnisse, Profile u. s. w. kamen gar nicht
in Betracht. Dies nannte man Kunstgewerbe. Gnauth zeigte
mir diese seltsamen Elaborate und holte im Anschluss daran
die Ergebnisse einer Konkurrenz herbei, die er unmittelbar
nach Übernahme der Direktorstelle unter diesen Kreling'schen
Schülern ausgeschrieben. Die zu schaffenden Objekte waren:
ein ganz einfacher, gefälliger Tisch, ein ganz einfacher, ge-
fälliger Stuhl — beide ohne jedwedes plastische oder gemalte
Ornament. Die eingegangenen Entwürfe waren sämtlich
derart, wie sie — nach Gnauth's Ausdruck — „ein jeder
Quartaner eines Gymnasiums ohne vorhergegangenen Zeichen-
unterricht vermutlich nicht so schlecht hätte anfertigen
können". Gnauth, einer der wenigen, nicht bloß Berufenen,
sondern Auserwählten auch auf dem Gebiete des Kunsthand-
werks , ein Könner und Schaffer ersten Ranges, wird wohl
in diesem Falle als der kompetentere Richter gelten müssen.
Noch viel befremdlicher will das Urteil erscheinen, das Falke
über die bedeutendste Erscheinung dieses Jahrhunderts auf
dekorativem Gebiete, über die japanische Verzierungsweise
fällt. Er lobt zwar dieses und jenes an den japanischen
Künstlern — wie könnte auch ein Kunstschriftsteller, ohne
sich lächerlich zu machen, dies ganz unterlassen! — aber
mit der größten Einschränkung und der wunderlichsten
Motivirung ihrer angeblichen Kapitalmängel. „Sie (die
Japaner) sind," sagt er wörtlich, „bizarr in der Ornamentik
in der Verzierung eines Gegenstandes, welche sie immer
excentrisch komponiren d. h. unregelmäßig, das Haupt-
ornament irgend beliebig fern der Mitte oder etwa allein in
einer Ecke." Hört man da nicht den aschgrauen Theoretiker,
der gerade das neue künstlerische Moment dieser Schöpfungen
eines feinstfühligen Kunstvölkchens verdammt, weil es nicht
der alten, abgeleierten Tabulatur entspricht? Bizarr? Ja
wohl, bizarr erscheinen sie, so lange nämlich, bis man sich
die Mühe nimmt, in das Verständnis dieser Formen einzu-
dringen. Den Japanern sind diese Formen so wenig bizarr
wie uns die unsern, sondern höchst verständlich, vertraut
und ihrem Wesen angepasst. „Selbst ihre Blumen und
Blütenzweige" — sagt Falke — „. . . . sind oft nicht aus
dem Gesichtspunkt der Schönheit geschaffen, sondern um
irgend einer Bedeutung, einer Absicht willen, welche mit
der Kunst gar nichts zu schaffen hat." Im Gegenteil, Herr
Direktor! Unsere Verzierungen, unsere Blütenzweige und
Blumen auf Tischen, Vasen, Stoffen u. s. w. haben gar oft,
gar sehr oft, rein nichts mit der Kunst, der sehönheitsfreudigen
zu thun, sie kranken gar häufig an dem albernsten Symbo-
lismus, der z. B. die formloseste Rose der idealformschönsten
Distel vorzieht. Aber Herr von Falke fährt fort: „Kurzum
die japanische Kunst, nach ihren charakteristischen Eigen-
schaften betrachtet, ist gerade das Gegenbild dessen, was
wir bisher in der europäischen Kunst grundsätzlich geübt
haben. Wir müssten unsere von den Griechen zuerst her-
geleitete, auf eine edle Schönheit gerichtete Weise in ihr
Gegenteil verkehren, sollten wir sie nach japanischen Mustern
umgestalten. Das Bemühen, sie uns einzuimpfen, ist daher
hoffnungslos und aller und zahlreicher einzelner Beispiele
ungeachtet auch bereits als gescheitert zu betrachten. Die
Japaner selbst haben auch dafür gesorgt, durch die Überfülle
ordinärer und billiger Ware uns ihre Kunst zum Überdruss
zu machen und den guten Eindruck so mancher ausge-
zeichneter Leistungen zu verderben." Wunderliche, höchst
wunderliche Behauptungen. Nach Herrn von Falke's Meinung
sollten wir demnach auf dem Standpunkte verharren, den
uns die alten Griechen übermittelt haben. Dass eine Weiter-