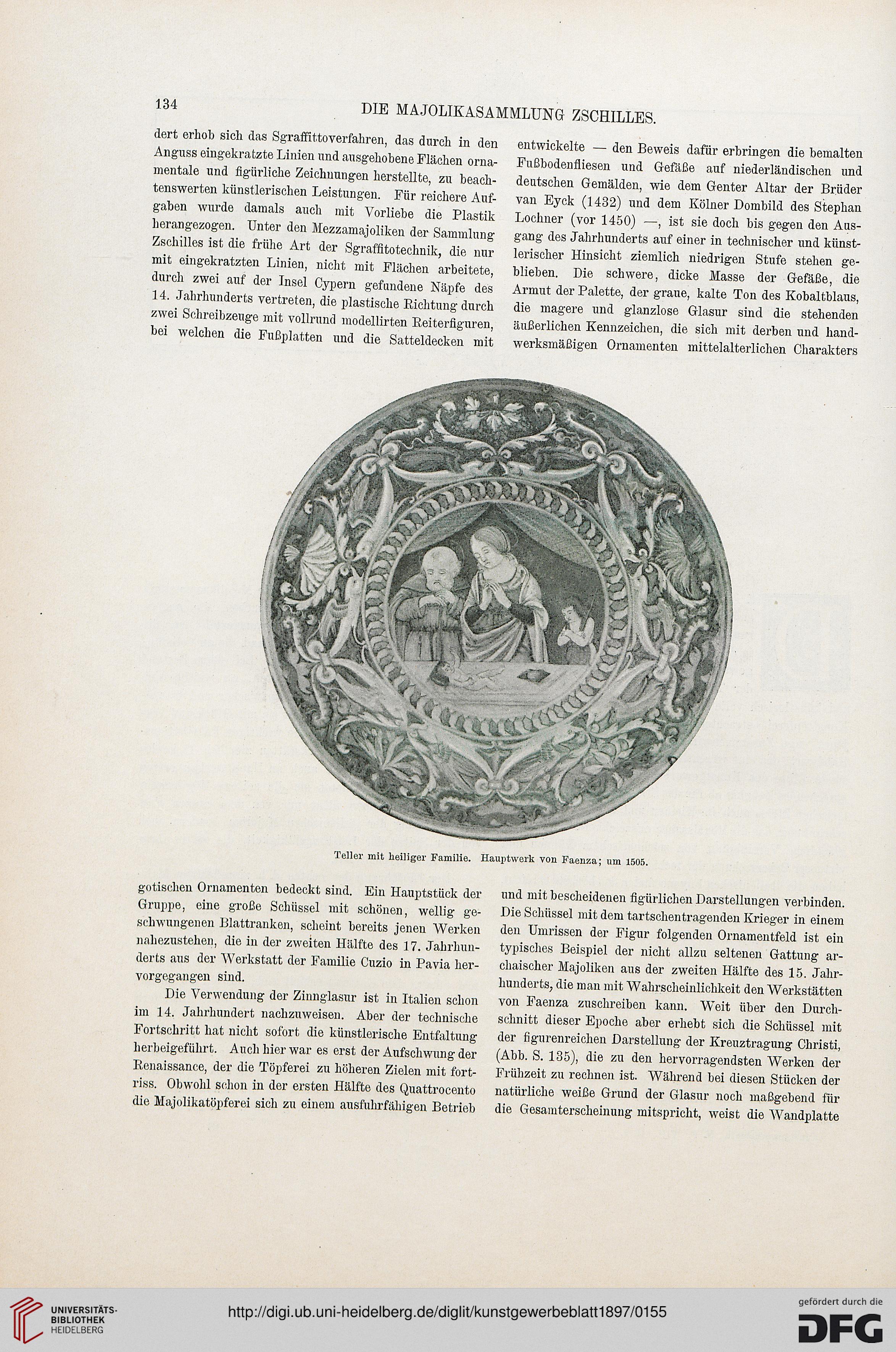134
DIE MAJOLIKASAMMLUNG ZSCHILLES.
dert erhob sich das Sgraffittoverfahren, das durch in den
Anguss eingekratzte Linien und ausgehobene Flächen orna-
mentale und figürliche Zeichnungen herstellte, zu beach-
tenswerten künstlerischen Leistungen. Für reichere Auf-
gaben wurde damals auch mit Vorliebe die Plastik
herangezogen. Unter den Mezzamajoliken der Sammlung
Zschilles ist die frühe Art der Sgraffitoteclmik, die nur
mit eingekratzten Linien, nicht mit Flächen arbeitete,
durch zwei auf der Insel Cypern gefundene Näpfe des
14. Jahrhunderts vertreten, die plastische Richtung durch
zwei Schreibzeuge mit vollrund modellirten Reiterfiguren,
bei welchen die Fußplatten und die Satteldecken mit
entwickelte — den Beweis dafür erbringen die bemalten
Fußbodenfliesen und Gefäße auf niederländischen und
deutschen Gemälden, wie dem Genter Altar der Brüder
van Eyck (1432) und dem Kölner Dombild des Stephan
Lochner (vor 1450) —, ist sie doch bis gegen den Aus-
gang des Jahrhunderts auf einer in technischer und künst-
lerischer Hinsicht ziemlich niedrigen Stufe stehen ge-
blieben. Die schwere, dicke Masse der Gefäße, die
Armut der Palette, der graue, kalte Ton des Kobaltblaus,
die magere und glanzlose Glasur sind die stehenden
äußerlichen Kennzeichen, die sich mit derben und hand-
werksmäßigen Ornamenten mittelalterlichen Charakters
Teller mit heiliger Familie. Hauptwerk von Faenza; um
1505.
gotischen Ornamenten bedeckt sind. Ein Hauptstück der
Gruppe, eine große Schüssel mit schönen, wellig ge-
schwungenen Blattranken, scheint bereits jenen Werken
nahezustehen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts aus der "Werkstatt der Familie Cuzio in Pavia her-
vorgegangen sind.
Die Verwendung der Zinnglasur ist in Italien schon
im 14. Jahrhundert nachzuweisen. Aber der technische
Fortschritt hat nicht sofort die künstlerische Entfaltung
herbeigeführt. Auch hier war es erst der Aufschwung der
Renaissance, der die Töpferei zu höheren Zielen mit fort-
riss. Obwohl schon in der ersten Hälfte des Quattrocento
die Majolikatöpferei sich zu einem ausfuhrfähigen Betrieb
und mit bescheidenen figürlichen Darstellungen verbinden.
Die Schüssel mit dem tartschentragenden Krieger in einem
den Umrissen der Figur folgenden Ornamentfeld ist ein
typisches Beispiel der nicht allzu seltenen Gattung ar-
chaischer Majoliken aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts, die man mit Wahrscheinlichkeit den Werkstätten
von Faenza zuschreiben kann. Weit über den Durch-
schnitt dieser Epoche aber erhebt sich die Schüssel mit
der figurenreichen Darstellung der Kreuztragung Christi,
(Abb. S. 185), die zu den hervorragendsten Werken der
Frühzeit zu rechnen ist. Während bei diesen Stücken der
natürliche weiße Grund der Glasur noch maßgebend für
die Gesamterscheinung mitspricht, weist die AVandplatte
DIE MAJOLIKASAMMLUNG ZSCHILLES.
dert erhob sich das Sgraffittoverfahren, das durch in den
Anguss eingekratzte Linien und ausgehobene Flächen orna-
mentale und figürliche Zeichnungen herstellte, zu beach-
tenswerten künstlerischen Leistungen. Für reichere Auf-
gaben wurde damals auch mit Vorliebe die Plastik
herangezogen. Unter den Mezzamajoliken der Sammlung
Zschilles ist die frühe Art der Sgraffitoteclmik, die nur
mit eingekratzten Linien, nicht mit Flächen arbeitete,
durch zwei auf der Insel Cypern gefundene Näpfe des
14. Jahrhunderts vertreten, die plastische Richtung durch
zwei Schreibzeuge mit vollrund modellirten Reiterfiguren,
bei welchen die Fußplatten und die Satteldecken mit
entwickelte — den Beweis dafür erbringen die bemalten
Fußbodenfliesen und Gefäße auf niederländischen und
deutschen Gemälden, wie dem Genter Altar der Brüder
van Eyck (1432) und dem Kölner Dombild des Stephan
Lochner (vor 1450) —, ist sie doch bis gegen den Aus-
gang des Jahrhunderts auf einer in technischer und künst-
lerischer Hinsicht ziemlich niedrigen Stufe stehen ge-
blieben. Die schwere, dicke Masse der Gefäße, die
Armut der Palette, der graue, kalte Ton des Kobaltblaus,
die magere und glanzlose Glasur sind die stehenden
äußerlichen Kennzeichen, die sich mit derben und hand-
werksmäßigen Ornamenten mittelalterlichen Charakters
Teller mit heiliger Familie. Hauptwerk von Faenza; um
1505.
gotischen Ornamenten bedeckt sind. Ein Hauptstück der
Gruppe, eine große Schüssel mit schönen, wellig ge-
schwungenen Blattranken, scheint bereits jenen Werken
nahezustehen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts aus der "Werkstatt der Familie Cuzio in Pavia her-
vorgegangen sind.
Die Verwendung der Zinnglasur ist in Italien schon
im 14. Jahrhundert nachzuweisen. Aber der technische
Fortschritt hat nicht sofort die künstlerische Entfaltung
herbeigeführt. Auch hier war es erst der Aufschwung der
Renaissance, der die Töpferei zu höheren Zielen mit fort-
riss. Obwohl schon in der ersten Hälfte des Quattrocento
die Majolikatöpferei sich zu einem ausfuhrfähigen Betrieb
und mit bescheidenen figürlichen Darstellungen verbinden.
Die Schüssel mit dem tartschentragenden Krieger in einem
den Umrissen der Figur folgenden Ornamentfeld ist ein
typisches Beispiel der nicht allzu seltenen Gattung ar-
chaischer Majoliken aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts, die man mit Wahrscheinlichkeit den Werkstätten
von Faenza zuschreiben kann. Weit über den Durch-
schnitt dieser Epoche aber erhebt sich die Schüssel mit
der figurenreichen Darstellung der Kreuztragung Christi,
(Abb. S. 185), die zu den hervorragendsten Werken der
Frühzeit zu rechnen ist. Während bei diesen Stücken der
natürliche weiße Grund der Glasur noch maßgebend für
die Gesamterscheinung mitspricht, weist die AVandplatte