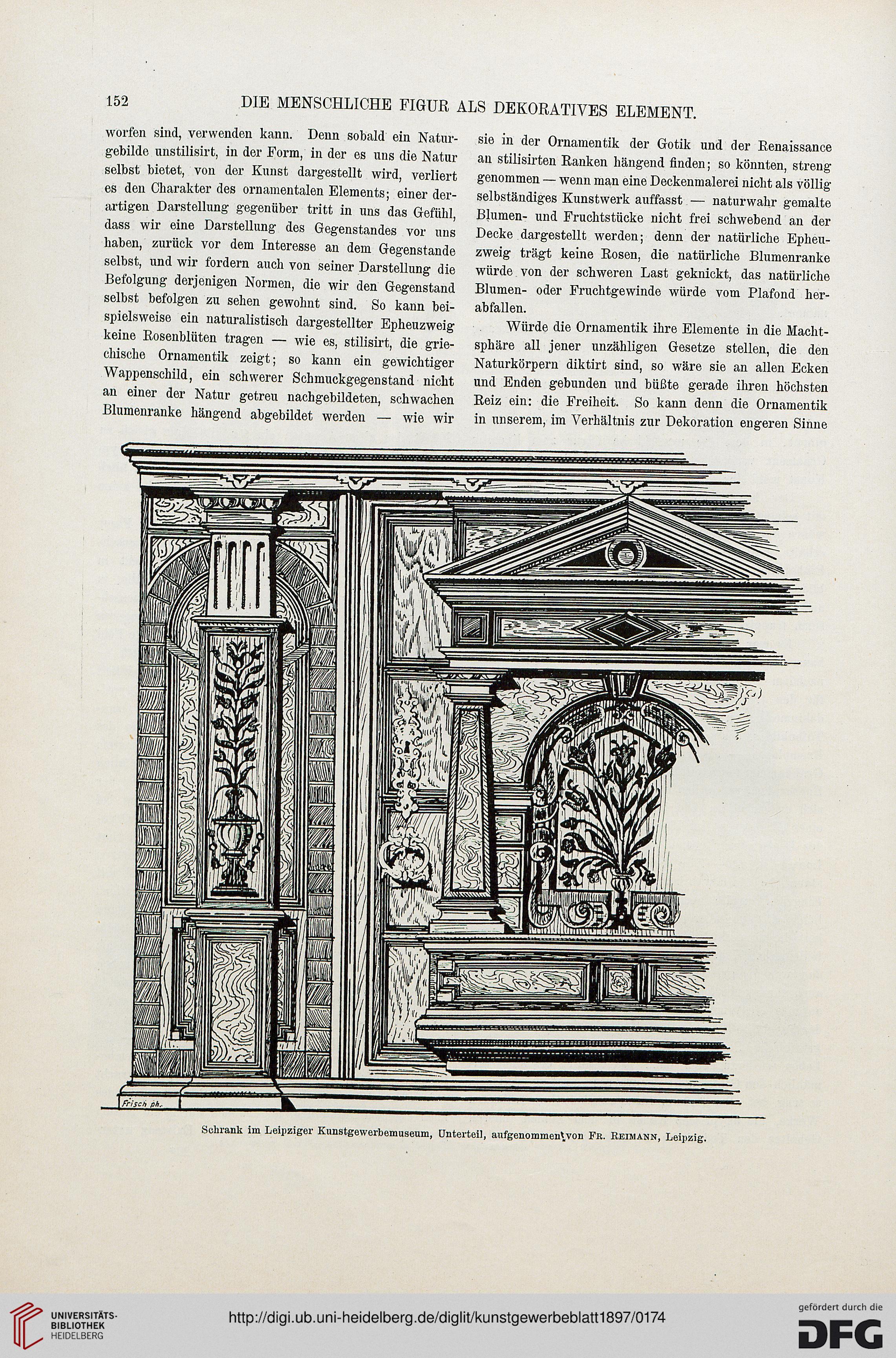152
DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.
worfen sind, verwenden kann. Denn sobald ein Natur-
gebilde unstilisirt, in der Form, in der es uns die Natur
selbst bietet, von der Kunst dargestellt wird, verliert
es den Charakter des ornamentalen Elements; einer der-
artigen Darstellung gegenüber tritt in uns das Gefühl,
dass wir eine Darstellung des Gegenstandes vor uns
haben, zurück vor dem Interesse an dem Gegenstande
selbst, und wir fordern auch von seiner Darstellung die
Befolgung derjenigen Normen, die wir den Gegenstand
selbst befolgen zu sehen gewohnt sind. So kann bei-
spielsweise ein naturalistisch dargestellter Ephenzweig
keine Kosenblüten tragen — wie es, stilisirt, die grie-
chische Ornamentik zeigt; so kann ein gewichtiger
Wappenschild, ein schwerer Schmuckgegenstand nicht
an einer der Natur getreu nachgebildeten, schwachen
Blumenranke hängend abgebildet werden — wie wir
sie in der Ornamentik der Gotik und der Eenaissance
au stilisirten Ranken hängend finden; so könnten, streng
genommen — wenn man eine Deckenmalerei nicht als völlig
selbständiges Kunstwerk auffasst — naturwahr gemalte
Blumen- und Fruchtstücke nicht frei schwebend an der
Decke dargestellt werden; denn der natürliche Epheu-
zweig trägt keine Rosen, die natürliche Blumenranke
würde von der schweren Last geknickt, das natürliche
Blumen- oder Fruchtgewinde würde vom Plafond her-
abfallen.
Würde die Ornamentik ihre Elemente in die JUacht-
sphäre all jener unzähligen Gesetze stellen, die den
Naturkörpern diktirt sind, so wäre sie an allen Ecken
und Enden gebunden und büßte gerade ihren höchsten
Reiz ein: die Freiheit. So kann denn die Ornamentik
in unserem, im Verhältnis zur Dekoration engeren Sinne
I Frisch eh.
Schrank im Leipziger Kunstgewerbemuseum, Unterteil, aufgenommenVvon Fr. Reimann, Leipzig.
DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.
worfen sind, verwenden kann. Denn sobald ein Natur-
gebilde unstilisirt, in der Form, in der es uns die Natur
selbst bietet, von der Kunst dargestellt wird, verliert
es den Charakter des ornamentalen Elements; einer der-
artigen Darstellung gegenüber tritt in uns das Gefühl,
dass wir eine Darstellung des Gegenstandes vor uns
haben, zurück vor dem Interesse an dem Gegenstande
selbst, und wir fordern auch von seiner Darstellung die
Befolgung derjenigen Normen, die wir den Gegenstand
selbst befolgen zu sehen gewohnt sind. So kann bei-
spielsweise ein naturalistisch dargestellter Ephenzweig
keine Kosenblüten tragen — wie es, stilisirt, die grie-
chische Ornamentik zeigt; so kann ein gewichtiger
Wappenschild, ein schwerer Schmuckgegenstand nicht
an einer der Natur getreu nachgebildeten, schwachen
Blumenranke hängend abgebildet werden — wie wir
sie in der Ornamentik der Gotik und der Eenaissance
au stilisirten Ranken hängend finden; so könnten, streng
genommen — wenn man eine Deckenmalerei nicht als völlig
selbständiges Kunstwerk auffasst — naturwahr gemalte
Blumen- und Fruchtstücke nicht frei schwebend an der
Decke dargestellt werden; denn der natürliche Epheu-
zweig trägt keine Rosen, die natürliche Blumenranke
würde von der schweren Last geknickt, das natürliche
Blumen- oder Fruchtgewinde würde vom Plafond her-
abfallen.
Würde die Ornamentik ihre Elemente in die JUacht-
sphäre all jener unzähligen Gesetze stellen, die den
Naturkörpern diktirt sind, so wäre sie an allen Ecken
und Enden gebunden und büßte gerade ihren höchsten
Reiz ein: die Freiheit. So kann denn die Ornamentik
in unserem, im Verhältnis zur Dekoration engeren Sinne
I Frisch eh.
Schrank im Leipziger Kunstgewerbemuseum, Unterteil, aufgenommenVvon Fr. Reimann, Leipzig.