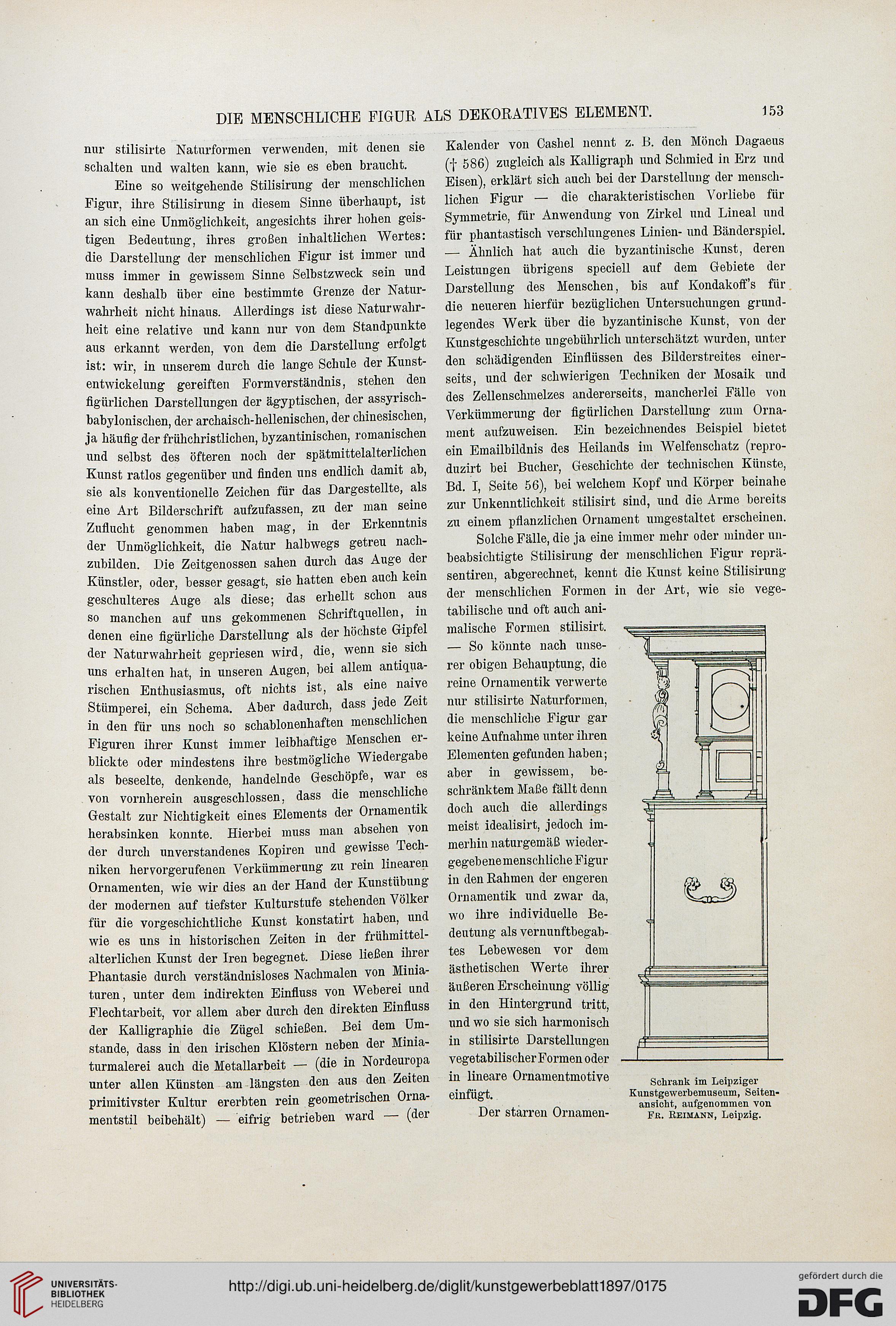DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.
153
nur stilisirte Naturformen verwenden, mit denen sie
schalten und walten kann, wie sie es eben braucht.
Eine so weitgehende Stilisirung der menschlichen
Figur, ihre Stilisirung in diesem Sinne überhaupt, ist
an sich eine Unmöglichkeit, angesichts ihrer hohen geis-
tigen Bedeutung, ihres großen inhaltlichen Wertes:
die Darstellung der menschlichen Figur ist immer und
muss immer in gewissem Sinne Selbstzweck sein und
kann deshalb über eine bestimmte Grenze der Natur-
wahrheit nicht hinaus. Allerdings ist diese Natur wahr-
heit eine relative und kann nur von dem Standpunkte
aus erkannt werden, von dem die Darstellung erfolgt
ist: wir, in unserem durch die lange Schule der Kunst-
entwickelung gereiften Formverständnis, stehen den
figürlichen Darstellungen der ägyptischen, der assyrisch-
babylonischen, der archaisch-hellenischen, der chinesischen,
ja häufig der frühchristlichen, byzantinischen, romanischen
und selbst des öfteren noch der spätmittelalterlichen
Kunst ratlos gegenüber und finden uns endlich damit ab,
sie als konventionelle Zeichen für das Dargestellte, als
eine Art Bilderschrift aufzufassen, zu der man seine
Zuflucht genommen haben mag, in der Erkenntnis
der Unmöglichkeit, die Natur halbwegs getreu nach-
zubilden. Die Zeitgenossen sahen durch das Auge der
Künstler, oder, besser gesagt, sie hatten eben auch kein
geschulteres Auge als diese; das erhellt schon aus
so manchen auf uns gekommenen Schrift quellen,^ in
denen eine figürliche Darstellung als der höchste Gipfel
der Natur Wahrheit gepriesen wird, die, wenn sie sich
uns erhalten hat, in unseren Augen, bei allem antiqua-
rischen Enthusiasmus, oft nichts ist, als eine naive
Stümperei, ein Schema. Aber dadurch, dass jede Zeit
in den für uns noch so schablonenhaften menschlichen
Figuren ihrer Kunst immer leibhaftige Menschen er-
blickte oder mindestens ihre bestmögliche Wiedergabe
als beseelte, denkende, handelnde Geschöpfe, war es
von vornherein ausgeschlossen, dass die menschliche
Gestalt zur Nichtigkeit eines Elements der Ornamentik
herabsinken konnte. Hierbei muss man absehen von
der durch unverstandenes Kopiren und gewisse Tech-
niken hervorgerufenen Verkümmerung zu rein linearen
Ornamenten, wie wir dies an der Hand der Kunstübung
der modernen auf tiefster Kulturstufe stehenden Völker
für die vorgeschichtliche Kunst konstatirt haben,^ und
wie es uns in historischen Zeiten in der frühmittel-
alterlichen Kunst der Iren begegnet. Diese ließen ihrer
Phantasie durch verständnisloses Nachmalen von Minia-
turen, unter dem indirekten Einfluss von Weberei und
Flechtarbeit, vor allem aber durch den direkten Einfluss
der Kalligraphie die Zügel schießen. Bei dem Um-
stände, dass in den irischen Klöstern neben der Minia-
turmalerei auch die Metallarbeit — (die in Nordeuropa
unter allen Künsten am längsten den aus den Zeiten
primitivster Kultur ererbten rein geometrischen Orna-
mentstil beibehält) — eifrig betrieben ward — (der
Kalender von Cashel nennt z. B. den Mönch Dagaeus
(f 586) zugleich als Kalligraph und Schmied in Erz und
Eisen), erklärt sich auch bei der Darstellung der mensch-
lichen Figur — die charakteristischen Vorliebe für
Symmetrie, für Anwendung von Zirkel und Lineal und
für phantastisch verschlungenes Linien- und Bänderspiel.
— Ähnlich hat auch die byzantinische Kunst, deren
Leistungen übrigens speciell auf dem Gebiete der
Darstellung des Menschen, bis auf Kondakoff's für
die neueren hierfür bezüglichen Untersuchungen grund-
legendes Werk über die byzantinische Kunst, von der
Kunstgeschichte ungebührlich unterschätzt wurden, unter
den schädigenden Einflüssen des Bilderstreites einer-
seits, und der schwierigen Techniken der Mosaik und
des Zellenschmelzes andererseits, mancherlei Fälle von
Verkümmerung der figürlichen Darstellung zum Orna-
ment aufzuweisen. Ein bezeichnendes Beispiel bietet
ein Emailbildnis des Heilands im Welfensehatz (repro-
duzirt bei Bucher, Geschichte der technischen Künste,
Bd. I, Seite 56), bei welchem Kopf und Körper beinahe
zur Unkenntlichkeit stilisirt sind, und die Arme bereits
zu einem pflanzlichen Ornament umgestaltet erscheinen.
Solche Fälle, die ja eine immer mehr oder minder un-
beabsichtigte Stilisirung der menschlichen Figur reprä-
sentiren, abgerechnet, kennt die Kunst keine Stilisirung
der menschlichen Formen in der Art, wie sie vege-
tabilische und oft auch ani-
malische Formen stilisirt.
— So könnte nach unse-
rer obigen Behauptung, die
reine Ornamentik verwerte
nur stilisirte Naturformen,
die menschliche Figur gar
keine Aufnahme unter ihren
Elementen gefunden haben;
aber in gewissem, be-
schränktem Maße fällt denn
doch auch die allerdings
meist idealisirt, jedoch im-
merhin naturgemäß wieder-
gegebene menschliche Figur
in den Rahmen der engeren
Ornamentik und zwar da,
wo ihre individuelle Be-
deutung als vernunftbegab-
tes Lebewesen vor dem
ästhetischen Werte ihrer
äußeren Erscheinung völlig
in den Hintergrund tritt,
und wo sie sich harmonisch
in stilisirte Darstellungen
vegetabilischer Formen oder
in lineare Ornamentmotive „ , . . T . .
Schrank im Leipziger
einfügt. Kunstgewerbemuseum, Seiten-
D, ,-. ansieht, aufgenommen von
er starren Ornamen- Fk. eeimann, Leidig.
153
nur stilisirte Naturformen verwenden, mit denen sie
schalten und walten kann, wie sie es eben braucht.
Eine so weitgehende Stilisirung der menschlichen
Figur, ihre Stilisirung in diesem Sinne überhaupt, ist
an sich eine Unmöglichkeit, angesichts ihrer hohen geis-
tigen Bedeutung, ihres großen inhaltlichen Wertes:
die Darstellung der menschlichen Figur ist immer und
muss immer in gewissem Sinne Selbstzweck sein und
kann deshalb über eine bestimmte Grenze der Natur-
wahrheit nicht hinaus. Allerdings ist diese Natur wahr-
heit eine relative und kann nur von dem Standpunkte
aus erkannt werden, von dem die Darstellung erfolgt
ist: wir, in unserem durch die lange Schule der Kunst-
entwickelung gereiften Formverständnis, stehen den
figürlichen Darstellungen der ägyptischen, der assyrisch-
babylonischen, der archaisch-hellenischen, der chinesischen,
ja häufig der frühchristlichen, byzantinischen, romanischen
und selbst des öfteren noch der spätmittelalterlichen
Kunst ratlos gegenüber und finden uns endlich damit ab,
sie als konventionelle Zeichen für das Dargestellte, als
eine Art Bilderschrift aufzufassen, zu der man seine
Zuflucht genommen haben mag, in der Erkenntnis
der Unmöglichkeit, die Natur halbwegs getreu nach-
zubilden. Die Zeitgenossen sahen durch das Auge der
Künstler, oder, besser gesagt, sie hatten eben auch kein
geschulteres Auge als diese; das erhellt schon aus
so manchen auf uns gekommenen Schrift quellen,^ in
denen eine figürliche Darstellung als der höchste Gipfel
der Natur Wahrheit gepriesen wird, die, wenn sie sich
uns erhalten hat, in unseren Augen, bei allem antiqua-
rischen Enthusiasmus, oft nichts ist, als eine naive
Stümperei, ein Schema. Aber dadurch, dass jede Zeit
in den für uns noch so schablonenhaften menschlichen
Figuren ihrer Kunst immer leibhaftige Menschen er-
blickte oder mindestens ihre bestmögliche Wiedergabe
als beseelte, denkende, handelnde Geschöpfe, war es
von vornherein ausgeschlossen, dass die menschliche
Gestalt zur Nichtigkeit eines Elements der Ornamentik
herabsinken konnte. Hierbei muss man absehen von
der durch unverstandenes Kopiren und gewisse Tech-
niken hervorgerufenen Verkümmerung zu rein linearen
Ornamenten, wie wir dies an der Hand der Kunstübung
der modernen auf tiefster Kulturstufe stehenden Völker
für die vorgeschichtliche Kunst konstatirt haben,^ und
wie es uns in historischen Zeiten in der frühmittel-
alterlichen Kunst der Iren begegnet. Diese ließen ihrer
Phantasie durch verständnisloses Nachmalen von Minia-
turen, unter dem indirekten Einfluss von Weberei und
Flechtarbeit, vor allem aber durch den direkten Einfluss
der Kalligraphie die Zügel schießen. Bei dem Um-
stände, dass in den irischen Klöstern neben der Minia-
turmalerei auch die Metallarbeit — (die in Nordeuropa
unter allen Künsten am längsten den aus den Zeiten
primitivster Kultur ererbten rein geometrischen Orna-
mentstil beibehält) — eifrig betrieben ward — (der
Kalender von Cashel nennt z. B. den Mönch Dagaeus
(f 586) zugleich als Kalligraph und Schmied in Erz und
Eisen), erklärt sich auch bei der Darstellung der mensch-
lichen Figur — die charakteristischen Vorliebe für
Symmetrie, für Anwendung von Zirkel und Lineal und
für phantastisch verschlungenes Linien- und Bänderspiel.
— Ähnlich hat auch die byzantinische Kunst, deren
Leistungen übrigens speciell auf dem Gebiete der
Darstellung des Menschen, bis auf Kondakoff's für
die neueren hierfür bezüglichen Untersuchungen grund-
legendes Werk über die byzantinische Kunst, von der
Kunstgeschichte ungebührlich unterschätzt wurden, unter
den schädigenden Einflüssen des Bilderstreites einer-
seits, und der schwierigen Techniken der Mosaik und
des Zellenschmelzes andererseits, mancherlei Fälle von
Verkümmerung der figürlichen Darstellung zum Orna-
ment aufzuweisen. Ein bezeichnendes Beispiel bietet
ein Emailbildnis des Heilands im Welfensehatz (repro-
duzirt bei Bucher, Geschichte der technischen Künste,
Bd. I, Seite 56), bei welchem Kopf und Körper beinahe
zur Unkenntlichkeit stilisirt sind, und die Arme bereits
zu einem pflanzlichen Ornament umgestaltet erscheinen.
Solche Fälle, die ja eine immer mehr oder minder un-
beabsichtigte Stilisirung der menschlichen Figur reprä-
sentiren, abgerechnet, kennt die Kunst keine Stilisirung
der menschlichen Formen in der Art, wie sie vege-
tabilische und oft auch ani-
malische Formen stilisirt.
— So könnte nach unse-
rer obigen Behauptung, die
reine Ornamentik verwerte
nur stilisirte Naturformen,
die menschliche Figur gar
keine Aufnahme unter ihren
Elementen gefunden haben;
aber in gewissem, be-
schränktem Maße fällt denn
doch auch die allerdings
meist idealisirt, jedoch im-
merhin naturgemäß wieder-
gegebene menschliche Figur
in den Rahmen der engeren
Ornamentik und zwar da,
wo ihre individuelle Be-
deutung als vernunftbegab-
tes Lebewesen vor dem
ästhetischen Werte ihrer
äußeren Erscheinung völlig
in den Hintergrund tritt,
und wo sie sich harmonisch
in stilisirte Darstellungen
vegetabilischer Formen oder
in lineare Ornamentmotive „ , . . T . .
Schrank im Leipziger
einfügt. Kunstgewerbemuseum, Seiten-
D, ,-. ansieht, aufgenommen von
er starren Ornamen- Fk. eeimann, Leidig.