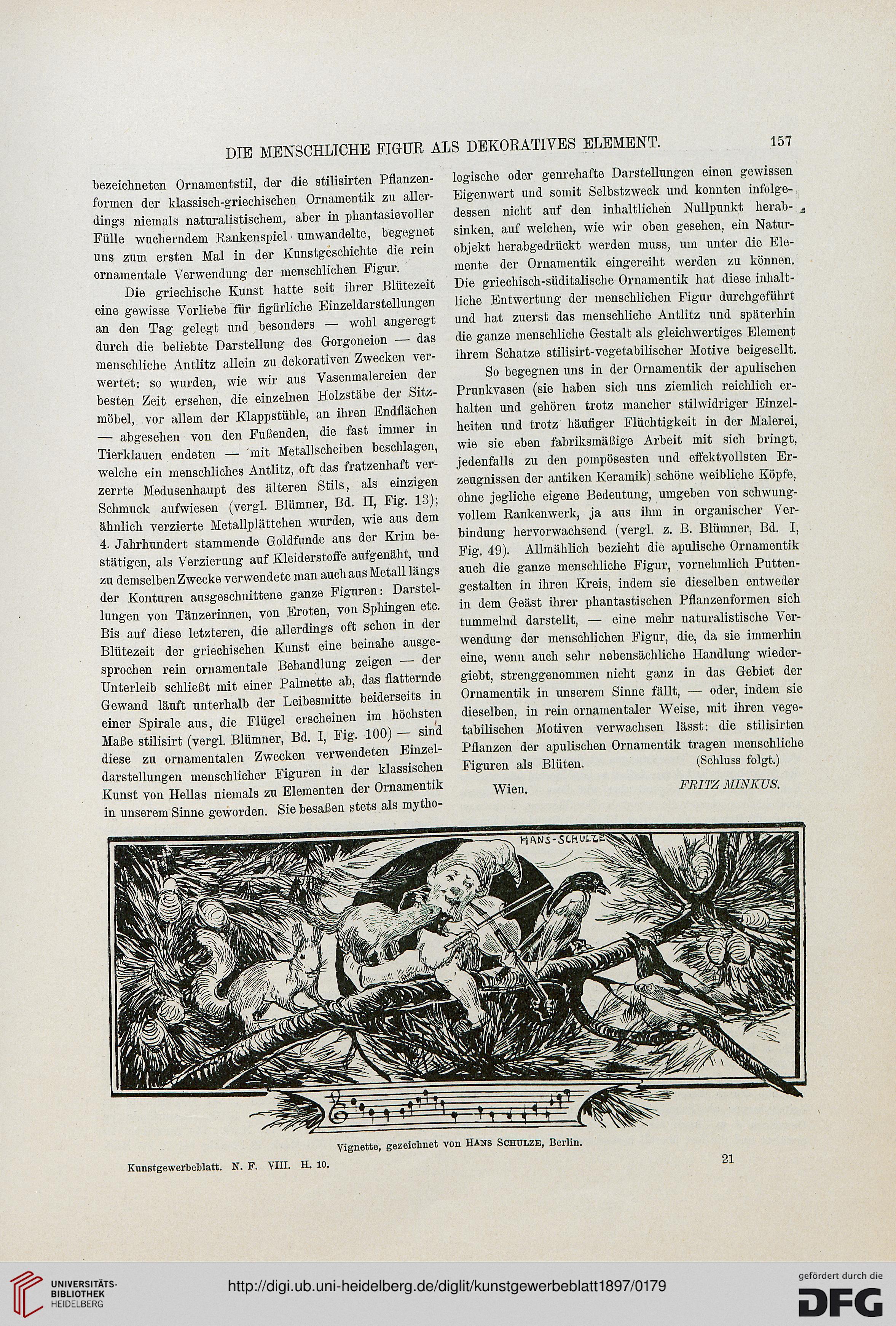DIE MENSCHLICHE FIGUR ALS DEKORATIVES ELEMENT.
157
bezeichneten Ornamentstil, der die stilisirten Pflanzen-
formen der klassisch-griechischen Ornamentik zu aller-
dings niemals naturalistischem, aber in phantasievoller
Fülle wucherndem Rankenspiel- umwandelte, begegnet
uns zum ersten Mal in der Kunstgeschichte die rein
ornamentale Verwendung der menschlichen Figur.
Die griechische Kunst hatte seit ihrer Blütezeit
eine gewisse Vorliebe für figürliche Einzeldarstellungen
an den Tag gelegt und besonders - wohl angeregt
durch die beliebte Darstellung des Gorgoneion — das
menschliche Antlitz allein zu dekorativen Zwecken ver-
wertet: so wurden, wie wir aus Vasenmalereien der
besten Zeit ersehen, die einzelnen Holzstäbe der Sitz-
möbel, vor allem der Klappstühle, an ihren Endflächen
— abgesehen von den Fußenden, die fast immer in
Tierklauen endeten - mit Metallscheiben beschlagen,
welche ein menschliches Antlitz, oft das fratzenhaft ver-
zerrte Medusenhaupt des älteren Stils, als einzigen
Schmuck aufwiesen (vergl. Blümner, Bd. II, Fig. 13);
ähnlich verzierte Metallplättchen wurden, wie aus dem
4. Jahrhundert stammende Goldfunde aus der Krim be-
stätigen, als Verzierung auf Kleiderstoffe aufgenäht und
zu demselbenZwecke verwendete man auch aus Metall längs
der Konturen ausgeschnittene ganze Figuren: Darstel-
" hingen von Tänzerinnen, von Eroten, von Sphingen etc.
Bis auf diese letzteren, die allerdings oft schon in der
Blütezeit der griechischen Kunst eine beinahe ausge-
sprochen rein ornamentale Behandlung zeigen -
Unterleib schließt mit einer Palmette ab, das flatternde
Gewand läuft unterhalb der Leibesmitte beiderseits in
einer Spirale aus, die Flügel erscheinen im höchsten
Maße stilisirt (vergl. Blümner, Bd. I, Fig. 100) Sin
diese zu ornamentalen Zwecken verwendeten Einzel-
darstellungen menschlicher Figuren in der klassischen
Kunst von Hellas niemals zu Elementen der Ornament*
in unserem Sinne geworden. Sie besaßen stets als mytho-
logische oder genrehafte Darstellungen einen gewissen
Eigenwert und somit Selbstzweck und konnten infolge-
dessen nicht auf den inhaltlichen Nullpunkt herab- j
sinken, auf welchen, wie wir oben gesehen, ein Natur-
objekt herabgedi'ückt werden muss, um unter die Ele-
mente der Ornamentik eingereiht werden zu können.
Die griechisch-süditalische Ornamentik hat diese inhalt-
liche Entwertung der menschlichen Figur durchgeführt
und hat zuerst das menschliche Antlitz und späterhin
die ganze menschliche Gestalt als gleichwertiges Element
ihrem Schatze stilisirt-vegetabilischer Motive beigesellt.
So begegnen uns in der Ornamentik der apulischen
Prunkvasen (sie haben sich uns ziemlich reichlich er-
halten und gehören trotz mancher stilwidriger Einzel-
heiten und trotz häufiger Flüchtigkeit in der Malerei,
wie sie eben fabriksmäßige Arbeit mit sich bringt,
jedenfalls zu den pompösesten und effektvollsten Er-
zeugnissen der antiken Keramik) schöne weibliche Köpfe,
ohne jegliche eigene Bedeutung, umgeben von schwung-
vollem Rankenwerk, ja aus ihm in organischer Ver-
bindung hervorwachsend (vergl. z. B. Blümner, Bd. I,
Fig. 49). Allmählich bezieht die apulische Ornamentik
auch die ganze menschliche Figur, vornehmlich Putten-
gestalten in ihren Kreis, indem sie dieselben entweder
in dem Geäst ihrer phantastischen Pflanzenformon sich
tummelnd darstellt, — eine mehr naturalistische Ver-
wendung der menschlichen Figur, die, da sie immerhin
eine, wenn auch sehr nebensächliche Handlung wieder-
giebt, strenggenommen nicht ganz in das Gebiet der
Ornamentik in unserem Sinne fällt, — oder, indem sie
dieselben, in rein ornamentaler Weise, mit ihren vege-
tabilischen Motiven verwachsen lässt: die stilisirten
Pflanzen der apulischen Ornamentik tragen menschliche
Figuren als Blüten. (Schluss folgt.)
Wien.
FRITZ MINKUS.
Vignette, gezeichnet von Hans Schulze, Berlin.
KunstgewerbeMatt. N. F. VIII. H. 10.
21
157
bezeichneten Ornamentstil, der die stilisirten Pflanzen-
formen der klassisch-griechischen Ornamentik zu aller-
dings niemals naturalistischem, aber in phantasievoller
Fülle wucherndem Rankenspiel- umwandelte, begegnet
uns zum ersten Mal in der Kunstgeschichte die rein
ornamentale Verwendung der menschlichen Figur.
Die griechische Kunst hatte seit ihrer Blütezeit
eine gewisse Vorliebe für figürliche Einzeldarstellungen
an den Tag gelegt und besonders - wohl angeregt
durch die beliebte Darstellung des Gorgoneion — das
menschliche Antlitz allein zu dekorativen Zwecken ver-
wertet: so wurden, wie wir aus Vasenmalereien der
besten Zeit ersehen, die einzelnen Holzstäbe der Sitz-
möbel, vor allem der Klappstühle, an ihren Endflächen
— abgesehen von den Fußenden, die fast immer in
Tierklauen endeten - mit Metallscheiben beschlagen,
welche ein menschliches Antlitz, oft das fratzenhaft ver-
zerrte Medusenhaupt des älteren Stils, als einzigen
Schmuck aufwiesen (vergl. Blümner, Bd. II, Fig. 13);
ähnlich verzierte Metallplättchen wurden, wie aus dem
4. Jahrhundert stammende Goldfunde aus der Krim be-
stätigen, als Verzierung auf Kleiderstoffe aufgenäht und
zu demselbenZwecke verwendete man auch aus Metall längs
der Konturen ausgeschnittene ganze Figuren: Darstel-
" hingen von Tänzerinnen, von Eroten, von Sphingen etc.
Bis auf diese letzteren, die allerdings oft schon in der
Blütezeit der griechischen Kunst eine beinahe ausge-
sprochen rein ornamentale Behandlung zeigen -
Unterleib schließt mit einer Palmette ab, das flatternde
Gewand läuft unterhalb der Leibesmitte beiderseits in
einer Spirale aus, die Flügel erscheinen im höchsten
Maße stilisirt (vergl. Blümner, Bd. I, Fig. 100) Sin
diese zu ornamentalen Zwecken verwendeten Einzel-
darstellungen menschlicher Figuren in der klassischen
Kunst von Hellas niemals zu Elementen der Ornament*
in unserem Sinne geworden. Sie besaßen stets als mytho-
logische oder genrehafte Darstellungen einen gewissen
Eigenwert und somit Selbstzweck und konnten infolge-
dessen nicht auf den inhaltlichen Nullpunkt herab- j
sinken, auf welchen, wie wir oben gesehen, ein Natur-
objekt herabgedi'ückt werden muss, um unter die Ele-
mente der Ornamentik eingereiht werden zu können.
Die griechisch-süditalische Ornamentik hat diese inhalt-
liche Entwertung der menschlichen Figur durchgeführt
und hat zuerst das menschliche Antlitz und späterhin
die ganze menschliche Gestalt als gleichwertiges Element
ihrem Schatze stilisirt-vegetabilischer Motive beigesellt.
So begegnen uns in der Ornamentik der apulischen
Prunkvasen (sie haben sich uns ziemlich reichlich er-
halten und gehören trotz mancher stilwidriger Einzel-
heiten und trotz häufiger Flüchtigkeit in der Malerei,
wie sie eben fabriksmäßige Arbeit mit sich bringt,
jedenfalls zu den pompösesten und effektvollsten Er-
zeugnissen der antiken Keramik) schöne weibliche Köpfe,
ohne jegliche eigene Bedeutung, umgeben von schwung-
vollem Rankenwerk, ja aus ihm in organischer Ver-
bindung hervorwachsend (vergl. z. B. Blümner, Bd. I,
Fig. 49). Allmählich bezieht die apulische Ornamentik
auch die ganze menschliche Figur, vornehmlich Putten-
gestalten in ihren Kreis, indem sie dieselben entweder
in dem Geäst ihrer phantastischen Pflanzenformon sich
tummelnd darstellt, — eine mehr naturalistische Ver-
wendung der menschlichen Figur, die, da sie immerhin
eine, wenn auch sehr nebensächliche Handlung wieder-
giebt, strenggenommen nicht ganz in das Gebiet der
Ornamentik in unserem Sinne fällt, — oder, indem sie
dieselben, in rein ornamentaler Weise, mit ihren vege-
tabilischen Motiven verwachsen lässt: die stilisirten
Pflanzen der apulischen Ornamentik tragen menschliche
Figuren als Blüten. (Schluss folgt.)
Wien.
FRITZ MINKUS.
Vignette, gezeichnet von Hans Schulze, Berlin.
KunstgewerbeMatt. N. F. VIII. H. 10.
21