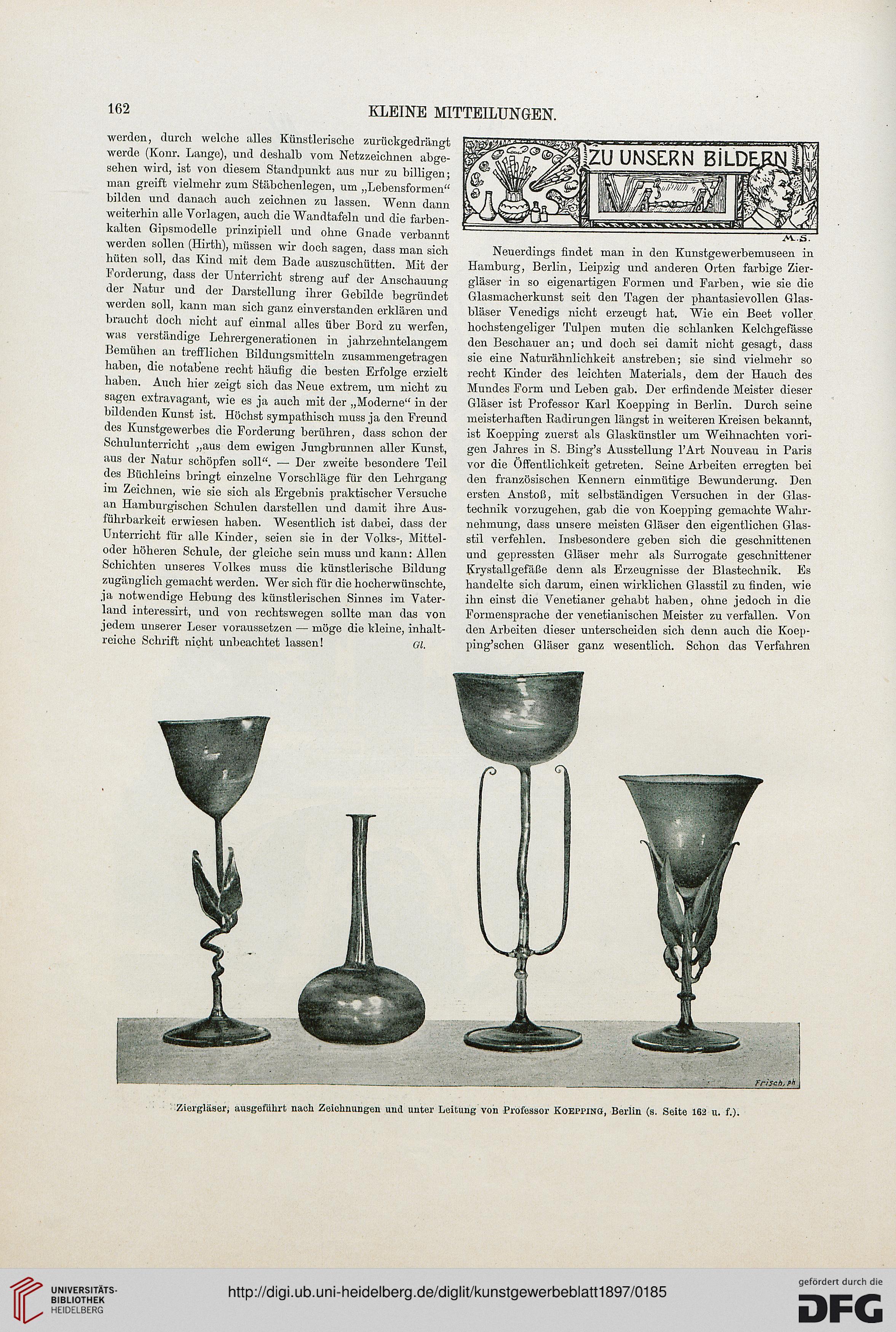162
KLEINE MITTEILUNGEN.
werden, durch welche alles Künstlerische zurückgedrängt
werde (Konr. Lange), und deshalb vom Netzzeichnen abge-
sehen wird, ist von diesem Standpunkt aus nur zu billigen;
man greift vielmehr zum Stäbchenlegen, um „Lehensformen"
bilden und danach auch zeichnen zu lassen. Wenn dann
weiterhin alle Vorlagen, auch die Wandtafeln und die farben-
kalten Gipsmodelle prinzipiell und ohne Gnade verbannt
werden sollen (Hirth), müssen wir doch sagen, dass man sich
hüten soll, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mit der
Forderung, dass der Unterricht streng auf der Anschauung
der Natur und der Darstellung ihrer Gebilde begründet
werden soll, kann man sich ganz einverstanden erklären und
braucht doch nicht auf einmal alles über Bord zu werfen,
was verständige Lehrergenerationen in jahrzehntelangem
Bemühen an trefflichen Bildungsmitteln zusammengetragen
haben, die notab'ene recht häufig die besten Erfolge erzielt
haben. Auch hier zeigt sich das Neue extrem, um nicht zu
sagen extravagant, wie es ja auch mit der „Moderne" in der
bildenden Kunst ist. Höchst sympathisch muss ja den Freund
des Kunstgewerbes die Forderung berühren, dass schon der
Schulunterricht „aus dem ewigen Jungbrunnen aller Kunst,
aus der Natur schöpfen soll". — Der zweite besondere Teil
des Büchleins bringt einzelne Vorschläge für den Lehrgang
im Zeichnen, wie sie sich als Ergebnis praktischer Versuche
an Hamburgischen Schulen darstellen und damit ihre Aus-
führbarkeit erwiesen haben. Wesentlich ist dabei, dass der
Unterricht für alle Kinder, seien sie in der Volks-, Mittel-
oder höheren Schule, der gleiche sein muss und kann: Allen
Schichten unseres Volkes muss die künstlerische Bildung
zugänglich gemacht werden. Wer sich für die hocherwünschte,
ja notwendige Hebung des künstlerischen Sinnes im Vater-
land interessirt, und von rechtswegen sollte man das von
jedem unserer Leser voraussetzen — möge die kleine, inhalt-
reicho Schrift nicht unbeachtet lassen! Ol.
Neuerdings findet man in den Kunstgewerbemuseen in
Hamburg, Berlin, Leipzig und anderen Orten farbige Zier-
gläser in so eigenartigen Formen und Farben, wie sie die
Glasmacherkunst seit den Tagen der phantasievollen Glas-
bläser Venedigs nicht erzeugt hat. Wie ein Beet voller
hochstengoliger Tulpen muten die schlanken Kelchgof'ässe
den Beschauer an; und doch sei damit nicht gesagt, dass
sie eine Naturähnlichkeit anstreben; sie sind vielmehr so
recht Kinder des leichten Materials, dem der Hauch des
Mundes Form und Leben gab. Der erfindende Meister dieser
Gläser ist Professor Karl Koepping in Berlin. Durch seine
meisterhaften Kadirungen längst in weiteren Kreisen bekannt,
ist Koepping zuerst als Glaskünstler um Weihnachten vori-
gen Jahres in S. Bing's Ausstellung l'Art Nouveau in Paris
vor die Öffentlichkeit getreten. Seine Arbeiten erregten bei
den französischen Kennern einmütige Bewunderung. Den
ersten Anstoß, mit selbständigen Vorsuchen in der Glas-
technik vorzugehen, gab die von Koepping gemachte Wahr-
nehmung, dass unsere meisten Gläser den eigentlichen Glas-
stil verfehlen. Insbesondere geben sich die geschnittenen
und gepressten Gläser mehr als Surrogate geschnittener
Krystallgefäße denn als Erzeugnisse der Blastechnik. Es
handelte sich darum, einen wirklichen Glasstil zu finden, wie
ihn einst die Venetianer gehabt haben, ohne jedoch in die
Formensprache der venetianischon Meister zu verfallen. Von
den Arbeiten dieser unterscheiden sich denn auch die Koep-
ping'schen Gläser ganz wesentlich. Schon das Verfahren
frisch, r*
Ziergläser; ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepi-ino, Berlin (s. Seite 162 u. f.).
KLEINE MITTEILUNGEN.
werden, durch welche alles Künstlerische zurückgedrängt
werde (Konr. Lange), und deshalb vom Netzzeichnen abge-
sehen wird, ist von diesem Standpunkt aus nur zu billigen;
man greift vielmehr zum Stäbchenlegen, um „Lehensformen"
bilden und danach auch zeichnen zu lassen. Wenn dann
weiterhin alle Vorlagen, auch die Wandtafeln und die farben-
kalten Gipsmodelle prinzipiell und ohne Gnade verbannt
werden sollen (Hirth), müssen wir doch sagen, dass man sich
hüten soll, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mit der
Forderung, dass der Unterricht streng auf der Anschauung
der Natur und der Darstellung ihrer Gebilde begründet
werden soll, kann man sich ganz einverstanden erklären und
braucht doch nicht auf einmal alles über Bord zu werfen,
was verständige Lehrergenerationen in jahrzehntelangem
Bemühen an trefflichen Bildungsmitteln zusammengetragen
haben, die notab'ene recht häufig die besten Erfolge erzielt
haben. Auch hier zeigt sich das Neue extrem, um nicht zu
sagen extravagant, wie es ja auch mit der „Moderne" in der
bildenden Kunst ist. Höchst sympathisch muss ja den Freund
des Kunstgewerbes die Forderung berühren, dass schon der
Schulunterricht „aus dem ewigen Jungbrunnen aller Kunst,
aus der Natur schöpfen soll". — Der zweite besondere Teil
des Büchleins bringt einzelne Vorschläge für den Lehrgang
im Zeichnen, wie sie sich als Ergebnis praktischer Versuche
an Hamburgischen Schulen darstellen und damit ihre Aus-
führbarkeit erwiesen haben. Wesentlich ist dabei, dass der
Unterricht für alle Kinder, seien sie in der Volks-, Mittel-
oder höheren Schule, der gleiche sein muss und kann: Allen
Schichten unseres Volkes muss die künstlerische Bildung
zugänglich gemacht werden. Wer sich für die hocherwünschte,
ja notwendige Hebung des künstlerischen Sinnes im Vater-
land interessirt, und von rechtswegen sollte man das von
jedem unserer Leser voraussetzen — möge die kleine, inhalt-
reicho Schrift nicht unbeachtet lassen! Ol.
Neuerdings findet man in den Kunstgewerbemuseen in
Hamburg, Berlin, Leipzig und anderen Orten farbige Zier-
gläser in so eigenartigen Formen und Farben, wie sie die
Glasmacherkunst seit den Tagen der phantasievollen Glas-
bläser Venedigs nicht erzeugt hat. Wie ein Beet voller
hochstengoliger Tulpen muten die schlanken Kelchgof'ässe
den Beschauer an; und doch sei damit nicht gesagt, dass
sie eine Naturähnlichkeit anstreben; sie sind vielmehr so
recht Kinder des leichten Materials, dem der Hauch des
Mundes Form und Leben gab. Der erfindende Meister dieser
Gläser ist Professor Karl Koepping in Berlin. Durch seine
meisterhaften Kadirungen längst in weiteren Kreisen bekannt,
ist Koepping zuerst als Glaskünstler um Weihnachten vori-
gen Jahres in S. Bing's Ausstellung l'Art Nouveau in Paris
vor die Öffentlichkeit getreten. Seine Arbeiten erregten bei
den französischen Kennern einmütige Bewunderung. Den
ersten Anstoß, mit selbständigen Vorsuchen in der Glas-
technik vorzugehen, gab die von Koepping gemachte Wahr-
nehmung, dass unsere meisten Gläser den eigentlichen Glas-
stil verfehlen. Insbesondere geben sich die geschnittenen
und gepressten Gläser mehr als Surrogate geschnittener
Krystallgefäße denn als Erzeugnisse der Blastechnik. Es
handelte sich darum, einen wirklichen Glasstil zu finden, wie
ihn einst die Venetianer gehabt haben, ohne jedoch in die
Formensprache der venetianischon Meister zu verfallen. Von
den Arbeiten dieser unterscheiden sich denn auch die Koep-
ping'schen Gläser ganz wesentlich. Schon das Verfahren
frisch, r*
Ziergläser; ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepi-ino, Berlin (s. Seite 162 u. f.).