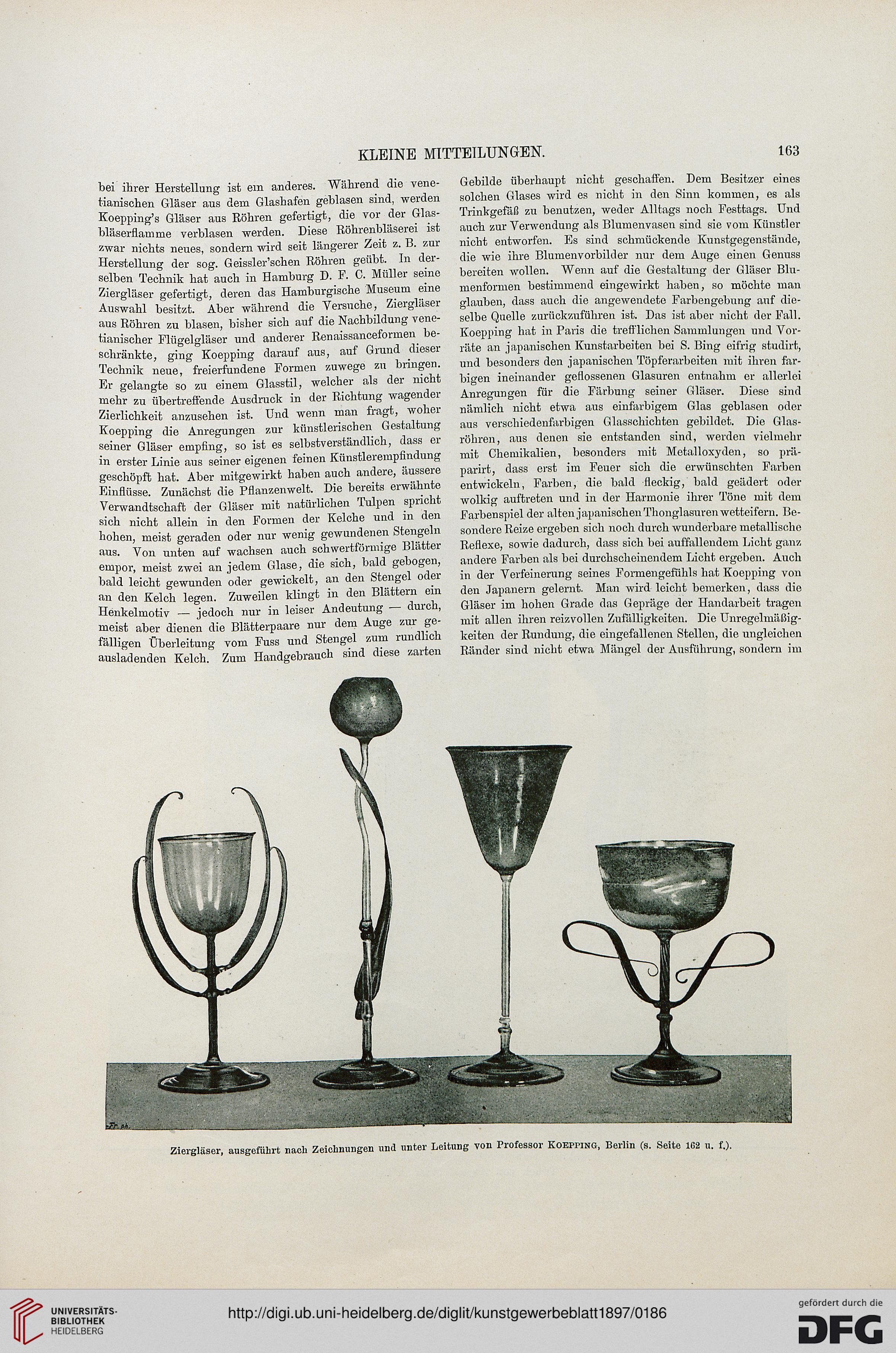KLEINE MITTEILUNGEN.
163
bei ihrer Herstellung ist ein anderes. Während die vene-
tianischen Gläser aus dem Glashafen geblasen sind, werden
Koepping's Gläser aus Röhren gefertigt, die vor der Glas-
bläserflamme Verblasen werden. Diese Röhrenbläserei ist
zwar nichts neues, sondern wird seit längerer Zeit z. B. zur
Herstellung der sog. Geissler'sohen Röhren geübt. In der-
selben Technik hat auch in Hamburg D. F. C. Müller seine
Ziergläser gefertigt, deren das Hamburgische Museum eine
Auswahl besitzt. Aber während die Versuche, Zierglaser
aus Röhren zu blasen, bisher sich auf die Nachbildung vene-
tianischer Flügelgläser und anderer Renaissanceformen be-
schränkte, ging Koepping darauf aus, auf Grund dieser
Technik neue, freierfundene Formen zuwege zu bringen.
Er gelangte so zu einem Glasstil, welcher als der nicht
mehr zu übertreffende Ausdruck in der Richtung wagender
Zierlichkeit anzusehen ist. Und wenn man fragt, woher
Koepping die Anregungen zur künstlerischen Gestaltung
seiner Gläser empfing, so ist es selbstverständlich, dass er
in erster Linie aus seiner eigenen feinen Künstlerempfindung
geschöpft hat. Aber mitgewirkt haben auch andere, äussere
Einflüsse. Zunächst die Pflanzenwelt. Die bereits erwähnte
Verwandtschaft der Gläser mit natürlichen Tulpen spricht
sich nicht allein in den Formen der Kelche und in den
hohen, meist geraden oder nur wenig gewundenen Stengeln
aus. Von unten auf wachsen auch schwertförmige Blatter
empor, meist zwei an jedem Glase, die sich, bald gebogen,
bald leicht gewunden oder gewickelt, an den Stengel oder
an den Kelch legen. Zuweilen klingt in den Blättern ein
Henkelmotiv — jedoch nur in leiser Andeutung - durch,
meist aber dienen die Blätterpaare nur dem Auge zur ge-
fälligen Überleitung vom Fuss und Stengel zum rundlich
ausladenden Kelch. Zum Handgebrauch sind diese zarten
Gebilde überhaupt nicht geschaffen. Dem Besitzer eines
solchen Glases wird es nicht in den Sinn kommen, es als
Trinkgefäß zu benutzen, weder Alltags noch Festtags. Und
auch zur Verwendung als Blumenvasen sind sie vom Künstler
nicht entworfen. Es sind schmückende Kunstgegenstände,
die wie ihre Blumenvorbilder nur dem Auge einen Gennss
bereiten wollen. Wenn auf die Gestaltung der Gläser Blu-
menformen bestimmend eingewirkt haben, so möchte man
glauben, dass auch die angewendete Farbengebung auf die-
selbe Quelle zurückzuführen ist. Das ist aber nicht der Fall.
Koepping hat in Paris die trefflichen Sammlungen und Vor-
räte an japanischen Kunstarbeiten bei S. Bing eifrig studirt,
und besonders den japanischen Töpferarbeiten mit ihren far-
bigen ineinander geflossenen Glasuren entnahm er allerlei
Anregungen für die Färbung seiner Gläser. Diese sind
nämlich nicht etwa aus einfarbigem Glas geblasen oder
aus verschiedenfarbigen Glasschichten gebildet. Die Glas-
röhren, aus denen sie entstanden sind, werden vielmehr
mit Chemikalien, besonders mit Metalloxyden, so prä-
parirt, dass erst im Feuer sich die erwünschten Farben
entwickeln, Farben, die bald fleckig, bald geädert oder
wolkig auftreten und in der Harmonie ihrer Töne mit dem
Farbenspiel der alten japanischen Thonglasurcn wetteifern. Be-
sondere Reize ergeben sich noch durch wunderbare metallische
Reflexe, sowie dadurch, dass sich bei auffallendem Licht ganz
andere Farben als bei durchscheinendem Licht ergeben. Auch
in der Verfeinerung seines Formengefühls hat Koepping von
den Japanern gelernt. Man wird leicht bemerken, dass die
Gläser im hohen Grade das Gepräge der Handarbeit tragen
mit allen ihren reizvollen Zufälligkeiten. Die Unregelmäßig-
keiten der Rundung, die eingefallenen Stellen, die ungleichen
Bänder sind nicht etwa Mängel der Ausführung, sondern im
fc&j>*.
Zlerglfiser, ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepping, Berlin (s. Seite 168 u. f.).
163
bei ihrer Herstellung ist ein anderes. Während die vene-
tianischen Gläser aus dem Glashafen geblasen sind, werden
Koepping's Gläser aus Röhren gefertigt, die vor der Glas-
bläserflamme Verblasen werden. Diese Röhrenbläserei ist
zwar nichts neues, sondern wird seit längerer Zeit z. B. zur
Herstellung der sog. Geissler'sohen Röhren geübt. In der-
selben Technik hat auch in Hamburg D. F. C. Müller seine
Ziergläser gefertigt, deren das Hamburgische Museum eine
Auswahl besitzt. Aber während die Versuche, Zierglaser
aus Röhren zu blasen, bisher sich auf die Nachbildung vene-
tianischer Flügelgläser und anderer Renaissanceformen be-
schränkte, ging Koepping darauf aus, auf Grund dieser
Technik neue, freierfundene Formen zuwege zu bringen.
Er gelangte so zu einem Glasstil, welcher als der nicht
mehr zu übertreffende Ausdruck in der Richtung wagender
Zierlichkeit anzusehen ist. Und wenn man fragt, woher
Koepping die Anregungen zur künstlerischen Gestaltung
seiner Gläser empfing, so ist es selbstverständlich, dass er
in erster Linie aus seiner eigenen feinen Künstlerempfindung
geschöpft hat. Aber mitgewirkt haben auch andere, äussere
Einflüsse. Zunächst die Pflanzenwelt. Die bereits erwähnte
Verwandtschaft der Gläser mit natürlichen Tulpen spricht
sich nicht allein in den Formen der Kelche und in den
hohen, meist geraden oder nur wenig gewundenen Stengeln
aus. Von unten auf wachsen auch schwertförmige Blatter
empor, meist zwei an jedem Glase, die sich, bald gebogen,
bald leicht gewunden oder gewickelt, an den Stengel oder
an den Kelch legen. Zuweilen klingt in den Blättern ein
Henkelmotiv — jedoch nur in leiser Andeutung - durch,
meist aber dienen die Blätterpaare nur dem Auge zur ge-
fälligen Überleitung vom Fuss und Stengel zum rundlich
ausladenden Kelch. Zum Handgebrauch sind diese zarten
Gebilde überhaupt nicht geschaffen. Dem Besitzer eines
solchen Glases wird es nicht in den Sinn kommen, es als
Trinkgefäß zu benutzen, weder Alltags noch Festtags. Und
auch zur Verwendung als Blumenvasen sind sie vom Künstler
nicht entworfen. Es sind schmückende Kunstgegenstände,
die wie ihre Blumenvorbilder nur dem Auge einen Gennss
bereiten wollen. Wenn auf die Gestaltung der Gläser Blu-
menformen bestimmend eingewirkt haben, so möchte man
glauben, dass auch die angewendete Farbengebung auf die-
selbe Quelle zurückzuführen ist. Das ist aber nicht der Fall.
Koepping hat in Paris die trefflichen Sammlungen und Vor-
räte an japanischen Kunstarbeiten bei S. Bing eifrig studirt,
und besonders den japanischen Töpferarbeiten mit ihren far-
bigen ineinander geflossenen Glasuren entnahm er allerlei
Anregungen für die Färbung seiner Gläser. Diese sind
nämlich nicht etwa aus einfarbigem Glas geblasen oder
aus verschiedenfarbigen Glasschichten gebildet. Die Glas-
röhren, aus denen sie entstanden sind, werden vielmehr
mit Chemikalien, besonders mit Metalloxyden, so prä-
parirt, dass erst im Feuer sich die erwünschten Farben
entwickeln, Farben, die bald fleckig, bald geädert oder
wolkig auftreten und in der Harmonie ihrer Töne mit dem
Farbenspiel der alten japanischen Thonglasurcn wetteifern. Be-
sondere Reize ergeben sich noch durch wunderbare metallische
Reflexe, sowie dadurch, dass sich bei auffallendem Licht ganz
andere Farben als bei durchscheinendem Licht ergeben. Auch
in der Verfeinerung seines Formengefühls hat Koepping von
den Japanern gelernt. Man wird leicht bemerken, dass die
Gläser im hohen Grade das Gepräge der Handarbeit tragen
mit allen ihren reizvollen Zufälligkeiten. Die Unregelmäßig-
keiten der Rundung, die eingefallenen Stellen, die ungleichen
Bänder sind nicht etwa Mängel der Ausführung, sondern im
fc&j>*.
Zlerglfiser, ausgeführt nach Zeichnungen und unter Leitung von Professor Koepping, Berlin (s. Seite 168 u. f.).