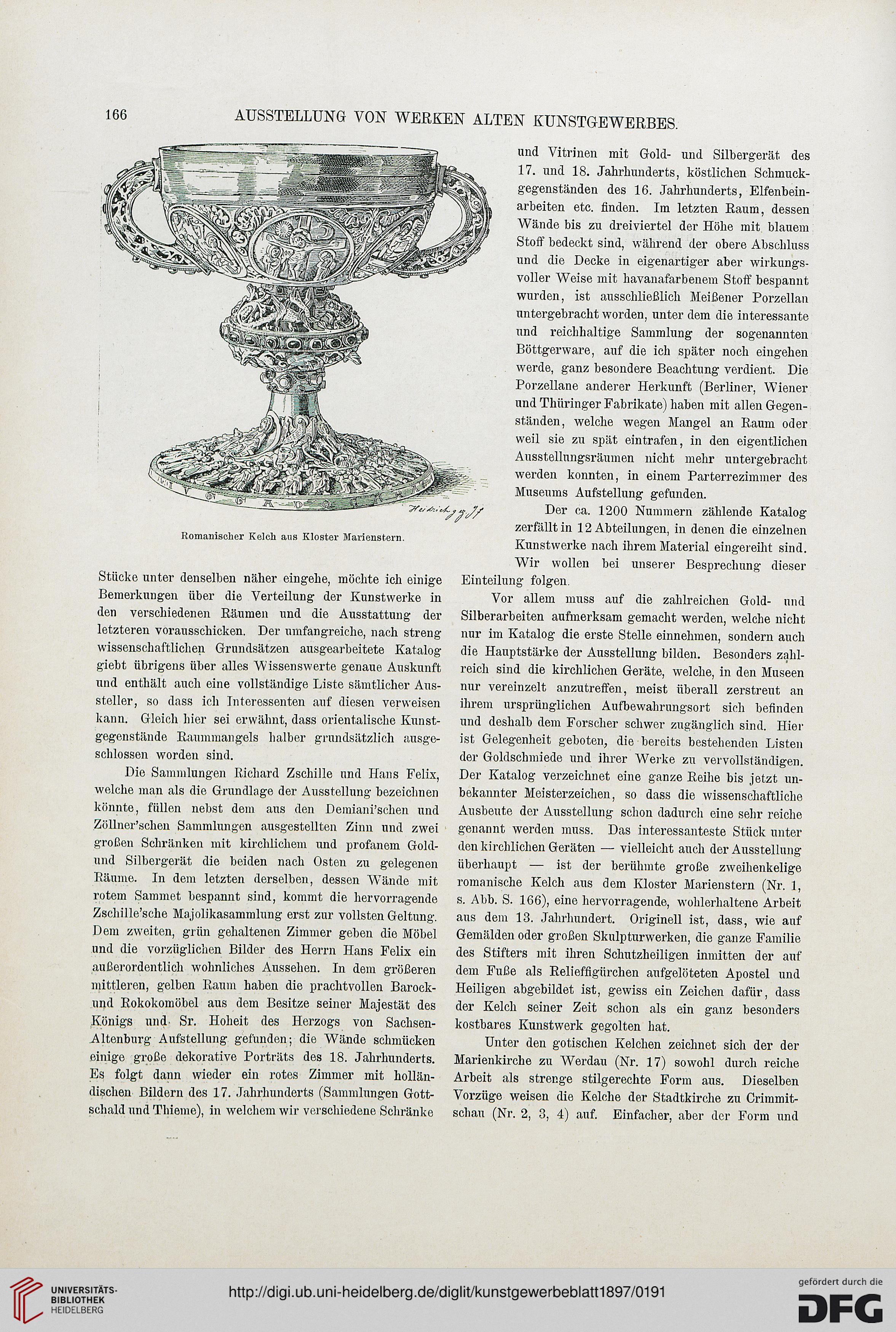166
AUSSTELLUNG VON WERKEN ALTEN KUNSTGEWERBES.
v?*/
Romanischer Kelch ans Kloster Marienstern.
Stücke unter denselben näher eingehe, möchte ich einige
Bemerkungen über die Verteilung der Kunstwerke in
den verschiedenen Säumen und die Ausstattung der
letzteren vorausschicken. Der umfangreiche, nach streng
wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitete Katalog
giebt übrigens über alles Wissenswerte genaue Auskunft
und enthält auch eine vollständige Liste sämtlicher Aus-
steller, so dass ich Interessenten auf diesen verweisen
kann. Gleich hier sei erwähnt, dass orientalische Kunst-
gegenstände Eaumniangels halber grundsätzlich ausge-
schlossen worden sind.
Die Sammlungen Richard Zschille und Hans Felix,
welche man als die Grundlage der Ausstellung bezeichnen
könnte, füllen nebst dem aus den Demiani'schen und
ZöUner'schen Sammlungen ausgestellten Zinn und zwei
großen Schränken mit kirchlichem und profanem Gold-
und Silbergerät die beiden nach Osten zu gelegenen
Bäume. In dem letzten derselben, dessen Wände mit
rotem Sammet bespannt sind, kommt die hervorragende
Zschille'sche Majolikasammlung erst zur vollsten Geltung.
Dem zweiten, grün gehaltenen Zimmer geben die Möbel
und die vorzüglichen Bilder des Herrn Hans Felix ein
außerordentlich wohnliches Aussehen. In dem größeren
mittleren, gelben Kaum haben die prachtvollen Barock-
und Kokokomöbel aus dem Besitze seiner Majestät des
Königs und- Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-
Altenburg Aufstellung gefunden; die Wände schmücken
einige große dekorative Porträts des 18. Jahrhunderts.
Es folgt dann wieder ein rotes Zimmer mit, hollän-
dischen Bildern des 17. Jahrhunderts (Sammlungen Gott-
schald und Thieme), in welchem wir verschiedene Schränke
und Vitrinen mit Gold- und Silbergerät des
17. und 18. Jahrhunderts, köstlichen Schmuck-
gegenständen des 16. Jahrhunderts, Elfenbein-
arbeiten etc. finden. Im letzten Eaum, dessen
Wände bis zu dreiviertel der Höhe mit blauem
Stoff bedeckt sind, während der obere Abschluss
und die Decke in eigenartiger aber wirkungs-
voller Weise mit havanafarbenem Stoff bespannt
wurden, ist ausschließlich Meißener Porzellan
untergebracht worden, unter dem die interessante
und reichhaltige Sammlung der sogenannten
Böttgerware, auf die icli später noch eingehen
werde, ganz besondere Beachtung verdient. Die
Porzellane anderer Herkunft (Berliner, Wiener
und Thüringer Fabrikate) haben mit allen Gegen-
ständen, welche wegen Mangel an Eaum oder
weil sie zu spät eintrafen, in den eigentlichen
Ausstellungsräumen nicht mehr untergebracht
werden konnten, in einem Parterrezimmer des
Museums Aufstellung gefunden.
Der ca. 1200 Nummern zählende Katalog
zerfällt in 12 Abteilungen, in denen die einzelnen
Kunstwerke nach ihrem Material eingereiht sind.
Wir wollen bei unserer Besprechung dieser
Einteilung folgen.
Vor allem muss auf die zahlreichen Gold- und
Silberarbeiten aufmerksam gemacht werden, welche nicht
nur im Katalog die erste Stelle einnehmen, sondern auch
die Hauptstärke der Ausstellung bilden. Besonders zahl-
reich sind die kirchlichen Geräte, welche, in den Museen
nur vereinzelt anzutreffen, meist überall zerstreut an
ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort sich befinden
und deshalb dem Forscher schwer zugänglich sind. Hier
ist Gelegenheit geboten, die bereits bestehenden Listen
der Goldschmiede und ihrer Werke zu vervollständigen.
Der Katalog verzeichnet eine ganze Eeihe bis jetzt un-
bekannter Meisterzeichen, so dass die wissenschaftliche
Ausbeute der Ausstellung schon dadurch eine sehr reiche
genannt werden muss. Das interessanteste Stück unter
den kirchlichen Geräten — vielleicht auch der Ausstellung
überhaupt — ist der berühmte große zweihenkelige
romanische Kelch aus dem Kloster Marienstern (Nr. 1,
s. Abb. S. 166), eine hervorragende, wohlerhaltene Arbeit
aus dem 13. Jahrhundert. Originell ist, dass, wie auf
Gemälden oder großen Skulpturwerken, die ganze Familie
des Stifters mit ihren Schutzheiligen inmitten der auf
dem Fuße als Eelieffigürchen aufgelöteten Apostel und
Heiligen abgebildet ist, gewiss ein Zeichen dafür, dass
der Kelch seiner Zeit schon als ein ganz besonders
kostbares Kunstwerk gegolten hat.
Unter den gotischen Kelchen zeichnet sich der der
Marienkirche zu Werdau (Nr. 17) sowohl durch reiche
Arbeit als strenge stilgerechte Form aus. Dieselben
Vorzüge weisen die Kelche der Stadtkirche zu Crimmit-
schau (Nr. 2, 3, 4) auf. Einfacher, aber der Form und
AUSSTELLUNG VON WERKEN ALTEN KUNSTGEWERBES.
v?*/
Romanischer Kelch ans Kloster Marienstern.
Stücke unter denselben näher eingehe, möchte ich einige
Bemerkungen über die Verteilung der Kunstwerke in
den verschiedenen Säumen und die Ausstattung der
letzteren vorausschicken. Der umfangreiche, nach streng
wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitete Katalog
giebt übrigens über alles Wissenswerte genaue Auskunft
und enthält auch eine vollständige Liste sämtlicher Aus-
steller, so dass ich Interessenten auf diesen verweisen
kann. Gleich hier sei erwähnt, dass orientalische Kunst-
gegenstände Eaumniangels halber grundsätzlich ausge-
schlossen worden sind.
Die Sammlungen Richard Zschille und Hans Felix,
welche man als die Grundlage der Ausstellung bezeichnen
könnte, füllen nebst dem aus den Demiani'schen und
ZöUner'schen Sammlungen ausgestellten Zinn und zwei
großen Schränken mit kirchlichem und profanem Gold-
und Silbergerät die beiden nach Osten zu gelegenen
Bäume. In dem letzten derselben, dessen Wände mit
rotem Sammet bespannt sind, kommt die hervorragende
Zschille'sche Majolikasammlung erst zur vollsten Geltung.
Dem zweiten, grün gehaltenen Zimmer geben die Möbel
und die vorzüglichen Bilder des Herrn Hans Felix ein
außerordentlich wohnliches Aussehen. In dem größeren
mittleren, gelben Kaum haben die prachtvollen Barock-
und Kokokomöbel aus dem Besitze seiner Majestät des
Königs und- Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-
Altenburg Aufstellung gefunden; die Wände schmücken
einige große dekorative Porträts des 18. Jahrhunderts.
Es folgt dann wieder ein rotes Zimmer mit, hollän-
dischen Bildern des 17. Jahrhunderts (Sammlungen Gott-
schald und Thieme), in welchem wir verschiedene Schränke
und Vitrinen mit Gold- und Silbergerät des
17. und 18. Jahrhunderts, köstlichen Schmuck-
gegenständen des 16. Jahrhunderts, Elfenbein-
arbeiten etc. finden. Im letzten Eaum, dessen
Wände bis zu dreiviertel der Höhe mit blauem
Stoff bedeckt sind, während der obere Abschluss
und die Decke in eigenartiger aber wirkungs-
voller Weise mit havanafarbenem Stoff bespannt
wurden, ist ausschließlich Meißener Porzellan
untergebracht worden, unter dem die interessante
und reichhaltige Sammlung der sogenannten
Böttgerware, auf die icli später noch eingehen
werde, ganz besondere Beachtung verdient. Die
Porzellane anderer Herkunft (Berliner, Wiener
und Thüringer Fabrikate) haben mit allen Gegen-
ständen, welche wegen Mangel an Eaum oder
weil sie zu spät eintrafen, in den eigentlichen
Ausstellungsräumen nicht mehr untergebracht
werden konnten, in einem Parterrezimmer des
Museums Aufstellung gefunden.
Der ca. 1200 Nummern zählende Katalog
zerfällt in 12 Abteilungen, in denen die einzelnen
Kunstwerke nach ihrem Material eingereiht sind.
Wir wollen bei unserer Besprechung dieser
Einteilung folgen.
Vor allem muss auf die zahlreichen Gold- und
Silberarbeiten aufmerksam gemacht werden, welche nicht
nur im Katalog die erste Stelle einnehmen, sondern auch
die Hauptstärke der Ausstellung bilden. Besonders zahl-
reich sind die kirchlichen Geräte, welche, in den Museen
nur vereinzelt anzutreffen, meist überall zerstreut an
ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort sich befinden
und deshalb dem Forscher schwer zugänglich sind. Hier
ist Gelegenheit geboten, die bereits bestehenden Listen
der Goldschmiede und ihrer Werke zu vervollständigen.
Der Katalog verzeichnet eine ganze Eeihe bis jetzt un-
bekannter Meisterzeichen, so dass die wissenschaftliche
Ausbeute der Ausstellung schon dadurch eine sehr reiche
genannt werden muss. Das interessanteste Stück unter
den kirchlichen Geräten — vielleicht auch der Ausstellung
überhaupt — ist der berühmte große zweihenkelige
romanische Kelch aus dem Kloster Marienstern (Nr. 1,
s. Abb. S. 166), eine hervorragende, wohlerhaltene Arbeit
aus dem 13. Jahrhundert. Originell ist, dass, wie auf
Gemälden oder großen Skulpturwerken, die ganze Familie
des Stifters mit ihren Schutzheiligen inmitten der auf
dem Fuße als Eelieffigürchen aufgelöteten Apostel und
Heiligen abgebildet ist, gewiss ein Zeichen dafür, dass
der Kelch seiner Zeit schon als ein ganz besonders
kostbares Kunstwerk gegolten hat.
Unter den gotischen Kelchen zeichnet sich der der
Marienkirche zu Werdau (Nr. 17) sowohl durch reiche
Arbeit als strenge stilgerechte Form aus. Dieselben
Vorzüge weisen die Kelche der Stadtkirche zu Crimmit-
schau (Nr. 2, 3, 4) auf. Einfacher, aber der Form und