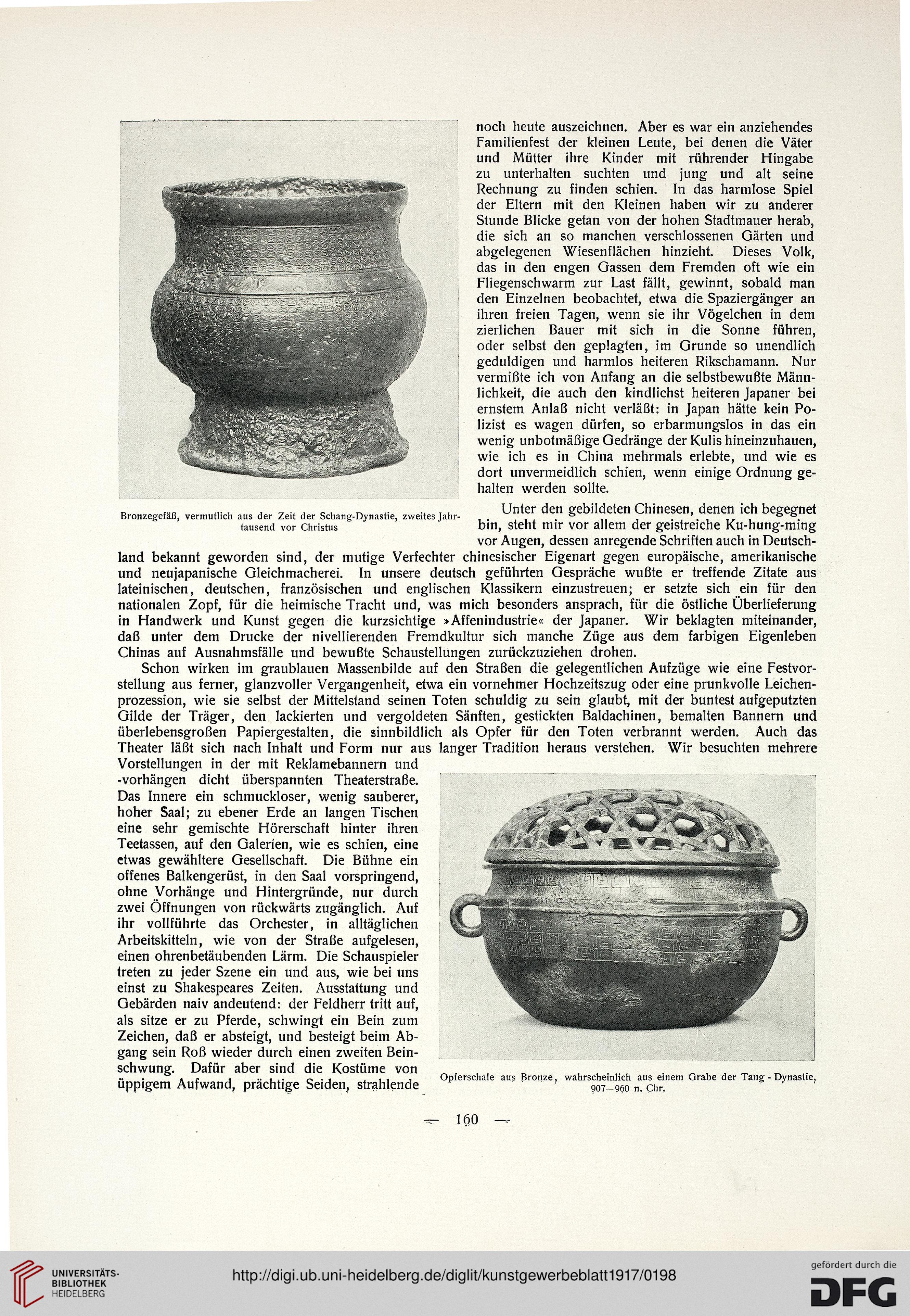Bronzegefäß, vermutlich aus der Zeit der Schang-Dynastie, zweites Jahr
tausend vor Christus
noch heute auszeichnen. Aber es war ein anziehendes
Familienfest der kleinen Leute, bei denen die Väter
und Mütter ihre Kinder mit rührender Hingabe
zu unterhalten suchten und jung und alt seine
Rechnung zu finden schien. In das harmlose Spiel
der Eltern mit den Kleinen haben wir zu anderer
Stunde Blicke getan von der hohen Stadtmauer herab,
die sich an so manchen verschlossenen Gärten und
abgelegenen Wiesenflächen hinzieht. Dieses Volk,
das in den engen Gassen dem Fremden oft wie ein
Fliegenschwarm zur Last fällt, gewinnt, sobald man
den Einzelnen beobachtet, etwa die Spaziergänger an
ihren freien Tagen, wenn sie ihr Vögelchen in dem
zierlichen Bauer mit sich in die Sonne führen,
oder selbst den geplagten, im Grunde so unendlich
geduldigen und harmlos heiteren Rikschamann. Nur
vermißte ich von Anfang an die selbstbewußte Männ-
lichkeit, die auch den kindlichst heiteren Japaner bei
ernstem Anlaß nicht verläßt: in Japan hätte kein Po-
lizist es wagen dürfen, so erbarmungslos in das ein
wenig unbotmäßige Gedränge der Kulis hineinzuhauen,
wie ich es in China mehrmals erlebte, und wie es
dort unvermeidlich schien, wenn einige Ordnung ge-
halten werden sollte.
Unter den gebildeten Chinesen, denen ich begegnet
bin, steht mir vor allem der geistreiche Ku-hung-ming
vor Augen, dessen anregende Schriften auch in Deutsch-
land bekannt geworden sind, der mutige Verfechter chinesischer Eigenart gegen europäische, amerikanische
und neujapanische Gleichmacherei. In unsere deutsch geführten Gespräche wußte er treffende Zitate aus
lateinischen, deutschen, französischen und englischen Klassikern einzustreuen; er setzte sich ein für den
nationalen Zopf, für die heimische Tracht und, was mich besonders ansprach, für die östliche Überlieferung
in Handwerk und Kunst gegen die kurzsichtige »Affenindustrie« der Japaner. Wir beklagten miteinander,
daß unter dem Drucke der nivellierenden Fremdkultur sich manche Züge aus dem farbigen Eigenleben
Chinas auf Ausnahmsfälle und bewußte Schaustellungen zurückzuziehen drohen.
Schon wirken im graublauen Massenbilde auf den Straßen die gelegentlichen Aufzüge wie eine Festvor-
stellung aus ferner, glanzvoller Vergangenheit, etwa ein vornehmer Hochzeitszug oder eine prunkvolle Leichen-
prozession, wie sie selbst der Mittelstand seinen Toten schuldig zu sein glaubt, mit der buntest aufgeputzten
Gilde der Träger, den lackierten und vergoldeten Sänften, gestickten Baldachinen, bemalten Bannern und
überlebensgroßen Papiergestalten, die sinnbildlich als Opfer für den Toten verbrannt werden. Auch das
Theater läßt sich nach Inhalt und Form nur aus langer Tradition heraus verstehen. Wir besuchten mehrere
Vorstellungen in der mit Reklamebannern und
-vorhängen dicht überspannten Theaterstraße.
Das Innere ein schmuckloser, wenig sauberer,
hoher Saal; zu ebener Erde an langen Tischen
eine sehr gemischte Hörerschaft hinter ihren
Teetassen, auf den Galerien, wie es schien, eine
etwas gewähltere Gesellschaft. Die Bühne ein
offenes Balkengerüst, in den Saal vorspringend,
ohne Vorhänge und Hintergründe, nur durch
zwei Öffnungen von rückwärts zugänglich. Auf
ihr vollführte das Orchester, in alltäglichen
Arbeitskitteln, wie von der Straße aufgelesen,
einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Schauspieler
treten zu jeder Szene ein und aus, wie bei uns
einst zu Shakespeares Zeiten. Ausstattung und
Gebärden naiv andeutend: der Feldherr tritt auf,
als sitze er zu Pferde, schwingt ein Bein zum
Zeichen, daß er absteigt, und besteigt beim Ab-
gang sein Roß wieder durch einen zweiten Bein-
schwung. Dafür aber sind die Kostüme von
,. , ..... ■-.., ,11 , Opferschale aus Bronze, wahrscheinlich aus einem Grabe der Tang - Dynastie,
üppigem Aufwand, prachtige Seiden, strahlende 907-950 n. ehr,
T\
0m
«=- 160 —
tausend vor Christus
noch heute auszeichnen. Aber es war ein anziehendes
Familienfest der kleinen Leute, bei denen die Väter
und Mütter ihre Kinder mit rührender Hingabe
zu unterhalten suchten und jung und alt seine
Rechnung zu finden schien. In das harmlose Spiel
der Eltern mit den Kleinen haben wir zu anderer
Stunde Blicke getan von der hohen Stadtmauer herab,
die sich an so manchen verschlossenen Gärten und
abgelegenen Wiesenflächen hinzieht. Dieses Volk,
das in den engen Gassen dem Fremden oft wie ein
Fliegenschwarm zur Last fällt, gewinnt, sobald man
den Einzelnen beobachtet, etwa die Spaziergänger an
ihren freien Tagen, wenn sie ihr Vögelchen in dem
zierlichen Bauer mit sich in die Sonne führen,
oder selbst den geplagten, im Grunde so unendlich
geduldigen und harmlos heiteren Rikschamann. Nur
vermißte ich von Anfang an die selbstbewußte Männ-
lichkeit, die auch den kindlichst heiteren Japaner bei
ernstem Anlaß nicht verläßt: in Japan hätte kein Po-
lizist es wagen dürfen, so erbarmungslos in das ein
wenig unbotmäßige Gedränge der Kulis hineinzuhauen,
wie ich es in China mehrmals erlebte, und wie es
dort unvermeidlich schien, wenn einige Ordnung ge-
halten werden sollte.
Unter den gebildeten Chinesen, denen ich begegnet
bin, steht mir vor allem der geistreiche Ku-hung-ming
vor Augen, dessen anregende Schriften auch in Deutsch-
land bekannt geworden sind, der mutige Verfechter chinesischer Eigenart gegen europäische, amerikanische
und neujapanische Gleichmacherei. In unsere deutsch geführten Gespräche wußte er treffende Zitate aus
lateinischen, deutschen, französischen und englischen Klassikern einzustreuen; er setzte sich ein für den
nationalen Zopf, für die heimische Tracht und, was mich besonders ansprach, für die östliche Überlieferung
in Handwerk und Kunst gegen die kurzsichtige »Affenindustrie« der Japaner. Wir beklagten miteinander,
daß unter dem Drucke der nivellierenden Fremdkultur sich manche Züge aus dem farbigen Eigenleben
Chinas auf Ausnahmsfälle und bewußte Schaustellungen zurückzuziehen drohen.
Schon wirken im graublauen Massenbilde auf den Straßen die gelegentlichen Aufzüge wie eine Festvor-
stellung aus ferner, glanzvoller Vergangenheit, etwa ein vornehmer Hochzeitszug oder eine prunkvolle Leichen-
prozession, wie sie selbst der Mittelstand seinen Toten schuldig zu sein glaubt, mit der buntest aufgeputzten
Gilde der Träger, den lackierten und vergoldeten Sänften, gestickten Baldachinen, bemalten Bannern und
überlebensgroßen Papiergestalten, die sinnbildlich als Opfer für den Toten verbrannt werden. Auch das
Theater läßt sich nach Inhalt und Form nur aus langer Tradition heraus verstehen. Wir besuchten mehrere
Vorstellungen in der mit Reklamebannern und
-vorhängen dicht überspannten Theaterstraße.
Das Innere ein schmuckloser, wenig sauberer,
hoher Saal; zu ebener Erde an langen Tischen
eine sehr gemischte Hörerschaft hinter ihren
Teetassen, auf den Galerien, wie es schien, eine
etwas gewähltere Gesellschaft. Die Bühne ein
offenes Balkengerüst, in den Saal vorspringend,
ohne Vorhänge und Hintergründe, nur durch
zwei Öffnungen von rückwärts zugänglich. Auf
ihr vollführte das Orchester, in alltäglichen
Arbeitskitteln, wie von der Straße aufgelesen,
einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Schauspieler
treten zu jeder Szene ein und aus, wie bei uns
einst zu Shakespeares Zeiten. Ausstattung und
Gebärden naiv andeutend: der Feldherr tritt auf,
als sitze er zu Pferde, schwingt ein Bein zum
Zeichen, daß er absteigt, und besteigt beim Ab-
gang sein Roß wieder durch einen zweiten Bein-
schwung. Dafür aber sind die Kostüme von
,. , ..... ■-.., ,11 , Opferschale aus Bronze, wahrscheinlich aus einem Grabe der Tang - Dynastie,
üppigem Aufwand, prachtige Seiden, strahlende 907-950 n. ehr,
T\
0m
«=- 160 —