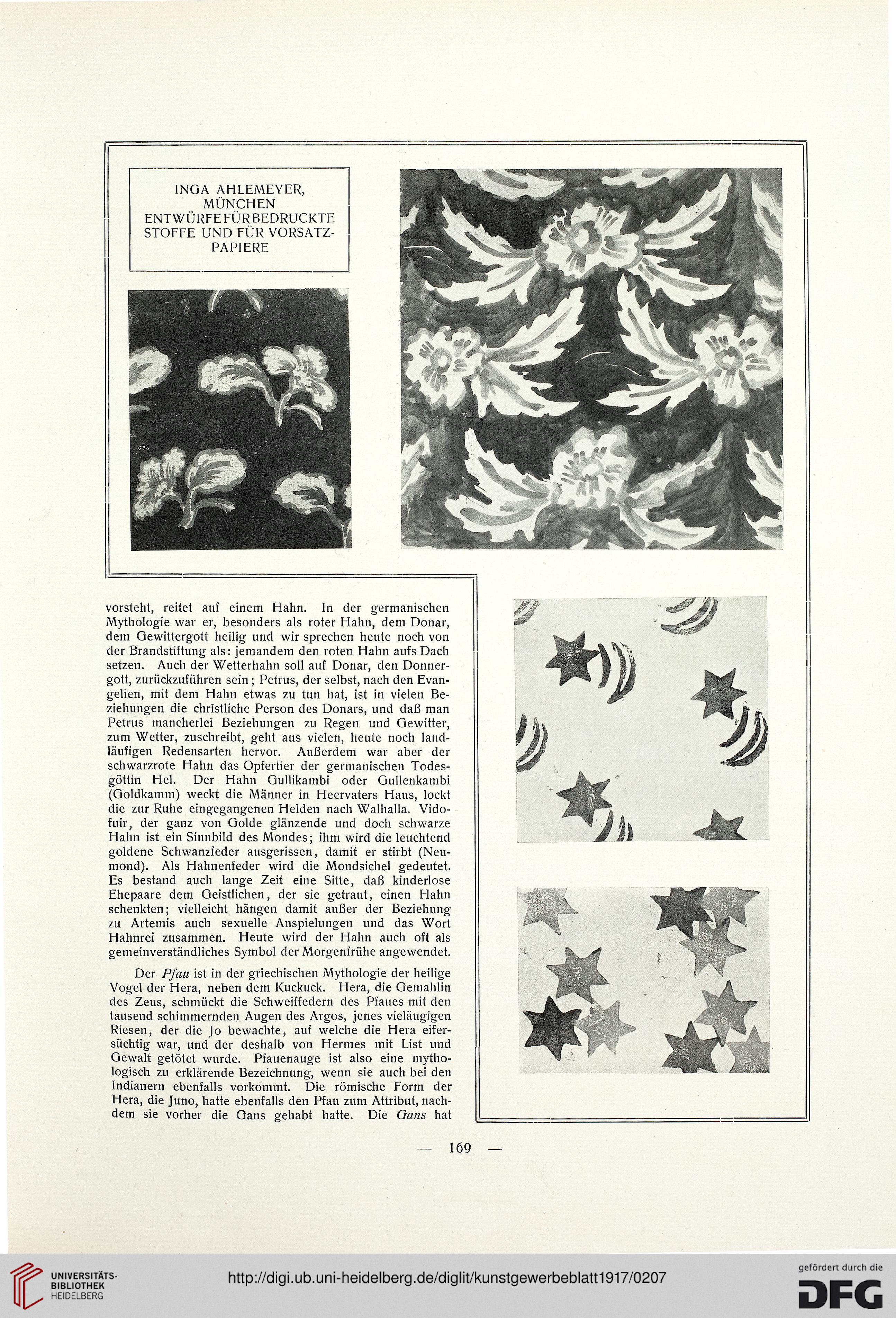INGA AHLEMEYER,
MÜNCHEN
ENTWÜRFE FÜRBEDRUCKTE
STOFFE UND FÜR VORSATZ-
PAPIERE
vorsteht, reitet auf einem Hahn. In der germanischen
Mythologie war er, besonders als roter Hahn, dem Donar,
dem Gewittergott heilig und wir sprechen heute noch von
der Brandstiftung als: jemandem den roten Hahn aufs Dach
setzen. Auch der Wetterhahn soll auf Donar, den Donner-
gott, zurückzuführen sein ; Petrus, der selbst, nach den Evan-
gelien, mit dem Hahn etwas zu tun hat, ist in vielen Be-
ziehungen die christliche Person des Donars, und daß man
Petrus mancherlei Beziehungen zu Regen und Gewitter,
zum Wetter, zuschreibt, geht aus vielen, heute noch land-
läufigen Redensarten hervor. Außerdem war aber der
schwarzrote Hahn das Opfertier der germanischen Todes-
göttin Hei. Der Hahn Gullikambi oder Gullenkambi
(Goldkamm) weckt die Männer in Heervaters Haus, lockt
die zur Ruhe eingegangenen Helden nach Walhalla. Vido-
fuir, der ganz von Golde glänzende und doch schwarze
Hahn ist ein Sinnbild des Mondes; ihm wird die leuchtend
goldene Schwanzfeder ausgerissen, damit er stirbt (Neu-
mond). Als Hahnenfeder wird die Mondsichel gedeutet.
Es bestand auch lange Zeit eine Sitte, daß kinderlose
Ehepaare dem Geistlichen, der sie getraut, einen Hahn
schenkten; vielleicht hängen damit außer der Beziehung
zu Artemis auch sexuelle Anspielungen und das Wort
Hahnrei zusammen. Heute wird der Hahn auch oft als
gemeinverständliches Symbol der Morgenfrühe angewendet.
Der Pfau ist in der griechischen Mythologie der heilige
Vogel der Hera, neben dem Kuckuck. Hera, die Gemahlin
des Zeus, schmückt die Schweiffedern des Pfaues mit den
tausend schimmernden Augen des Argos, jenes vieläugigen
Riesen, der die Jo bewachte, auf welche die Hera eifer-
süchtig war, und der deshalb von Hermes mit List und
Gewalt getötet wurde. Pfauenauge ist also eine mytho-
logisch zu erklärende Bezeichnung, wenn sie auch bei den
Indianern ebenfalls vorkommt. Die römische Form der
Hera, die Juno, hatte ebenfalls den Pfau zum Attribut, nach-
dem sie vorher die Gans gehabt hatte. Die Gans hat
169 —
MÜNCHEN
ENTWÜRFE FÜRBEDRUCKTE
STOFFE UND FÜR VORSATZ-
PAPIERE
vorsteht, reitet auf einem Hahn. In der germanischen
Mythologie war er, besonders als roter Hahn, dem Donar,
dem Gewittergott heilig und wir sprechen heute noch von
der Brandstiftung als: jemandem den roten Hahn aufs Dach
setzen. Auch der Wetterhahn soll auf Donar, den Donner-
gott, zurückzuführen sein ; Petrus, der selbst, nach den Evan-
gelien, mit dem Hahn etwas zu tun hat, ist in vielen Be-
ziehungen die christliche Person des Donars, und daß man
Petrus mancherlei Beziehungen zu Regen und Gewitter,
zum Wetter, zuschreibt, geht aus vielen, heute noch land-
läufigen Redensarten hervor. Außerdem war aber der
schwarzrote Hahn das Opfertier der germanischen Todes-
göttin Hei. Der Hahn Gullikambi oder Gullenkambi
(Goldkamm) weckt die Männer in Heervaters Haus, lockt
die zur Ruhe eingegangenen Helden nach Walhalla. Vido-
fuir, der ganz von Golde glänzende und doch schwarze
Hahn ist ein Sinnbild des Mondes; ihm wird die leuchtend
goldene Schwanzfeder ausgerissen, damit er stirbt (Neu-
mond). Als Hahnenfeder wird die Mondsichel gedeutet.
Es bestand auch lange Zeit eine Sitte, daß kinderlose
Ehepaare dem Geistlichen, der sie getraut, einen Hahn
schenkten; vielleicht hängen damit außer der Beziehung
zu Artemis auch sexuelle Anspielungen und das Wort
Hahnrei zusammen. Heute wird der Hahn auch oft als
gemeinverständliches Symbol der Morgenfrühe angewendet.
Der Pfau ist in der griechischen Mythologie der heilige
Vogel der Hera, neben dem Kuckuck. Hera, die Gemahlin
des Zeus, schmückt die Schweiffedern des Pfaues mit den
tausend schimmernden Augen des Argos, jenes vieläugigen
Riesen, der die Jo bewachte, auf welche die Hera eifer-
süchtig war, und der deshalb von Hermes mit List und
Gewalt getötet wurde. Pfauenauge ist also eine mytho-
logisch zu erklärende Bezeichnung, wenn sie auch bei den
Indianern ebenfalls vorkommt. Die römische Form der
Hera, die Juno, hatte ebenfalls den Pfau zum Attribut, nach-
dem sie vorher die Gans gehabt hatte. Die Gans hat
169 —