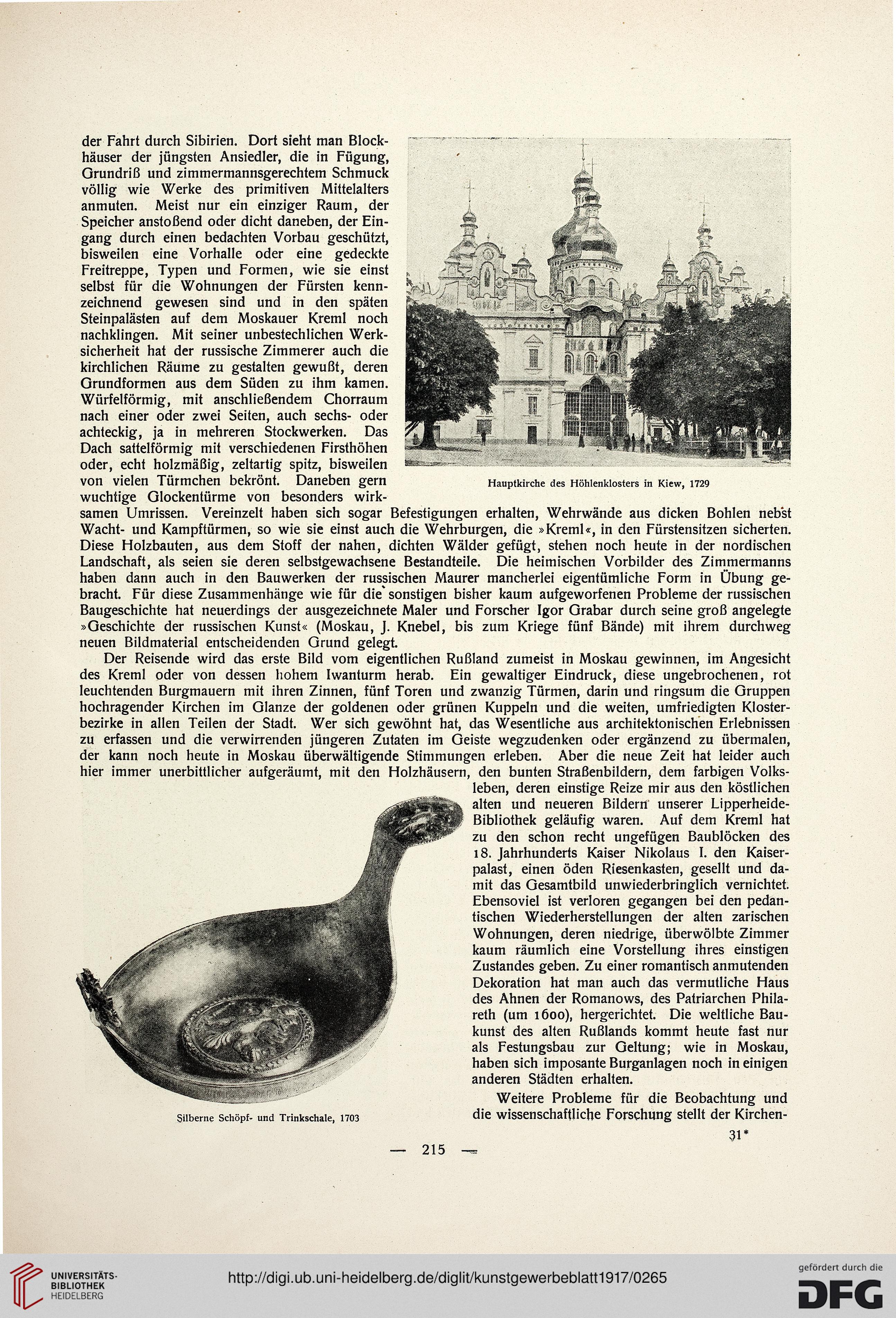Hauptkirche des Höhlenklosters in Kiew, 1729
der Fahrt durch Sibirien. Dort sieht man Block-
häuser der jüngsten Ansiedler, die in Fügung,
Grundriß und zimmermannsgerechtem Schmuck
völlig wie Werke des primitiven Mittelalters
anmuten. Meist nur ein einziger Raum, der
Speicher anstoßend oder dicht daneben, der Ein-
gang durch einen bedachten Vorbau geschützt,
bisweilen eine Vorhalle oder eine gedeckte
Freitreppe, Typen und Formen, wie sie einst
selbst für die Wohnungen der Fürsten kenn-
zeichnend gewesen sind und in den späten
Steinpalästen auf dem Moskauer Kreml noch
nachklingen. Mit seiner unbestechlichen Werk-
sicherheit hat der russische Zimmerer auch die
kirchlichen Räume zu gestalten gewußt, deren
Grundformen aus dem Süden zu ihm kamen.
Würfelförmig, mit anschließendem Chorraum
nach einer oder zwei Seiten, auch sechs- oder
achteckig, ja in mehreren Stockwerken. Das
Dach sattelförmig mit verschiedenen Firsthöhen
oder, echt holzmäßig, zeltartig spitz, bisweilen
von vielen Türmchen bekrönt. Daneben gern
wuchtige Glockentürme von besonders wirk-
samen Umrissen. Vereinzelt haben sich sogar Befestigungen erhalten, Wehrwände aus dicken Bohlen nebst
Wacht- und Kampftürmen, so wie sie einst auch die Wehrburgen, die »Kreml«, in den Fürstensitzen sicherten.
Diese Holzbauten, aus dem Stoff der nahen, dichten Wälder gefügt, stehen noch heute in der nordischen
Landschaft, als seien sie deren selbstgewachsene Bestandteile. Die heimischen Vorbilder des Zimmermanns
haben dann auch in den Bauwerken der russischen Maurer mancherlei eigentümliche Form in Übung ge-
bracht. Für diese Zusammenhänge wie für die* sonstigen bisher kaum aufgeworfenen Probleme der russischen
Baugeschichte hat neuerdings der ausgezeichnete Maler und Forscher Igor Grabar durch seine groß angelegte
»Geschichte der russischen Kunst« (Moskau, J. Knebel, bis zum Kriege fünf Bände) mit ihrem durchweg
neuen Bildmaterial entscheidenden Grund gelegt.
Der Reisende wird das erste Bild vom eigentlichen Rußland zumeist in Moskau gewinnen, im Angesicht
des Kreml oder von dessen hohem Iwanturm herab. Ein gewaltiger Eindruck, diese ungebrochenen, rot
leuchtenden Burgmauern mit ihren Zinnen, fünf Toren und zwanzig Türmen, darin und ringsum die Gruppen
hochragender Kirchen im Glänze der goldenen oder grünen Kuppeln und die weiten, umfriedigten Kloster-
bezirke in allen Teilen der Stadt. Wer sich gewöhnt hat, das Wesentliche aus architektonischen Erlebnissen
zu erfassen und die verwirrenden jüngeren Zutaten im Geiste wegzudenken oder ergänzend zu übermalen,
der kann noch heute in Moskau überwältigende Stimmungen erleben. Aber die neue Zeit hat leider auch
hier immer unerbittlicher aufgeräumt, mit den Holzhäusern, den bunten Straßenbildern, dem farbigen Volks-
leben, deren einstige Reize mir aus den köstlichen
alten und neueren Bildern unserer Lipperheide-
Bibliothek geläufig waren. Auf dem Kreml hat
zu den schon recht ungefügen Baublöcken des
18. Jahrhunderts Kaiser Nikolaus I. den Kaiser-
palast, einen öden Riesenkasten, gesellt und da-
mit das Gesamtbild unwiederbringlich vernichtet.
Ebensoviel ist verloren gegangen bei den pedan-
tischen Wiederherstellungen der alten zarischen
Wohnungen, deren niedrige, überwölbte Zimmer
kaum räumlich eine Vorstellung ihres einstigen
Zustandes geben. Zu einer romantisch anmutenden
Dekoration hat man auch das vermutliche Haus
des Ahnen der Romanows, des Patriarchen Phila-
reth (um 1600), hergerichtet. Die weltliche Bau-
kunst des alten Rußlands kommt heute fast nur
als Festungsbau zur Geltung; wie in Moskau,
haben sich imposante Burganlagen noch in einigen
anderen Städten erhalten.
Weitere Probleme für die Beobachtung und
die wissenschaftliche Forschung stellt der Kirchen-
31*
215 —
Silberne Schöpf- und Trinkschale, 1703
der Fahrt durch Sibirien. Dort sieht man Block-
häuser der jüngsten Ansiedler, die in Fügung,
Grundriß und zimmermannsgerechtem Schmuck
völlig wie Werke des primitiven Mittelalters
anmuten. Meist nur ein einziger Raum, der
Speicher anstoßend oder dicht daneben, der Ein-
gang durch einen bedachten Vorbau geschützt,
bisweilen eine Vorhalle oder eine gedeckte
Freitreppe, Typen und Formen, wie sie einst
selbst für die Wohnungen der Fürsten kenn-
zeichnend gewesen sind und in den späten
Steinpalästen auf dem Moskauer Kreml noch
nachklingen. Mit seiner unbestechlichen Werk-
sicherheit hat der russische Zimmerer auch die
kirchlichen Räume zu gestalten gewußt, deren
Grundformen aus dem Süden zu ihm kamen.
Würfelförmig, mit anschließendem Chorraum
nach einer oder zwei Seiten, auch sechs- oder
achteckig, ja in mehreren Stockwerken. Das
Dach sattelförmig mit verschiedenen Firsthöhen
oder, echt holzmäßig, zeltartig spitz, bisweilen
von vielen Türmchen bekrönt. Daneben gern
wuchtige Glockentürme von besonders wirk-
samen Umrissen. Vereinzelt haben sich sogar Befestigungen erhalten, Wehrwände aus dicken Bohlen nebst
Wacht- und Kampftürmen, so wie sie einst auch die Wehrburgen, die »Kreml«, in den Fürstensitzen sicherten.
Diese Holzbauten, aus dem Stoff der nahen, dichten Wälder gefügt, stehen noch heute in der nordischen
Landschaft, als seien sie deren selbstgewachsene Bestandteile. Die heimischen Vorbilder des Zimmermanns
haben dann auch in den Bauwerken der russischen Maurer mancherlei eigentümliche Form in Übung ge-
bracht. Für diese Zusammenhänge wie für die* sonstigen bisher kaum aufgeworfenen Probleme der russischen
Baugeschichte hat neuerdings der ausgezeichnete Maler und Forscher Igor Grabar durch seine groß angelegte
»Geschichte der russischen Kunst« (Moskau, J. Knebel, bis zum Kriege fünf Bände) mit ihrem durchweg
neuen Bildmaterial entscheidenden Grund gelegt.
Der Reisende wird das erste Bild vom eigentlichen Rußland zumeist in Moskau gewinnen, im Angesicht
des Kreml oder von dessen hohem Iwanturm herab. Ein gewaltiger Eindruck, diese ungebrochenen, rot
leuchtenden Burgmauern mit ihren Zinnen, fünf Toren und zwanzig Türmen, darin und ringsum die Gruppen
hochragender Kirchen im Glänze der goldenen oder grünen Kuppeln und die weiten, umfriedigten Kloster-
bezirke in allen Teilen der Stadt. Wer sich gewöhnt hat, das Wesentliche aus architektonischen Erlebnissen
zu erfassen und die verwirrenden jüngeren Zutaten im Geiste wegzudenken oder ergänzend zu übermalen,
der kann noch heute in Moskau überwältigende Stimmungen erleben. Aber die neue Zeit hat leider auch
hier immer unerbittlicher aufgeräumt, mit den Holzhäusern, den bunten Straßenbildern, dem farbigen Volks-
leben, deren einstige Reize mir aus den köstlichen
alten und neueren Bildern unserer Lipperheide-
Bibliothek geläufig waren. Auf dem Kreml hat
zu den schon recht ungefügen Baublöcken des
18. Jahrhunderts Kaiser Nikolaus I. den Kaiser-
palast, einen öden Riesenkasten, gesellt und da-
mit das Gesamtbild unwiederbringlich vernichtet.
Ebensoviel ist verloren gegangen bei den pedan-
tischen Wiederherstellungen der alten zarischen
Wohnungen, deren niedrige, überwölbte Zimmer
kaum räumlich eine Vorstellung ihres einstigen
Zustandes geben. Zu einer romantisch anmutenden
Dekoration hat man auch das vermutliche Haus
des Ahnen der Romanows, des Patriarchen Phila-
reth (um 1600), hergerichtet. Die weltliche Bau-
kunst des alten Rußlands kommt heute fast nur
als Festungsbau zur Geltung; wie in Moskau,
haben sich imposante Burganlagen noch in einigen
anderen Städten erhalten.
Weitere Probleme für die Beobachtung und
die wissenschaftliche Forschung stellt der Kirchen-
31*
215 —
Silberne Schöpf- und Trinkschale, 1703