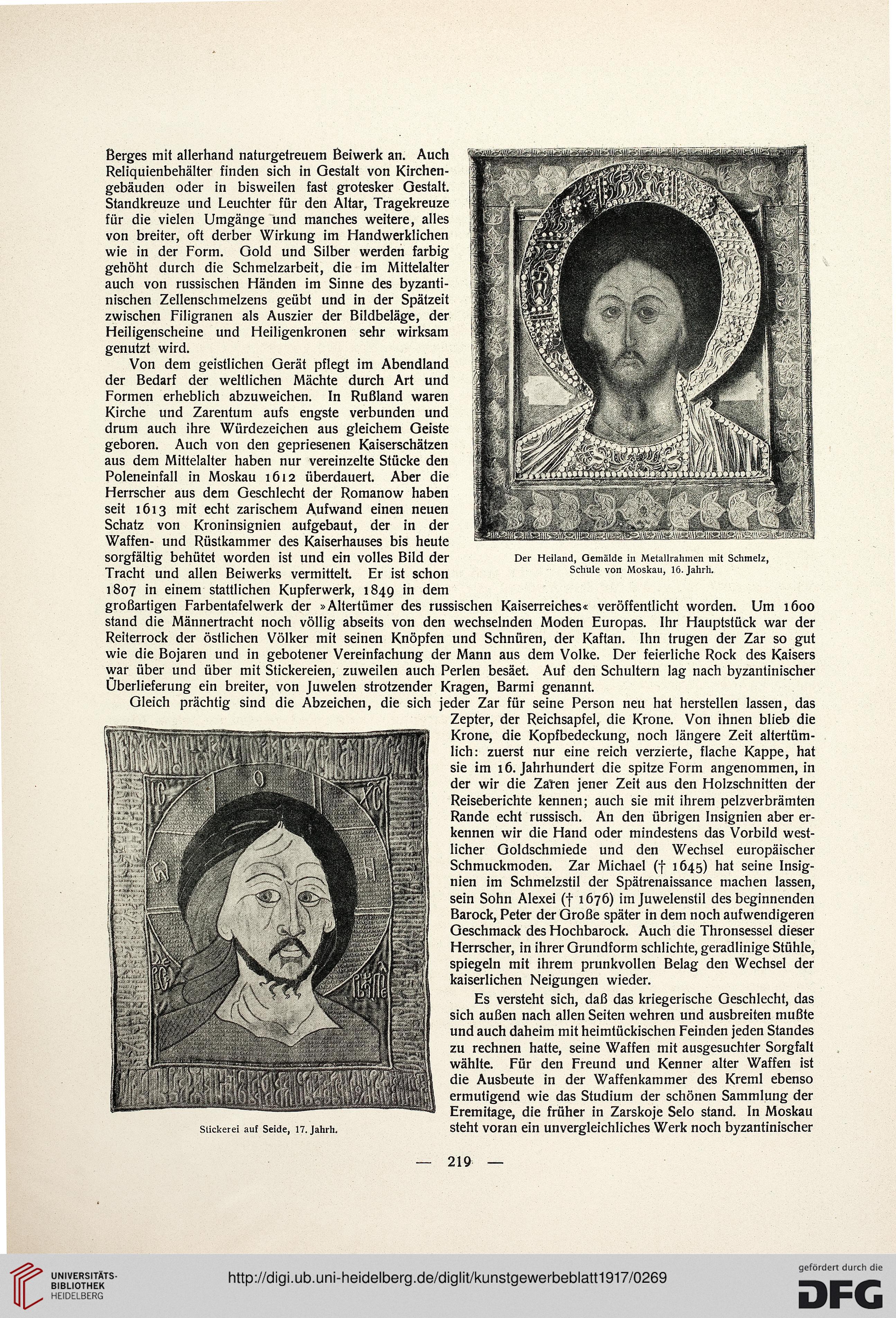Der Heiland, Gemälde in Metallrahmen mit Schmelz,
Schule von Moskau, 16.Jahrh.
Berges mit allerhand naturgetreuem Beiwerk an. Auch
Reliquienbehälter finden sich in Gestalt von Kirchen-
gebäuden oder in bisweilen fast grotesker Gestalt.
Standkreuze und Leuchter für den Altar, Tragekreuze
für die vielen Umgänge und manches weitere, alles
von breiter, oft derber Wirkung im Handwerklichen
wie in der Form. Gold und Silber werden farbig
gehöht durch die Schmelzarbeit, die im Mittelalter
auch von russischen Händen im Sinne des byzanti-
nischen Zellenschmelzens geübt und in der Spätzeit
zwischen Filigranen als Auszier der Bildbeläge, der
Heiligenscheine und Heiligenkronen sehr wirksam
genutzt wird.
Von dem geistlichen Gerät pflegt im Abendland
der Bedarf der weltlichen Mächte durch Art und
Formen erheblich abzuweichen. In Rußland waren
Kirche und Zarentum aufs engste verbunden und
drum auch ihre Würdezeichen aus gleichem Geiste
geboren. Auch von den gepriesenen Kaiserschätzen
aus dem Mittelalter haben nur vereinzelte Stücke den
Poleneinfall in Moskau 1612 überdauert. Aber die
Herrscher aus dem Geschlecht der Romanow haben
seit 1613 mit echt zarischem Aufwand einen neuen
Schatz von Kroninsignien aufgebaut, der in der
Waffen- und Rüstkammer des Kaiserhauses bis heute
sorgfältig behütet worden ist und ein volles Bild der
Tracht und allen Beiwerks vermittelt. Er ist schon
1807 in einem stattlichen Kupferwerk, 1849 in dem
großartigen Farbentafelwerk der »Altertümer des russischen Kaiserreiches« veröffentlicht worden. Um 1600
stand die Männertracht noch völlig abseits von den wechselnden Moden Europas. Ihr Hauptstück war der
Reiterrock der östlichen Völker mit seinen Knöpfen und Schnüren, der Kaftan. Ihn trugen der Zar so gut
wie die Bojaren und in gebotener Vereinfachung der Mann aus dem Volke. Der feierliche Rock des Kaisers
war über und über mit Stickereien, zuweilen auch Perlen besäet. Auf den Schultern lag nach byzantinischer
Überlieferung ein breiter, von Juwelen strotzender Kragen, Barmi genannt.
Gleich prächtig sind die Abzeichen, die sich jeder Zar für seine Person neu hat herstellen lassen, das
Zepter, der Reichsapfel, die Krone. Von ihnen blieb die
Krone, die Kopfbedeckung, noch längere Zeit altertüm-
lich: zuerst nur eine reich verzierte, flache Kappe, hat
sie im 16. Jahrhundert die spitze Form angenommen, in
der wir die Zaren jener Zeit aus den Holzschnitten der
Reiseberichte kennen; auch sie mit ihrem pelzverbrämten
Rande echt russisch. An den übrigen Insignien aber er-
kennen wir die Hand oder mindestens das Vorbild west-
licher Goldschmiede und den Wechsel europäischer
Schmuckmoden. Zar Michael (f 1645) hat seine Insig-
nien im Schmelzstil der Spätrenaissance machen lassen,
sein Sohn Alexei (f 1676) im Juwelenstil des beginnenden
Barock, Peter der Große später in dem noch aufwendigeren
Geschmack des Hochbarock. Auch die Thronsessel dieser
Herrscher, in ihrer Grundform schlichte, geradlinige Stühle,
spiegeln mit ihrem prunkvollen Belag den Wechsel der
kaiserlichen Neigungen wieder.
Es versteht sich, daß das kriegerische Geschlecht, das
sich außen nach allen Seiten wehren und ausbreiten mußte
und auch daheim mit heimtückischen Feinden jeden Standes
zu rechnen hatte, seine Waffen mit ausgesuchter Sorgfalt
wählte. Für den Freund und Kenner alter Waffen ist
die Ausbeute in der Waffenkammer des Kreml ebenso
ermutigend wie das Studium der schönen Sammlung der
Eremitage, die früher in Zarskoje Selo stand. In Moskau
Stickerei auf Seide, n.jahrh. steht voran ein unvergleichliches Werk noch byzantinischer
— 219 —
Schule von Moskau, 16.Jahrh.
Berges mit allerhand naturgetreuem Beiwerk an. Auch
Reliquienbehälter finden sich in Gestalt von Kirchen-
gebäuden oder in bisweilen fast grotesker Gestalt.
Standkreuze und Leuchter für den Altar, Tragekreuze
für die vielen Umgänge und manches weitere, alles
von breiter, oft derber Wirkung im Handwerklichen
wie in der Form. Gold und Silber werden farbig
gehöht durch die Schmelzarbeit, die im Mittelalter
auch von russischen Händen im Sinne des byzanti-
nischen Zellenschmelzens geübt und in der Spätzeit
zwischen Filigranen als Auszier der Bildbeläge, der
Heiligenscheine und Heiligenkronen sehr wirksam
genutzt wird.
Von dem geistlichen Gerät pflegt im Abendland
der Bedarf der weltlichen Mächte durch Art und
Formen erheblich abzuweichen. In Rußland waren
Kirche und Zarentum aufs engste verbunden und
drum auch ihre Würdezeichen aus gleichem Geiste
geboren. Auch von den gepriesenen Kaiserschätzen
aus dem Mittelalter haben nur vereinzelte Stücke den
Poleneinfall in Moskau 1612 überdauert. Aber die
Herrscher aus dem Geschlecht der Romanow haben
seit 1613 mit echt zarischem Aufwand einen neuen
Schatz von Kroninsignien aufgebaut, der in der
Waffen- und Rüstkammer des Kaiserhauses bis heute
sorgfältig behütet worden ist und ein volles Bild der
Tracht und allen Beiwerks vermittelt. Er ist schon
1807 in einem stattlichen Kupferwerk, 1849 in dem
großartigen Farbentafelwerk der »Altertümer des russischen Kaiserreiches« veröffentlicht worden. Um 1600
stand die Männertracht noch völlig abseits von den wechselnden Moden Europas. Ihr Hauptstück war der
Reiterrock der östlichen Völker mit seinen Knöpfen und Schnüren, der Kaftan. Ihn trugen der Zar so gut
wie die Bojaren und in gebotener Vereinfachung der Mann aus dem Volke. Der feierliche Rock des Kaisers
war über und über mit Stickereien, zuweilen auch Perlen besäet. Auf den Schultern lag nach byzantinischer
Überlieferung ein breiter, von Juwelen strotzender Kragen, Barmi genannt.
Gleich prächtig sind die Abzeichen, die sich jeder Zar für seine Person neu hat herstellen lassen, das
Zepter, der Reichsapfel, die Krone. Von ihnen blieb die
Krone, die Kopfbedeckung, noch längere Zeit altertüm-
lich: zuerst nur eine reich verzierte, flache Kappe, hat
sie im 16. Jahrhundert die spitze Form angenommen, in
der wir die Zaren jener Zeit aus den Holzschnitten der
Reiseberichte kennen; auch sie mit ihrem pelzverbrämten
Rande echt russisch. An den übrigen Insignien aber er-
kennen wir die Hand oder mindestens das Vorbild west-
licher Goldschmiede und den Wechsel europäischer
Schmuckmoden. Zar Michael (f 1645) hat seine Insig-
nien im Schmelzstil der Spätrenaissance machen lassen,
sein Sohn Alexei (f 1676) im Juwelenstil des beginnenden
Barock, Peter der Große später in dem noch aufwendigeren
Geschmack des Hochbarock. Auch die Thronsessel dieser
Herrscher, in ihrer Grundform schlichte, geradlinige Stühle,
spiegeln mit ihrem prunkvollen Belag den Wechsel der
kaiserlichen Neigungen wieder.
Es versteht sich, daß das kriegerische Geschlecht, das
sich außen nach allen Seiten wehren und ausbreiten mußte
und auch daheim mit heimtückischen Feinden jeden Standes
zu rechnen hatte, seine Waffen mit ausgesuchter Sorgfalt
wählte. Für den Freund und Kenner alter Waffen ist
die Ausbeute in der Waffenkammer des Kreml ebenso
ermutigend wie das Studium der schönen Sammlung der
Eremitage, die früher in Zarskoje Selo stand. In Moskau
Stickerei auf Seide, n.jahrh. steht voran ein unvergleichliches Werk noch byzantinischer
— 219 —