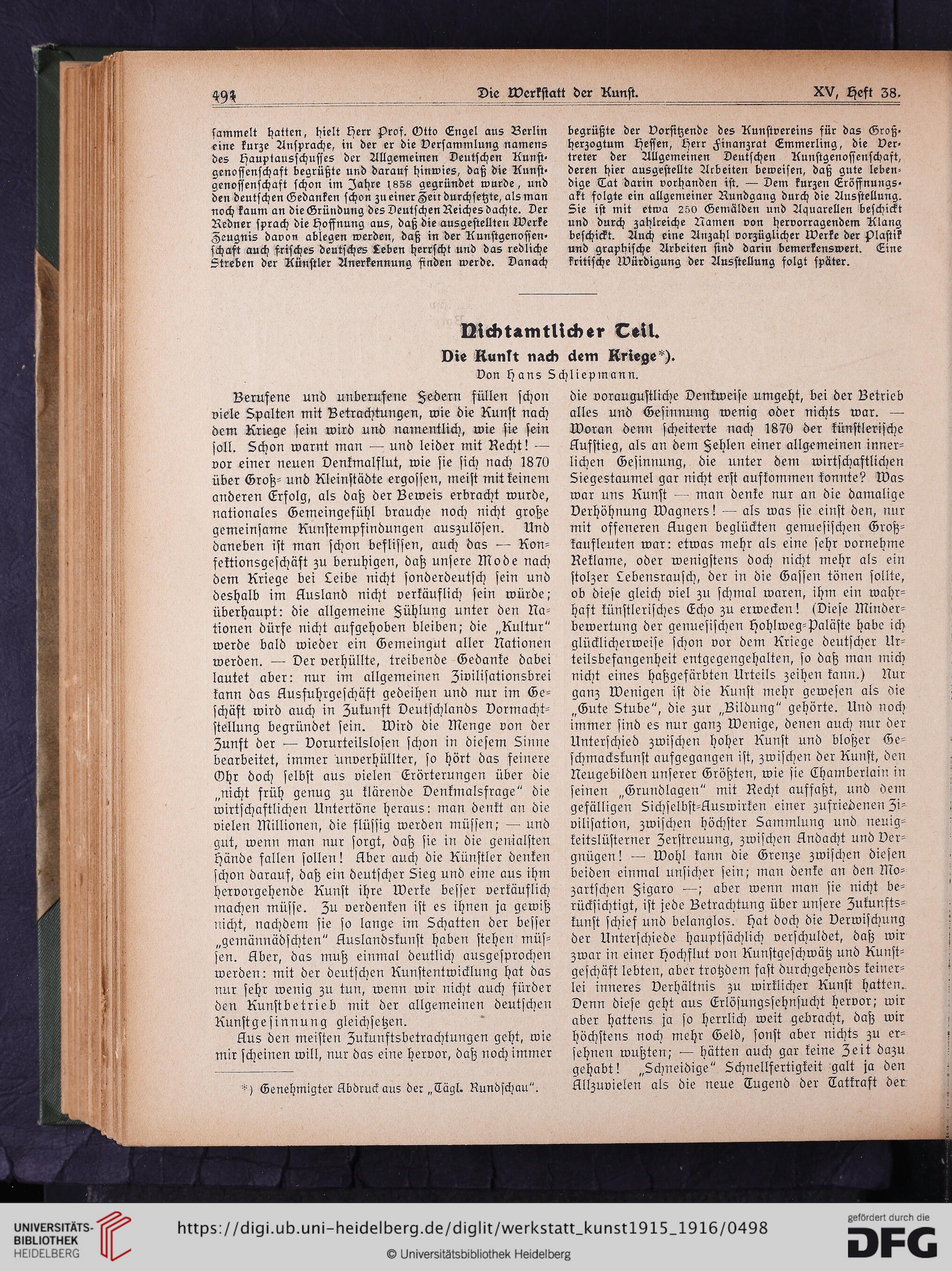Die Werkstatt der Kunst.
XV, Heft 38.
M
sammelt hatten, hielt Herr Prof. Otto Engel aus Berlin
eine kurze Ansprache, in der er die Versammlung namens
des Hauptausschusses der Allgemeinen Deutschen Kunst-
genossenschaft begrüßte und darauf hinwies, daß die Kunst-
genossenschaft schon im Jahre ^858 gegründet wurde, und
den deutschen Gedanken schon zu einer Zeit durchsetzte, als man
noch kaum an die Gründung des Deutschen Reiches dachte. Der
Redner sprach die Hoffnung aus, daß die ausgestellten Werke
Zeugnis davon ablegen werden, daß in der Kunstgenossen-
schaft auch frisches deutsches Leben herrscht und das redliche
Streben der Künstler Anerkennung finden werde. Danach
begrüßte der Vorsitzende des Kunstvereins für das Groß-
herzogtum Hessen, Herr Finanzrat Emmerling, die Ver-
treter der Allgemeinen Deutschen Kunstgenofsenschaft,
deren hier ausgestellte Arbeiten beweisen, daß gute leben-
dige Tat darin vorhanden ist. — Dem kurzen Eröffnungs-
akt folgte ein allgemeiner Rundgang durch die Ausstellung.
Sie ist mit etwa 250 Gemälden und Aquarellen beschickt
und durch zahlreiche Namen von hervorragendem Klang
beschickt. Auch eine Anzahl vorzüglicher Werke der Plastik
und graphische Arbeiten sind darin bemerkenswert. Line
kritische Würdigung der Ausstellung folgt später.
DichtLmlUcker TriU
Vie Runlt nack äem Kriege *).
von Hans Schliepmann.
Berufene und unberufene Zedern füllen schon
viele Spalten mit Betrachtungen, wie die Kunst nach
dem Kriege sein wird und namentlich, wie sie sein
soll. Schon warnt man — und leider mit Recht! —
vor einer neuen Denkmalflut, wie sie sich nach 1870
über Groß- und Kleinstädte ergossen, meist mit keinem
anderen Erfolg, als daß der Beweis erbracht wurde,
nationales Gemeingefühl brauche noch nicht große
gemeinsame Kunstempfindungen auszulösen. Und
daneben ist man schon beflissen, auch das — Kon-
fektionsgeschäft zu beruhigen, daß unsere Mode nach
dem Kriege bei Leibe nicht sonderdeutsch sein und
deshalb im Ausland nicht verkäuflich sein würde;
überhaupt: die allgemeine Zühlung unter den Na-
tionen dürfe nicht aufgehoben bleiben; die „Kultur"
werde bald wieder ein Gemeingut aller Nationen
werden. — Der verhüllte, treibende Gedanke dabei
lautet aber: nur im allgemeinen Zivilisationsbrei
kann das Ausfuhrgeschäft gedeihen und nur im Ge-
schäft wird auch in Zukunft Deutschlands Vormacht-
stellung begründet sein. Wird die Menge von der
Zunft der vorurteilslosen schon in diesem Sinne
bearbeitet, immer ünverhüllter, so hört das feinere
Ghr doch selbst aus vielen Erörterungen über die
„nicht früh genug zu klärende Denkmalsfrage" die
wirtschaftlichen Untertöne heraus: man denkt an die
vielen Millionen, die flüssig werden müssen - — und
gut, wenn man nur sorgt, daß sie in die genialsten
Hände fallen sollen! Aber auch die Künstler denken
schon darauf, daß ein deutscher Sieg und eine aus ihm
hervorgehende Kunst ihre Werke besser verkäuflich
machen müsse. Zu verdenken ist es ihnen ja gewiß
nicht, nachdem sie so lange im Schatten der besser
„gemännädschten" Auslandskunst haben stehen müs-
sen. Aber, das mutz einmal deutlich ausgesprochen
werden: mit der deutschen Kunstentwicklung hat das
nur sehr wenig zu tun, wenn wir nicht auch fürder
den Kunstbetrieb mit der allgemeinen deutschen
Kunstgesinnung gleichsetzen.
Aus den meisten Zukunftsbetrachtungen geht, wie
mir scheinen will, nur das eine hervor, daß noch immer
Genehmigter Abdruck aus der„Tägl. Rundschau".
die voraugustliche Denkweise umgeht, bei der Betrieb
alles und Gesinnung wenig oder nichts war. —
Woran denn scheiterte nach 1870 der künstlerische
Aufstieg, als an dem Fehlen einer allgemeinen inner-
lichen Gesinnung, die unter dem wirtschaftlichen
Siegestaumel gar nicht erst aufkommen konnte? Was
war uns Kunst — man denke nur an die damalige
Verhöhnung Wagners! — als was sie einst den, nur
mit offeneren Augen beglückten genuesischen Groß-
kaufleuten war: etwas mehr als eine sehr vornehme
Reklame, oder wenigstens doch nicht mehr als ein
stolzer Lebensrausch, der in die Gassen tönen sollte,
ob diese gleich viel zu schmal waren, ihm ein wahr-
haft künstlerisches Echo zu erwecken! (Diese Minder-
bewertung der genuesischen Hohlweg-Paläste habe ich
glücklicherweise schon vor dem Kriege deutscher Ur-
teilsbefangenheit entgegengehalten, so daß man mich
nicht eines haßgefärbten Urteils zeihen kann.) Nur
ganz Wenigen ist die Kunst mehr gewesen als die
„Gute Stube", die zur „Bildung" gehörte. Und noch
immer sind es nur ganz Wenige, denen auch nur der
Unterschied zwischen hoher Kunst und bloßer Ge-
schmackskunst aufgegangen ist, zwischen der Kunst, den
Neugebilden unserer Größten, wie sie Chamberlain in
seinen „Grundlagen" mit Recht auffaßt, und dem
gefälligen Sichselbst-Auswirken einer zufriedenen Zi-
vilisation, zwischen höchster Sammlung und neuig-
keitslüsterner Zerstreuung, zwischen Andacht und Ver-
gnügen! — Wohl kann die Grenze zwischen diesen
beiden einmal unsicher sein; man denke an den Mo-
zartschen Kigaro —; aber wenn man sie nicht be-
rücksichtigt, ist jede Betrachtung über unsere Zukunfts-
kunst schief und belanglos. Hat doch die Verwischung
der Unterschiede hauptsächlich verschuldet, daß wir
zwar in einer Hochflut von Kunstgeschwätz und Kunst-
geschäft lebten, aber trotzdem fast durchgehends keiner-
lei inneres Verhältnis zu wirklicher Kunst hatten..
Venn diese geht aus Erlösungssehnsucht hervor; wir
aber Hattens ja so herrlich weit gebracht, daß wir
höchstens noch mehr Geld, sonst aber nichts zu er-
sehnen wußten; — hätten auch gar keine Zeit dazu
gehabt! „Schneidige" Schnellfertigkeit galt ja den
Allzuvielen als die neue Tugend der Tatkraft der.
XV, Heft 38.
M
sammelt hatten, hielt Herr Prof. Otto Engel aus Berlin
eine kurze Ansprache, in der er die Versammlung namens
des Hauptausschusses der Allgemeinen Deutschen Kunst-
genossenschaft begrüßte und darauf hinwies, daß die Kunst-
genossenschaft schon im Jahre ^858 gegründet wurde, und
den deutschen Gedanken schon zu einer Zeit durchsetzte, als man
noch kaum an die Gründung des Deutschen Reiches dachte. Der
Redner sprach die Hoffnung aus, daß die ausgestellten Werke
Zeugnis davon ablegen werden, daß in der Kunstgenossen-
schaft auch frisches deutsches Leben herrscht und das redliche
Streben der Künstler Anerkennung finden werde. Danach
begrüßte der Vorsitzende des Kunstvereins für das Groß-
herzogtum Hessen, Herr Finanzrat Emmerling, die Ver-
treter der Allgemeinen Deutschen Kunstgenofsenschaft,
deren hier ausgestellte Arbeiten beweisen, daß gute leben-
dige Tat darin vorhanden ist. — Dem kurzen Eröffnungs-
akt folgte ein allgemeiner Rundgang durch die Ausstellung.
Sie ist mit etwa 250 Gemälden und Aquarellen beschickt
und durch zahlreiche Namen von hervorragendem Klang
beschickt. Auch eine Anzahl vorzüglicher Werke der Plastik
und graphische Arbeiten sind darin bemerkenswert. Line
kritische Würdigung der Ausstellung folgt später.
DichtLmlUcker TriU
Vie Runlt nack äem Kriege *).
von Hans Schliepmann.
Berufene und unberufene Zedern füllen schon
viele Spalten mit Betrachtungen, wie die Kunst nach
dem Kriege sein wird und namentlich, wie sie sein
soll. Schon warnt man — und leider mit Recht! —
vor einer neuen Denkmalflut, wie sie sich nach 1870
über Groß- und Kleinstädte ergossen, meist mit keinem
anderen Erfolg, als daß der Beweis erbracht wurde,
nationales Gemeingefühl brauche noch nicht große
gemeinsame Kunstempfindungen auszulösen. Und
daneben ist man schon beflissen, auch das — Kon-
fektionsgeschäft zu beruhigen, daß unsere Mode nach
dem Kriege bei Leibe nicht sonderdeutsch sein und
deshalb im Ausland nicht verkäuflich sein würde;
überhaupt: die allgemeine Zühlung unter den Na-
tionen dürfe nicht aufgehoben bleiben; die „Kultur"
werde bald wieder ein Gemeingut aller Nationen
werden. — Der verhüllte, treibende Gedanke dabei
lautet aber: nur im allgemeinen Zivilisationsbrei
kann das Ausfuhrgeschäft gedeihen und nur im Ge-
schäft wird auch in Zukunft Deutschlands Vormacht-
stellung begründet sein. Wird die Menge von der
Zunft der vorurteilslosen schon in diesem Sinne
bearbeitet, immer ünverhüllter, so hört das feinere
Ghr doch selbst aus vielen Erörterungen über die
„nicht früh genug zu klärende Denkmalsfrage" die
wirtschaftlichen Untertöne heraus: man denkt an die
vielen Millionen, die flüssig werden müssen - — und
gut, wenn man nur sorgt, daß sie in die genialsten
Hände fallen sollen! Aber auch die Künstler denken
schon darauf, daß ein deutscher Sieg und eine aus ihm
hervorgehende Kunst ihre Werke besser verkäuflich
machen müsse. Zu verdenken ist es ihnen ja gewiß
nicht, nachdem sie so lange im Schatten der besser
„gemännädschten" Auslandskunst haben stehen müs-
sen. Aber, das mutz einmal deutlich ausgesprochen
werden: mit der deutschen Kunstentwicklung hat das
nur sehr wenig zu tun, wenn wir nicht auch fürder
den Kunstbetrieb mit der allgemeinen deutschen
Kunstgesinnung gleichsetzen.
Aus den meisten Zukunftsbetrachtungen geht, wie
mir scheinen will, nur das eine hervor, daß noch immer
Genehmigter Abdruck aus der„Tägl. Rundschau".
die voraugustliche Denkweise umgeht, bei der Betrieb
alles und Gesinnung wenig oder nichts war. —
Woran denn scheiterte nach 1870 der künstlerische
Aufstieg, als an dem Fehlen einer allgemeinen inner-
lichen Gesinnung, die unter dem wirtschaftlichen
Siegestaumel gar nicht erst aufkommen konnte? Was
war uns Kunst — man denke nur an die damalige
Verhöhnung Wagners! — als was sie einst den, nur
mit offeneren Augen beglückten genuesischen Groß-
kaufleuten war: etwas mehr als eine sehr vornehme
Reklame, oder wenigstens doch nicht mehr als ein
stolzer Lebensrausch, der in die Gassen tönen sollte,
ob diese gleich viel zu schmal waren, ihm ein wahr-
haft künstlerisches Echo zu erwecken! (Diese Minder-
bewertung der genuesischen Hohlweg-Paläste habe ich
glücklicherweise schon vor dem Kriege deutscher Ur-
teilsbefangenheit entgegengehalten, so daß man mich
nicht eines haßgefärbten Urteils zeihen kann.) Nur
ganz Wenigen ist die Kunst mehr gewesen als die
„Gute Stube", die zur „Bildung" gehörte. Und noch
immer sind es nur ganz Wenige, denen auch nur der
Unterschied zwischen hoher Kunst und bloßer Ge-
schmackskunst aufgegangen ist, zwischen der Kunst, den
Neugebilden unserer Größten, wie sie Chamberlain in
seinen „Grundlagen" mit Recht auffaßt, und dem
gefälligen Sichselbst-Auswirken einer zufriedenen Zi-
vilisation, zwischen höchster Sammlung und neuig-
keitslüsterner Zerstreuung, zwischen Andacht und Ver-
gnügen! — Wohl kann die Grenze zwischen diesen
beiden einmal unsicher sein; man denke an den Mo-
zartschen Kigaro —; aber wenn man sie nicht be-
rücksichtigt, ist jede Betrachtung über unsere Zukunfts-
kunst schief und belanglos. Hat doch die Verwischung
der Unterschiede hauptsächlich verschuldet, daß wir
zwar in einer Hochflut von Kunstgeschwätz und Kunst-
geschäft lebten, aber trotzdem fast durchgehends keiner-
lei inneres Verhältnis zu wirklicher Kunst hatten..
Venn diese geht aus Erlösungssehnsucht hervor; wir
aber Hattens ja so herrlich weit gebracht, daß wir
höchstens noch mehr Geld, sonst aber nichts zu er-
sehnen wußten; — hätten auch gar keine Zeit dazu
gehabt! „Schneidige" Schnellfertigkeit galt ja den
Allzuvielen als die neue Tugend der Tatkraft der.