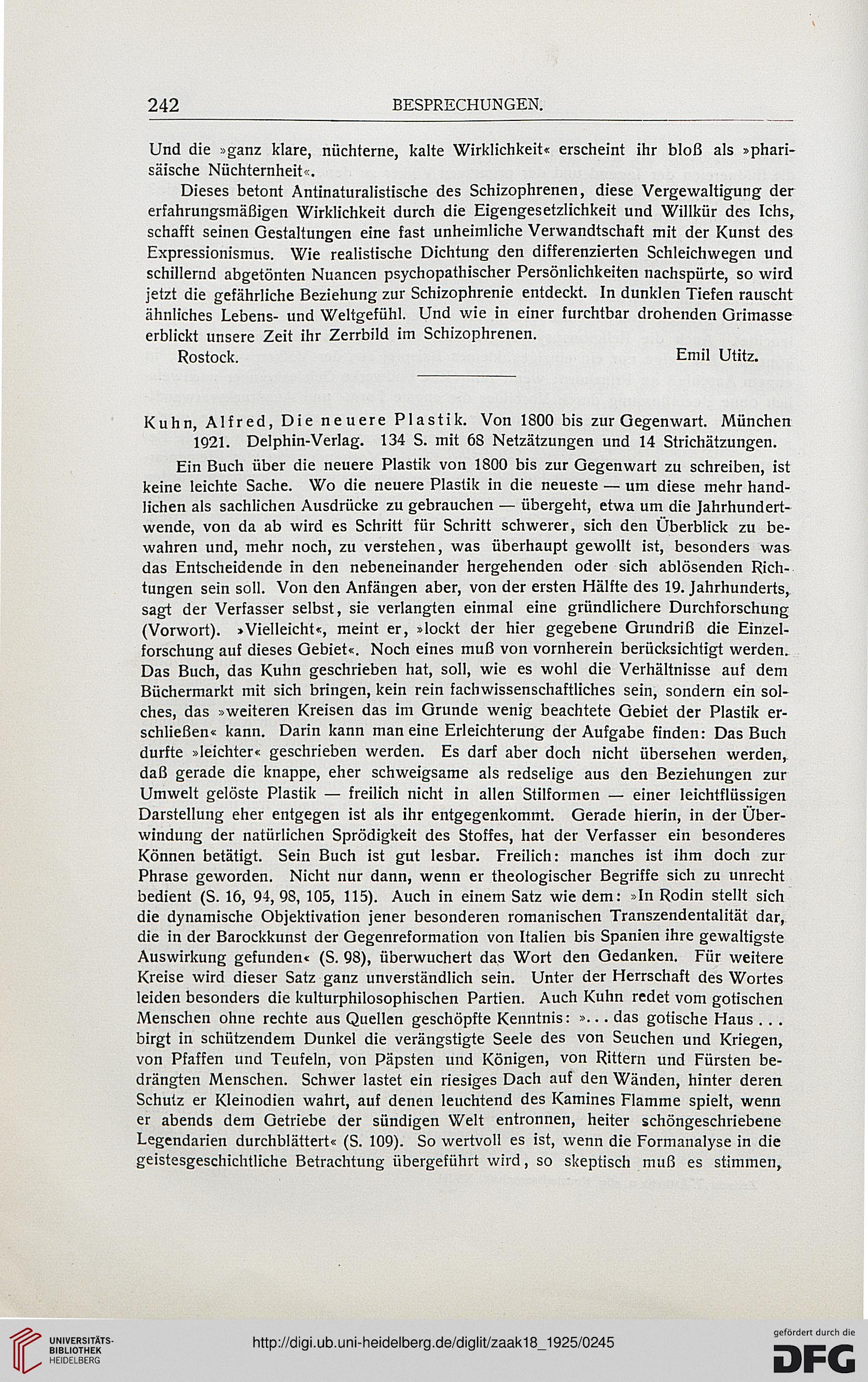242 BESPRECHUNGEN.
Und die »ganz klare, nüchterne, kalte Wirklichkeit« erscheint ihr bloß als »phari-
säische Nüchternheit«.
Dieses betont Antinaturalistische des Schizophrenen, diese Vergewaltigung der
erfahrungsmäßigen Wirklichkeit durch die Eigengesetzlichkeit und Willkür des Ichs,
schafft seinen Gestaltungen eine fast unheimliche Verwandtschaft mit der Kunst des
Expressionismus. Wie realistische Dichtung den differenzierten Schleichwegen und
schillernd abgetönten Nuancen psychopathischer Persönlichkeiten nachspürte, so wird
jetzt die gefährliche Beziehung zur Schizophrenie entdeckt. In dunklen Tiefen rauscht
ähnliches Lebens- und Weltgefühl. Und wie in einer furchtbar drohenden Grimasse
erblickt unsere Zeit ihr Zerrbild im Schizophrenen.
Rostock. Emil Utitz.
Kuhn, Alfred, Die neuere Plastik. Von 1800 bis zur Gegenwart. München
1921. Delphin-Verlag. 134 S. mit 68 Netzätzungen und 14 Strichätzungen.
Ein Buch über die neuere Plastik von 1800 bis zur Gegenwart zu schreiben, ist
keine leichte Sache. Wo die neuere Plastik in die neueste — um diese mehr hand-
lichen als sachlichen Ausdrücke zu gebrauchen — übergeht, etwa um die Jahrhundert-
wende, von da ab wird es Schritt für Schritt schwerer, sich den Überblick zu be-
wahren und, mehr noch, zu verstehen, was überhaupt gewollt ist, besonders was
das Entscheidende in den nebeneinander hergehenden oder sich ablösenden Rich-
tungen sein soll. Von den Anfängen aber, von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
sagt der Verfasser selbst, sie verlangten einmal eine gründlichere Durchforschung
(Vorwort). »Vielleicht«, meint er, »lockt der hier gegebene Grundriß die Einzel-
forschung auf dieses Gebiet«. Noch eines muß von vornherein berücksichtigt werden.
Das Buch, das Kuhn geschrieben hat, soll, wie es wohl die Verhältnisse auf dem
Büchermarkt mit sich bringen, kein rein fach wissenschaftliches sein, sondern ein sol-
ches, das »weiteren Kreisen das im Grunde wenig beachtete Gebiet der Plastik er-
schließen« kann. Darin kann man eine Erleichterung der Aufgabe finden: Das Buch
durfte »leichter« geschrieben werden. Es darf aber doch nicht übersehen werden,
daß gerade die knappe, eher schweigsame als redselige aus den Beziehungen zur
Umwelt gelöste Plastik — freilich nicht in allen Stilformen — einer leichtflüssigen
Darstellung eher entgegen ist als ihr entgegenkommt. Gerade hierin, in der Über-
windung der natürlichen Sprödigkeit des Stoffes, hat der Verfasser ein besonderes
Können betätigt. Sein Buch ist gut lesbar. Freilich: manches ist ihm doch zur
Phrase geworden. Nicht nur dann, wenn er theologischer Begriffe sich zu unrecht
bedient (S. 16, 94, 98, 105, 115). Auch in einem Satz wie dem: »In Rodin stellt sich
die dynamische Objektivation jener besonderen romanischen Transzendentalität dar,
die in der Barockkunst der Gegenreformation von Italien bis Spanien ihre gewaltigste
Auswirkung gefunden« (S. 98), überwuchert das Wort den Gedanken. Für weitere
Kreise wird dieser Satz ganz unverständlich sein. Unter der Herrschaft des Wortes
leiden besonders die kulturphilosophischen Partien. Auch Kuhn redet vom gotischen
Menschen ohne rechte aus Quellen geschöpfte Kenntnis: ».. . das gotische Haus . . .
birgt in schützendem Dunkel die verängstigte Seele des von Seuchen und Kriegen,
von Pfaffen und Teufeln, von Päpsten und Königen, von Rittern und Fürsten be-
drängten Menschen. Schwer lastet ein riesiges Dach auf den Wänden, hinter deren
Schutz er Kleinodien wahrt, auf denen leuchtend des Kamines Flamme spielt, wenn
er abends dem Getriebe der sündigen Welt entronnen, heiter schöngeschriebene
Legendarien durchblättert« (S. 109). So wertvoll es ist, wenn die Formanalyse in die
geistesgeschichtliche Betrachtung übergeführt wird, so skeptisch muß es stimmen,
Und die »ganz klare, nüchterne, kalte Wirklichkeit« erscheint ihr bloß als »phari-
säische Nüchternheit«.
Dieses betont Antinaturalistische des Schizophrenen, diese Vergewaltigung der
erfahrungsmäßigen Wirklichkeit durch die Eigengesetzlichkeit und Willkür des Ichs,
schafft seinen Gestaltungen eine fast unheimliche Verwandtschaft mit der Kunst des
Expressionismus. Wie realistische Dichtung den differenzierten Schleichwegen und
schillernd abgetönten Nuancen psychopathischer Persönlichkeiten nachspürte, so wird
jetzt die gefährliche Beziehung zur Schizophrenie entdeckt. In dunklen Tiefen rauscht
ähnliches Lebens- und Weltgefühl. Und wie in einer furchtbar drohenden Grimasse
erblickt unsere Zeit ihr Zerrbild im Schizophrenen.
Rostock. Emil Utitz.
Kuhn, Alfred, Die neuere Plastik. Von 1800 bis zur Gegenwart. München
1921. Delphin-Verlag. 134 S. mit 68 Netzätzungen und 14 Strichätzungen.
Ein Buch über die neuere Plastik von 1800 bis zur Gegenwart zu schreiben, ist
keine leichte Sache. Wo die neuere Plastik in die neueste — um diese mehr hand-
lichen als sachlichen Ausdrücke zu gebrauchen — übergeht, etwa um die Jahrhundert-
wende, von da ab wird es Schritt für Schritt schwerer, sich den Überblick zu be-
wahren und, mehr noch, zu verstehen, was überhaupt gewollt ist, besonders was
das Entscheidende in den nebeneinander hergehenden oder sich ablösenden Rich-
tungen sein soll. Von den Anfängen aber, von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
sagt der Verfasser selbst, sie verlangten einmal eine gründlichere Durchforschung
(Vorwort). »Vielleicht«, meint er, »lockt der hier gegebene Grundriß die Einzel-
forschung auf dieses Gebiet«. Noch eines muß von vornherein berücksichtigt werden.
Das Buch, das Kuhn geschrieben hat, soll, wie es wohl die Verhältnisse auf dem
Büchermarkt mit sich bringen, kein rein fach wissenschaftliches sein, sondern ein sol-
ches, das »weiteren Kreisen das im Grunde wenig beachtete Gebiet der Plastik er-
schließen« kann. Darin kann man eine Erleichterung der Aufgabe finden: Das Buch
durfte »leichter« geschrieben werden. Es darf aber doch nicht übersehen werden,
daß gerade die knappe, eher schweigsame als redselige aus den Beziehungen zur
Umwelt gelöste Plastik — freilich nicht in allen Stilformen — einer leichtflüssigen
Darstellung eher entgegen ist als ihr entgegenkommt. Gerade hierin, in der Über-
windung der natürlichen Sprödigkeit des Stoffes, hat der Verfasser ein besonderes
Können betätigt. Sein Buch ist gut lesbar. Freilich: manches ist ihm doch zur
Phrase geworden. Nicht nur dann, wenn er theologischer Begriffe sich zu unrecht
bedient (S. 16, 94, 98, 105, 115). Auch in einem Satz wie dem: »In Rodin stellt sich
die dynamische Objektivation jener besonderen romanischen Transzendentalität dar,
die in der Barockkunst der Gegenreformation von Italien bis Spanien ihre gewaltigste
Auswirkung gefunden« (S. 98), überwuchert das Wort den Gedanken. Für weitere
Kreise wird dieser Satz ganz unverständlich sein. Unter der Herrschaft des Wortes
leiden besonders die kulturphilosophischen Partien. Auch Kuhn redet vom gotischen
Menschen ohne rechte aus Quellen geschöpfte Kenntnis: ».. . das gotische Haus . . .
birgt in schützendem Dunkel die verängstigte Seele des von Seuchen und Kriegen,
von Pfaffen und Teufeln, von Päpsten und Königen, von Rittern und Fürsten be-
drängten Menschen. Schwer lastet ein riesiges Dach auf den Wänden, hinter deren
Schutz er Kleinodien wahrt, auf denen leuchtend des Kamines Flamme spielt, wenn
er abends dem Getriebe der sündigen Welt entronnen, heiter schöngeschriebene
Legendarien durchblättert« (S. 109). So wertvoll es ist, wenn die Formanalyse in die
geistesgeschichtliche Betrachtung übergeführt wird, so skeptisch muß es stimmen,