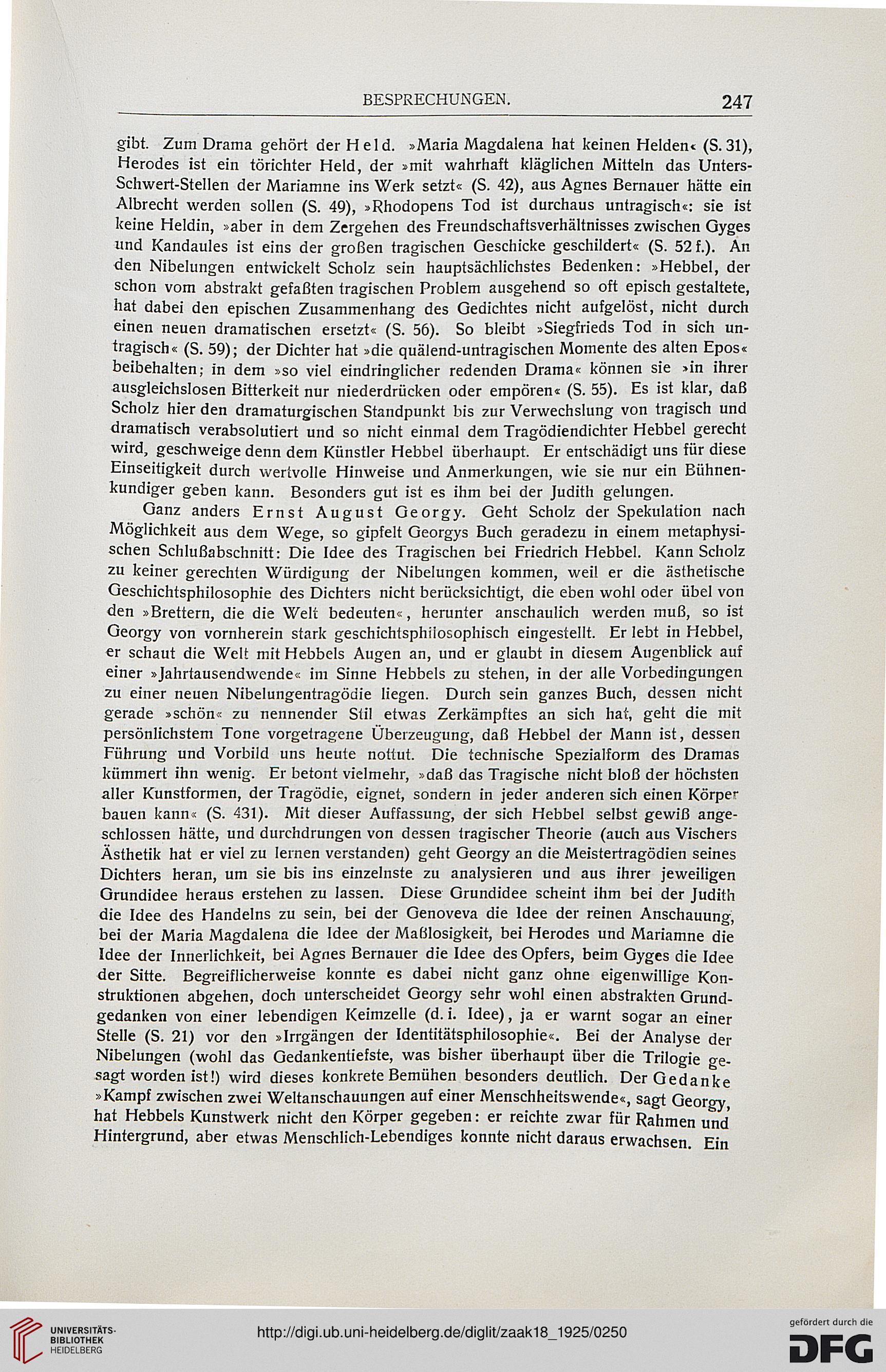BESPRECHUNGEN. 247
gibt. Zum Drama gehört der Held. »Maria Magdalena hat keinen Helden« (S. 31),
Herodes ist ein törichter Held, der »mit wahrhaft kläglichen Mitteln das Unters-
Schwert-Stellen der Mariamne ins Werk setzt« (S. 42), aus Agnes Bernauer hätte ein
Albrecht werden sollen (S. 49), »Rhodopens Tod ist durchaus untragisch«: sie ist
keine Heldin, »aber in dem Zergehen des Freundschaftsverhältnisses zwischen Gyges
und Kandaules ist eins der großen tragischen Geschicke geschildert« (S. 52 f.). An
den Nibelungen entwickelt Scholz sein hauptsächlichstes Bedenken: »Hebbel, der
schon vom abstrakt gefaßten tragischen Problem ausgehend so oft episch gestaltete,
hat dabei den epischen Zusammenhang des Gedichtes nicht aufgelöst, nicht durch
einen neuen dramatischen ersetzt« (S. 56). So bleibt »Siegfrieds Tod in sich un-
tragisch« (S. 59); der Dichter hat »die quälend-untragischen Momente des alten Epos«
beibehalten; in dem »so viel eindringlicher redenden Drama« können sie »in ihrer
ausgleichslosen Bitterkeit nur niederdrücken oder empören« (S. 55). Es ist klar, daß
Scholz hier den dramaturgischen Standpunkt bis zur Verwechslung von tragisch und
dramatisch verabsolutiert und so nicht einmal dem Tragödiendichter Hebbel gerecht
wird, geschweige denn dem Künstler Hebbel überhaupt. Er entschädigt uns für diese
Einseitigkeit durch wertvolle Hinweise und Anmerkungen, wie sie nur ein Bühnen-
kundiger geben kann. Besonders gut ist es ihm bei der Judith gelungen.
Ganz anders Ernst August Georgy. Geht Scholz der Spekulation nach
Möglichkeit aus dem Wege, so gipfelt Georgys Buch geradezu in einem metaphysi-
schen Schlußabschnitt: Die Idee des Tragischen bei Friedrich Hebbel. Kann Scholz
zu keiner gerechten Würdigung der Nibelungen kommen, weil er die ästhetische
Geschichtsphilosophie des Dichters nicht berücksichtigt, die eben wohl oder übel von
den »Brettern, die die Welt bedeuten«, herunter anschaulich werden muß, so ist
Georgy von vornherein stark geschichtsphiiosophisch eingestellt. Er lebt in Hebbel,
er schaut die Welt mit Hebbels Augen an, und er glaubt in diesem Augenblick auf
einer »Jahrtausendwende« im Sinne Hebbels zu stehen, in der alle Vorbedingungen
zu einer neuen Nibelungentragödie liegen. Durch sein ganzes Buch, dessen nicht
gerade »schön« zu nennender Stil etwas Zerkämpftes an sich hat, geht die mit
persönlichstem Tone vorgetragene Überzeugung, daß Hebbel der Mann ist, dessen
Führung und Vorbild uns heute nottut. Die technische Spezialform des Dramas
kümmert ihn wenig. Er betont vielmehr, »daß das Tragische nicht bloß der höchsten
aller Kunstformen, der Tragödie, eignet, sondern in jeder anderen sich einen Körper
bauen kann« (S. 431). Mit dieser Auffassung, der sich Hebbel selbst gewiß ange-
schlossen hätte, und durchdrungen von dessen fragischer Theorie (auch aus Vischers
Ästhetik hat er viel zu lernen verstanden) geht Georgy an die Meistertragödien seines
Dichters heran, um sie bis ins einzelnste zu analysieren und aus ihrer jeweiligen
Grundidee heraus erstehen zu lassen. Diese Grundidee scheint ihm bei der Judith
die Idee des Handelns zu sein, bei der Genoveva die Idee der reinen Anschauung,
bei der Maria Magdalena die Idee der Maßlosigkeit, bei Herodes und Mariamne die
Idee der Innerlichkeit, bei Agnes Bernauer die Idee des Opfers, beim Gyges die Idee
der Sitte. Begreiflicherweise konnte es dabei nicht ganz ohne eigenwillige Kon-
struktionen abgehen, doch unterscheidet Georgy sehr wohl einen abstrakten Grund-
gedanken von einer lebendigen Keimzelle (d.i. Idee), ja er warnt sogar an einer
Stelle (S. 21) vor den »Irrgängen der Identitätsphilosophie«. Bei der Analyse der
Nibelungen (wohl das Gedankentiefste, was bisher überhaupt über die Trilogie ge-
sagt worden ist!) wird dieses konkrete Bemühen besonders deutlich. Der Gedanke
»Kampf zwischen zwei Weltanschauungen auf einer Menschheitswende«, sagt Georgy
hat Hebbels Kunstwerk nicht den Körper gegeben: er reichte zwar für Rahmen und
Hintergrund, aber etwas Menschlich-Lebendiges konnte nicht daraus erwachsen Ein
gibt. Zum Drama gehört der Held. »Maria Magdalena hat keinen Helden« (S. 31),
Herodes ist ein törichter Held, der »mit wahrhaft kläglichen Mitteln das Unters-
Schwert-Stellen der Mariamne ins Werk setzt« (S. 42), aus Agnes Bernauer hätte ein
Albrecht werden sollen (S. 49), »Rhodopens Tod ist durchaus untragisch«: sie ist
keine Heldin, »aber in dem Zergehen des Freundschaftsverhältnisses zwischen Gyges
und Kandaules ist eins der großen tragischen Geschicke geschildert« (S. 52 f.). An
den Nibelungen entwickelt Scholz sein hauptsächlichstes Bedenken: »Hebbel, der
schon vom abstrakt gefaßten tragischen Problem ausgehend so oft episch gestaltete,
hat dabei den epischen Zusammenhang des Gedichtes nicht aufgelöst, nicht durch
einen neuen dramatischen ersetzt« (S. 56). So bleibt »Siegfrieds Tod in sich un-
tragisch« (S. 59); der Dichter hat »die quälend-untragischen Momente des alten Epos«
beibehalten; in dem »so viel eindringlicher redenden Drama« können sie »in ihrer
ausgleichslosen Bitterkeit nur niederdrücken oder empören« (S. 55). Es ist klar, daß
Scholz hier den dramaturgischen Standpunkt bis zur Verwechslung von tragisch und
dramatisch verabsolutiert und so nicht einmal dem Tragödiendichter Hebbel gerecht
wird, geschweige denn dem Künstler Hebbel überhaupt. Er entschädigt uns für diese
Einseitigkeit durch wertvolle Hinweise und Anmerkungen, wie sie nur ein Bühnen-
kundiger geben kann. Besonders gut ist es ihm bei der Judith gelungen.
Ganz anders Ernst August Georgy. Geht Scholz der Spekulation nach
Möglichkeit aus dem Wege, so gipfelt Georgys Buch geradezu in einem metaphysi-
schen Schlußabschnitt: Die Idee des Tragischen bei Friedrich Hebbel. Kann Scholz
zu keiner gerechten Würdigung der Nibelungen kommen, weil er die ästhetische
Geschichtsphilosophie des Dichters nicht berücksichtigt, die eben wohl oder übel von
den »Brettern, die die Welt bedeuten«, herunter anschaulich werden muß, so ist
Georgy von vornherein stark geschichtsphiiosophisch eingestellt. Er lebt in Hebbel,
er schaut die Welt mit Hebbels Augen an, und er glaubt in diesem Augenblick auf
einer »Jahrtausendwende« im Sinne Hebbels zu stehen, in der alle Vorbedingungen
zu einer neuen Nibelungentragödie liegen. Durch sein ganzes Buch, dessen nicht
gerade »schön« zu nennender Stil etwas Zerkämpftes an sich hat, geht die mit
persönlichstem Tone vorgetragene Überzeugung, daß Hebbel der Mann ist, dessen
Führung und Vorbild uns heute nottut. Die technische Spezialform des Dramas
kümmert ihn wenig. Er betont vielmehr, »daß das Tragische nicht bloß der höchsten
aller Kunstformen, der Tragödie, eignet, sondern in jeder anderen sich einen Körper
bauen kann« (S. 431). Mit dieser Auffassung, der sich Hebbel selbst gewiß ange-
schlossen hätte, und durchdrungen von dessen fragischer Theorie (auch aus Vischers
Ästhetik hat er viel zu lernen verstanden) geht Georgy an die Meistertragödien seines
Dichters heran, um sie bis ins einzelnste zu analysieren und aus ihrer jeweiligen
Grundidee heraus erstehen zu lassen. Diese Grundidee scheint ihm bei der Judith
die Idee des Handelns zu sein, bei der Genoveva die Idee der reinen Anschauung,
bei der Maria Magdalena die Idee der Maßlosigkeit, bei Herodes und Mariamne die
Idee der Innerlichkeit, bei Agnes Bernauer die Idee des Opfers, beim Gyges die Idee
der Sitte. Begreiflicherweise konnte es dabei nicht ganz ohne eigenwillige Kon-
struktionen abgehen, doch unterscheidet Georgy sehr wohl einen abstrakten Grund-
gedanken von einer lebendigen Keimzelle (d.i. Idee), ja er warnt sogar an einer
Stelle (S. 21) vor den »Irrgängen der Identitätsphilosophie«. Bei der Analyse der
Nibelungen (wohl das Gedankentiefste, was bisher überhaupt über die Trilogie ge-
sagt worden ist!) wird dieses konkrete Bemühen besonders deutlich. Der Gedanke
»Kampf zwischen zwei Weltanschauungen auf einer Menschheitswende«, sagt Georgy
hat Hebbels Kunstwerk nicht den Körper gegeben: er reichte zwar für Rahmen und
Hintergrund, aber etwas Menschlich-Lebendiges konnte nicht daraus erwachsen Ein