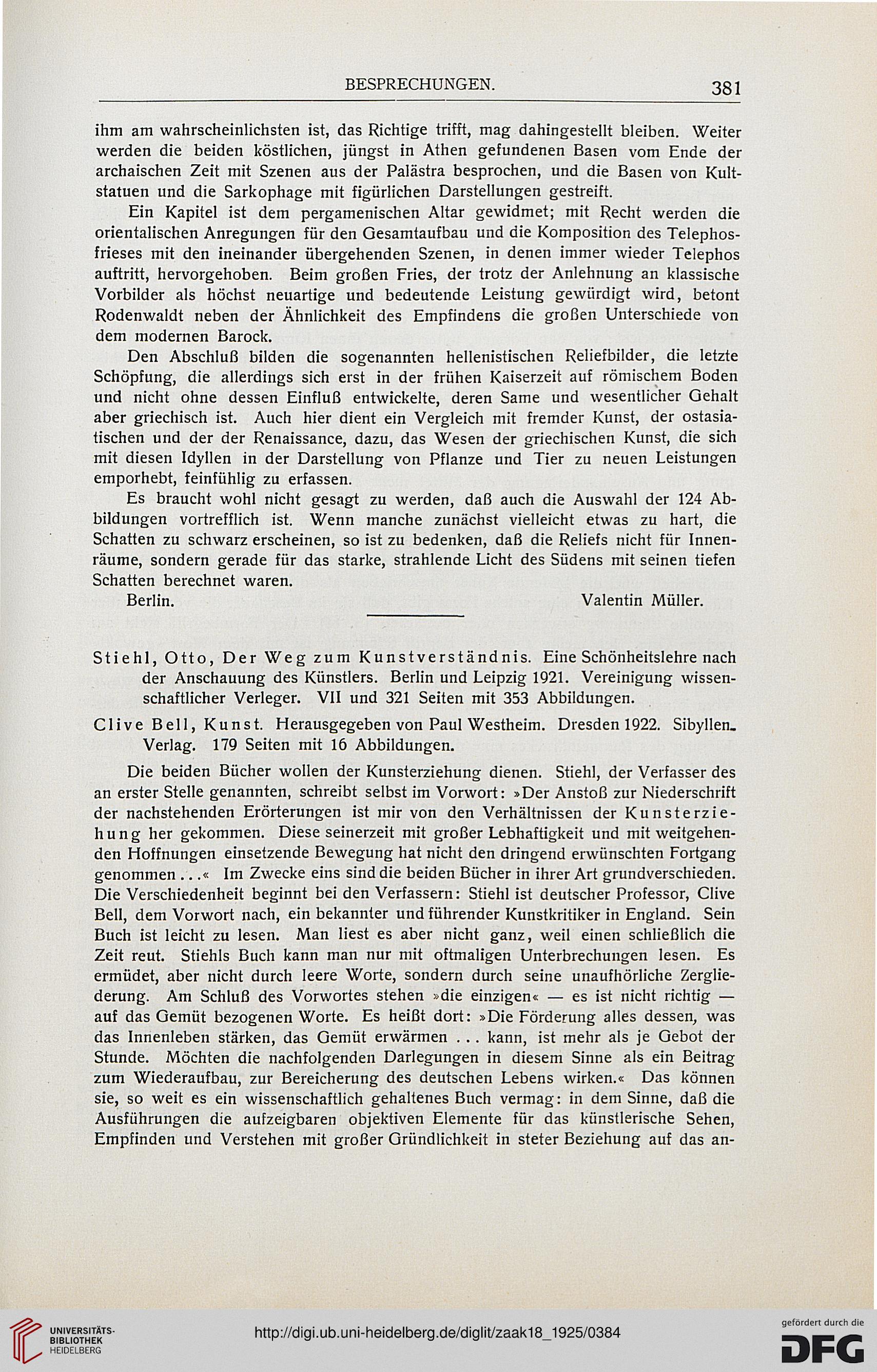BESPRECHUNGEN. 33]
ihm am wahrscheinlichsten ist, das Richtige trifft, mag dahingestellt bleiben. Weiter
werden die beiden köstlichen, jüngst in Athen gefundenen Basen vom Ende der
archaischen Zeit mit Szenen aus der Palästra besprochen, und die Basen von Kult-
statuen und die Sarkophage mit figürlichen Darstellungen gestreift.
Ein Kapitel ist dem pergamenischen Altar gewidmet; mit Recht werden die
orientalischen Anregungen für den Gesamtaufbau und die Komposition des Telephos-
frieses mit den ineinander übergehenden Szenen, in denen immer wieder Telephos
auftritt, hervorgehoben. Beim großen Fries, der trotz der Anlehnung an klassische
Vorbilder als höchst neuartige und bedeutende Leistung gewürdigt wird, betont
Rodenwaldt neben der Ähnlichkeit des Empfindens die großen Unterschiede von
dem modernen Barock.
Den Abschluß bilden die sogenannten hellenistischen Reliefbilder, die letzte
Schöpfung, die allerdings sich erst in der frühen Kaiserzeit auf römischem Boden
und nicht ohne dessen Einfluß entwickelte, deren Same und wesentlicher Gehalt
aber griechisch ist. Auch hier dient ein Vergleich mit fremder Kunst, der ostasia-
tischen und der der Renaissance, dazu, das Wesen der griechischen Kunst, die sich
mit diesen Idyllen in der Darstellung von Pflanze und Tier zu neuen Leistungen
emporhebt, feinfühlig zu erfassen.
Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, daß auch die Auswahl der 124 Ab-
bildungen vortrefflich ist. Wenn manche zunächst vielleicht etwas zu hart, die
Schatten zu schwarz erscheinen, so ist zu bedenken, daß die Reliefs nicht für Innen-
räume, sondern gerade für das starke, strahlende Licht des Südens mit seinen tiefen
Schatten berechnet waren.
Berlin. Valentin Müller.
Stiehl, Otto, Der Weg zum Kunstverständnis. Eine Schönheitslehre nach
der Anschauung des Künstlers. Berlin und Leipzig 1921. Vereinigung wissen-
schaftlicher Verleger. VII und 321 Seiten mit 353 Abbildungen.
Clive Bell, Kunst. Herausgegeben von Paul Westheim. Dresden 1922. Sibyllen.
Verlag. 179 Seiten mit 16 Abbildungen.
Die beiden Bücher wollen der Kunsterziehung dienen. Stiehl, der Verfasser des
an erster Stelle genannten, schreibt selbst im Vorwort: »Der Anstoß zur Niederschrift
der nachstehenden Erörterungen ist mir von den Verhältnissen der Kunsterzie-
hung her gekommen. Diese seinerzeit mit großer Lebhaftigkeit und mit weitgehen-
den Hoffnungen einsetzende Bewegung hat nicht den dringend erwünschten Fortgang
genommen ...« Im Zwecke eins sind die beiden Bücher in ihrer Art grundverschieden.
Die Verschiedenheit beginnt bei den Verfassern: Stiehl ist deutscher Professor, Clive
Bell, dem Vorwort nach, ein bekannter und führender Kunstkritiker in England. Sein
Buch ist leicht zu lesen. Man liest es aber nicht ganz, weil einen schließlich die
Zeit reut. Stiehls Buch kann man nur mit oftmaligen Unterbrechungen lesen. Es
ermüdet, aber nicht durch leere Worte, sondern durch seine unaufhörliche Zerglie-
derung. Am Schluß des Vorwortes stehen »die einzigen« — es ist nicht richtig —
auf das Gemüt bezogenen Worte. Es heißt dort: »Die Förderung alles dessen, was
das Innenleben stärken, das Gemüt erwärmen . . . kann, ist mehr als je Gebot der
Stunde. Möchten die nachfolgenden Darlegungen in diesem Sinne als ein Beitrag
zum Wiederaufbau, zur Bereicherung des deutschen Lebens wirken.« Das können
sie, so weit es ein wissenschaftlich gehaltenes Buch vermag: in dem Sinne, daß die
Ausführungen die aufzeigbaren objektiven Elemente für das künstlerische Sehen,
Empfinden und Verstehen mit großer Gründlichkeit in steter Beziehung auf das an-
ihm am wahrscheinlichsten ist, das Richtige trifft, mag dahingestellt bleiben. Weiter
werden die beiden köstlichen, jüngst in Athen gefundenen Basen vom Ende der
archaischen Zeit mit Szenen aus der Palästra besprochen, und die Basen von Kult-
statuen und die Sarkophage mit figürlichen Darstellungen gestreift.
Ein Kapitel ist dem pergamenischen Altar gewidmet; mit Recht werden die
orientalischen Anregungen für den Gesamtaufbau und die Komposition des Telephos-
frieses mit den ineinander übergehenden Szenen, in denen immer wieder Telephos
auftritt, hervorgehoben. Beim großen Fries, der trotz der Anlehnung an klassische
Vorbilder als höchst neuartige und bedeutende Leistung gewürdigt wird, betont
Rodenwaldt neben der Ähnlichkeit des Empfindens die großen Unterschiede von
dem modernen Barock.
Den Abschluß bilden die sogenannten hellenistischen Reliefbilder, die letzte
Schöpfung, die allerdings sich erst in der frühen Kaiserzeit auf römischem Boden
und nicht ohne dessen Einfluß entwickelte, deren Same und wesentlicher Gehalt
aber griechisch ist. Auch hier dient ein Vergleich mit fremder Kunst, der ostasia-
tischen und der der Renaissance, dazu, das Wesen der griechischen Kunst, die sich
mit diesen Idyllen in der Darstellung von Pflanze und Tier zu neuen Leistungen
emporhebt, feinfühlig zu erfassen.
Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, daß auch die Auswahl der 124 Ab-
bildungen vortrefflich ist. Wenn manche zunächst vielleicht etwas zu hart, die
Schatten zu schwarz erscheinen, so ist zu bedenken, daß die Reliefs nicht für Innen-
räume, sondern gerade für das starke, strahlende Licht des Südens mit seinen tiefen
Schatten berechnet waren.
Berlin. Valentin Müller.
Stiehl, Otto, Der Weg zum Kunstverständnis. Eine Schönheitslehre nach
der Anschauung des Künstlers. Berlin und Leipzig 1921. Vereinigung wissen-
schaftlicher Verleger. VII und 321 Seiten mit 353 Abbildungen.
Clive Bell, Kunst. Herausgegeben von Paul Westheim. Dresden 1922. Sibyllen.
Verlag. 179 Seiten mit 16 Abbildungen.
Die beiden Bücher wollen der Kunsterziehung dienen. Stiehl, der Verfasser des
an erster Stelle genannten, schreibt selbst im Vorwort: »Der Anstoß zur Niederschrift
der nachstehenden Erörterungen ist mir von den Verhältnissen der Kunsterzie-
hung her gekommen. Diese seinerzeit mit großer Lebhaftigkeit und mit weitgehen-
den Hoffnungen einsetzende Bewegung hat nicht den dringend erwünschten Fortgang
genommen ...« Im Zwecke eins sind die beiden Bücher in ihrer Art grundverschieden.
Die Verschiedenheit beginnt bei den Verfassern: Stiehl ist deutscher Professor, Clive
Bell, dem Vorwort nach, ein bekannter und führender Kunstkritiker in England. Sein
Buch ist leicht zu lesen. Man liest es aber nicht ganz, weil einen schließlich die
Zeit reut. Stiehls Buch kann man nur mit oftmaligen Unterbrechungen lesen. Es
ermüdet, aber nicht durch leere Worte, sondern durch seine unaufhörliche Zerglie-
derung. Am Schluß des Vorwortes stehen »die einzigen« — es ist nicht richtig —
auf das Gemüt bezogenen Worte. Es heißt dort: »Die Förderung alles dessen, was
das Innenleben stärken, das Gemüt erwärmen . . . kann, ist mehr als je Gebot der
Stunde. Möchten die nachfolgenden Darlegungen in diesem Sinne als ein Beitrag
zum Wiederaufbau, zur Bereicherung des deutschen Lebens wirken.« Das können
sie, so weit es ein wissenschaftlich gehaltenes Buch vermag: in dem Sinne, daß die
Ausführungen die aufzeigbaren objektiven Elemente für das künstlerische Sehen,
Empfinden und Verstehen mit großer Gründlichkeit in steter Beziehung auf das an-