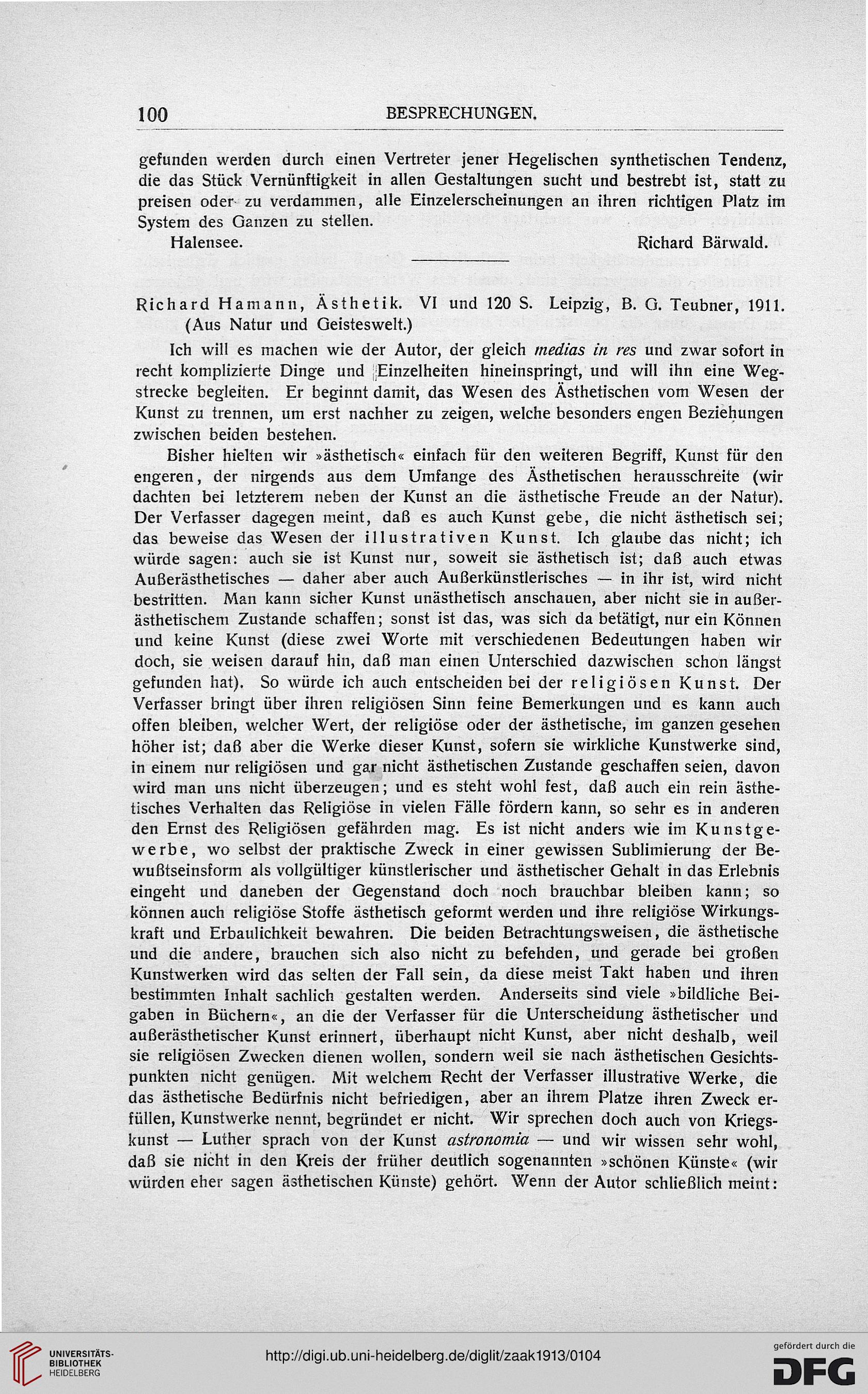100 BESPRECHUNGEN.
gefunden werden durch einen Vertreter jener Hegelischen synthetischen Tendenz,
die das Stück Vernünftigkeit in allen Gestaltungen sucht und bestrebt ist, statt zu
preisen oder zu verdammen, alle Einzelerscheinungen an ihren richtigen Platz im
System des Ganzen zu stellen.
Haiensee. Richard Bärvvald.
Richard Hamann, Ästhetik. VI und 120 S. Leipzig, B. G. Teubner, 1911.
(Aus Natur und Geisteswelt.)
Ich will es machen wie der Autor, der gleich medias in res und zwar sofort in
recht komplizierte Dinge und Einzelheiten hineinspringt, und will ihn eine Weg-
strecke begleiten. Er beginnt damit, das Wesen des Ästhetischen vom Wesen der
Kunst zu trennen, um erst nachher zu zeigen, welche besonders engen Beziehungen
zwischen beiden bestehen.
Bisher hielten wir »ästhetisch« einfach für den weiteren Begriff, Kunst für den
engeren, der nirgends aus dem Umfange des Ästhetischen herausschreite (wir
dachten bei letzterem neben der Kunst an die ästhetische Freude an der Natur).
Der Verfasser dagegen meint, daß es auch Kunst gebe, die nicht ästhetisch sei;
das beweise das Wesen der illustrativen Kunst. Ich glaube das nicht; ich
würde sagen: auch sie ist Kunst nur, soweit sie ästhetisch ist; daß auch etwas
Außerästhetisches — daher aber auch Außerkünstlerisches — in ihr ist, wird nicht
bestritten. Man kann sicher Kunst unästhetisch anschauen, aber nicht sie in außer-
ästhetischem Zustande schaffen; sonst ist das, was sich da betätigt, nur ein Können
und keine Kunst (diese zwei Worte mit verschiedenen Bedeutungen haben wir
doch, sie weisen darauf hin, daß man einen Unterschied dazwischen schon längst
gefunden hat). So würde ich auch entscheiden bei der religiösen Kunst. Der
Verfasser bringt über ihren religiösen Sinn feine Bemerkungen und es kann auch
offen bleiben, welcher Wert, der religiöse oder der ästhetische, im ganzen gesehen
höher ist; daß aber die Werke dieser Kunst, sofern sie wirkliche Kunstwerke sind,
in einem nur religiösen und gar nicht ästhetischen Zustande geschaffen seien, davon
wird man uns nicht überzeugen; und es steht wohl fest, daß auch ein rein ästhe-
tisches Verhalten das Religiöse in vielen Fälle fördern kann, so sehr es in anderen
den Ernst des Religiösen gefährden mag. Es ist nicht anders wie im Kunstge-
werbe, wo selbst der praktische Zweck in einer gewissen Sublimierung der Be-
wußtseinsform als vollgültiger künstlerischer und ästhetischer Gehalt in das Erlebnis
eingeht und daneben der Gegenstand doch noch brauchbar bleiben kann; so
können auch religiöse Stoffe ästhetisch geformt werden und ihre religiöse Wirkungs-
kraft und Erbaulichkeit bewahren. Die beiden Betrachtungsweisen, die ästhetische
und die andere, brauchen sich also nicht zu befehden, und gerade bei großen
Kunstwerken wird das selten der Fall sein, da diese meist Takt haben und ihren
bestimmten Inhalt sachlich gestalten werden. Anderseits sind viele »bildliche Bei-
gaben in Büchern«, an die der Verfasser für die Unterscheidung ästhetischer und
außerästhetischer Kunst erinnert, überhaupt nicht Kunst, aber nicht deshalb, weil
sie religiösen Zwecken dienen wollen, sondern weil sie nach ästhetischen Gesichts-
punkten nicht genügen. Mit welchem Recht der Verfasser illustrative Werke, die
das ästhetische Bedürfnis nicht befriedigen, aber an ihrem Platze ihren Zweck er-
füllen, Kunstwerke nennt, begründet er nicht. Wir sprechen doch auch von Kriegs-
kunst — Luther sprach von der Kunst astronomia — und wir wissen sehr wohl,
daß sie nicht in den Kreis der früher deutlich sogenannten »schönen Künste« (wir
würden eher sagen ästhetischen Künste) gehört. Wenn der Autor schließlich meint:
gefunden werden durch einen Vertreter jener Hegelischen synthetischen Tendenz,
die das Stück Vernünftigkeit in allen Gestaltungen sucht und bestrebt ist, statt zu
preisen oder zu verdammen, alle Einzelerscheinungen an ihren richtigen Platz im
System des Ganzen zu stellen.
Haiensee. Richard Bärvvald.
Richard Hamann, Ästhetik. VI und 120 S. Leipzig, B. G. Teubner, 1911.
(Aus Natur und Geisteswelt.)
Ich will es machen wie der Autor, der gleich medias in res und zwar sofort in
recht komplizierte Dinge und Einzelheiten hineinspringt, und will ihn eine Weg-
strecke begleiten. Er beginnt damit, das Wesen des Ästhetischen vom Wesen der
Kunst zu trennen, um erst nachher zu zeigen, welche besonders engen Beziehungen
zwischen beiden bestehen.
Bisher hielten wir »ästhetisch« einfach für den weiteren Begriff, Kunst für den
engeren, der nirgends aus dem Umfange des Ästhetischen herausschreite (wir
dachten bei letzterem neben der Kunst an die ästhetische Freude an der Natur).
Der Verfasser dagegen meint, daß es auch Kunst gebe, die nicht ästhetisch sei;
das beweise das Wesen der illustrativen Kunst. Ich glaube das nicht; ich
würde sagen: auch sie ist Kunst nur, soweit sie ästhetisch ist; daß auch etwas
Außerästhetisches — daher aber auch Außerkünstlerisches — in ihr ist, wird nicht
bestritten. Man kann sicher Kunst unästhetisch anschauen, aber nicht sie in außer-
ästhetischem Zustande schaffen; sonst ist das, was sich da betätigt, nur ein Können
und keine Kunst (diese zwei Worte mit verschiedenen Bedeutungen haben wir
doch, sie weisen darauf hin, daß man einen Unterschied dazwischen schon längst
gefunden hat). So würde ich auch entscheiden bei der religiösen Kunst. Der
Verfasser bringt über ihren religiösen Sinn feine Bemerkungen und es kann auch
offen bleiben, welcher Wert, der religiöse oder der ästhetische, im ganzen gesehen
höher ist; daß aber die Werke dieser Kunst, sofern sie wirkliche Kunstwerke sind,
in einem nur religiösen und gar nicht ästhetischen Zustande geschaffen seien, davon
wird man uns nicht überzeugen; und es steht wohl fest, daß auch ein rein ästhe-
tisches Verhalten das Religiöse in vielen Fälle fördern kann, so sehr es in anderen
den Ernst des Religiösen gefährden mag. Es ist nicht anders wie im Kunstge-
werbe, wo selbst der praktische Zweck in einer gewissen Sublimierung der Be-
wußtseinsform als vollgültiger künstlerischer und ästhetischer Gehalt in das Erlebnis
eingeht und daneben der Gegenstand doch noch brauchbar bleiben kann; so
können auch religiöse Stoffe ästhetisch geformt werden und ihre religiöse Wirkungs-
kraft und Erbaulichkeit bewahren. Die beiden Betrachtungsweisen, die ästhetische
und die andere, brauchen sich also nicht zu befehden, und gerade bei großen
Kunstwerken wird das selten der Fall sein, da diese meist Takt haben und ihren
bestimmten Inhalt sachlich gestalten werden. Anderseits sind viele »bildliche Bei-
gaben in Büchern«, an die der Verfasser für die Unterscheidung ästhetischer und
außerästhetischer Kunst erinnert, überhaupt nicht Kunst, aber nicht deshalb, weil
sie religiösen Zwecken dienen wollen, sondern weil sie nach ästhetischen Gesichts-
punkten nicht genügen. Mit welchem Recht der Verfasser illustrative Werke, die
das ästhetische Bedürfnis nicht befriedigen, aber an ihrem Platze ihren Zweck er-
füllen, Kunstwerke nennt, begründet er nicht. Wir sprechen doch auch von Kriegs-
kunst — Luther sprach von der Kunst astronomia — und wir wissen sehr wohl,
daß sie nicht in den Kreis der früher deutlich sogenannten »schönen Künste« (wir
würden eher sagen ästhetischen Künste) gehört. Wenn der Autor schließlich meint: