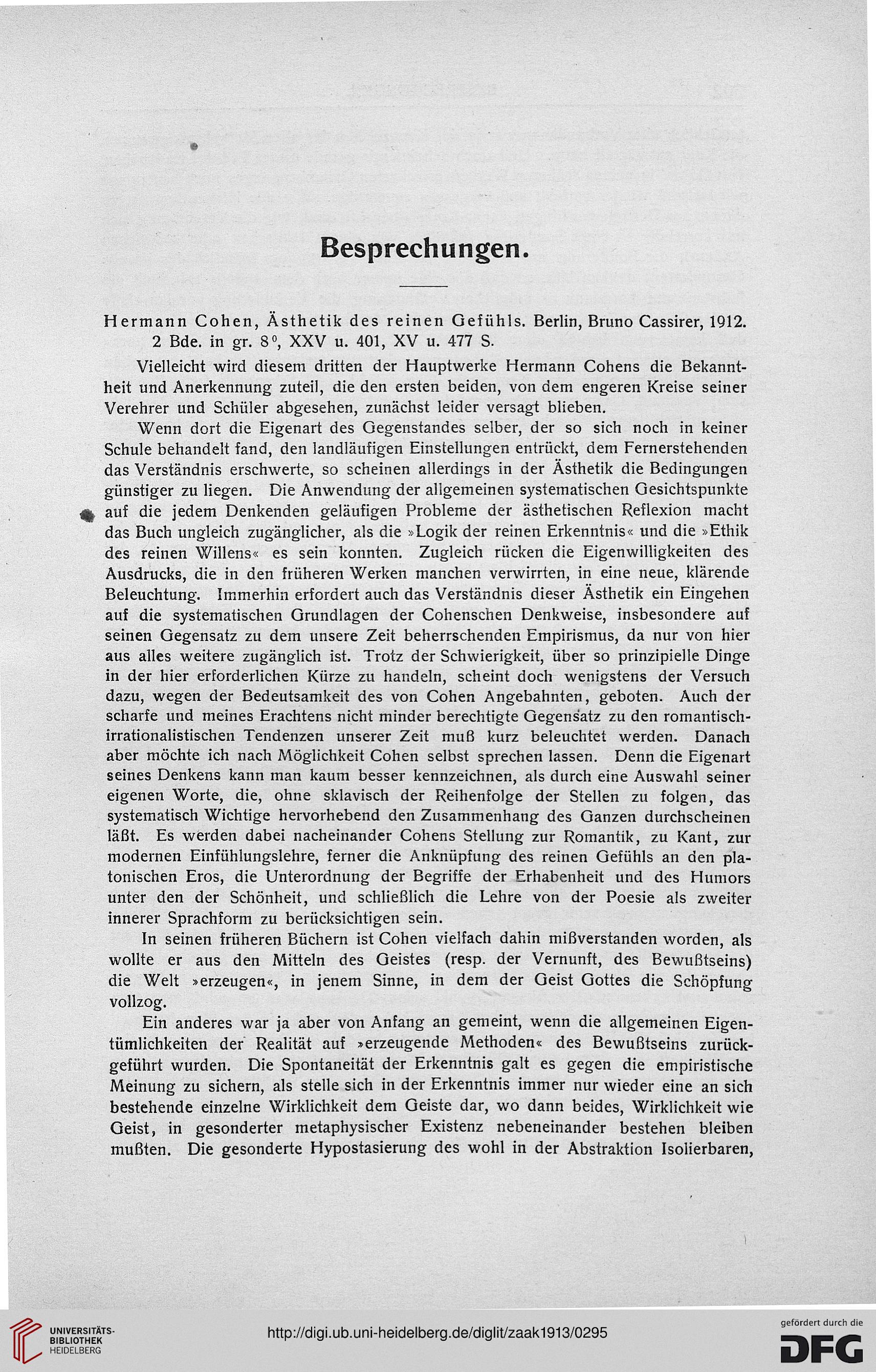Besprechungen.
Hermann Cohen, Ästhetik des reinen Gefühls. Berlin, Bruno Cassirer, 1912.
2 Bde. in gr. 8°, XXV u. 401, XV u. 477 S.
Vielleicht wird diesem dritten der Hauptwerke Hermann Cohens die Bekannt-
heit und Anerkennung zuteil, die den ersten beiden, von dem engeren Kreise seiner
Verehrer und Schüler abgesehen, zunächst leider versagt blieben.
Wenn dort die Eigenart des Gegenstandes selber, der so sich noch in keiner
Schule behandelt fand, den landläufigen Einstellungen entrückt, dem Fernerstehenden
das Verständnis erschwerte, so scheinen allerdings in der Ästhetik die Bedingungen
günstiger zu liegen. Die Anwendung der allgemeinen systematischen Gesichtspunkte
auf die jedem Denkenden geläufigen Probleme der ästhetischen Reflexion macht
das Buch ungleich zugänglicher, als die »Logik der reinen Erkenntnis« und die »Ethik
des reinen Willens« es sein konnten. Zugleich rücken die Eigenwilligkeiten des
Ausdrucks, die in den früheren Werken manchen verwirrten, in eine neue, klärende
Beleuchtung. Immerhin erfordert auch das Verständnis dieser Ästhetik ein Eingehen
auf die systematischen Grundlagen der Cohenschen Denkweise, insbesondere auf
seinen Gegensatz zu dem unsere Zeit beherrschenden Empirismus, da nur von hier
aus alles weitere zugänglich ist. Trotz der Schwierigkeit, über so prinzipielle Dinge
in der hier erforderlichen Kürze zu handeln, scheint doch wenigstens der Versuch
dazu, wegen der Bedeutsamkeit des von Cohen Angebahnten, geboten. Auch der
scharfe und meines Erachtens nicht minder berechtigte Gegensatz zu den romantisch-
irrationalistischen Tendenzen unserer Zeit muß kurz beleuchtet werden. Danach
aber möchte ich nach Möglichkeit Cohen selbst sprechen lassen. Denn die Eigenart
seines Denkens kann man kaum besser kennzeichnen, als durch eine Auswahl seiner
eigenen Worte, die, ohne sklavisch der Reihenfolge der Stellen zu folgen, das
systematisch Wichtige hervorhebend den Zusammenhang des Ganzen durchscheinen
läßt. Es werden dabei nacheinander Cohens Stellung zur Romantik, zu Kant, zur
modernen Einfühlungslehre, ferner die Anknüpfung des reinen Gefühls an den pla-
tonischen Eros, die Unterordnung der Begriffe der Erhabenheit und des Humors
unter den der Schönheit, und schließlich die Lehre von der Poesie als zweiter
innerer Sprachform zu berücksichtigen sein.
In seinen früheren Büchern ist Cohen vielfach dahin mißverstanden worden, als
wollte er aus den Mitteln des Geistes (resp. der Vernunft, des Bewußtseins)
die Welt >erzeugen«, in jenem Sinne, in dem der Geist Gottes die Schöpfung
vollzog.
Ein anderes war ja aber von Anfang an gemeint, wenn die allgemeinen Eigen-
tümlichkeiten der Realität auf »erzeugende Methoden« des Bewußtseins zurück-
geführt wurden. Die Spontaneität der Erkenntnis galt es gegen die empiristische
Meinung zu sichern, als stelle sich in der Erkenntnis immer nur wieder eine an sich
bestehende einzelne Wirklichkeit dem Geiste dar, wo dann beides, Wirklichkeit wie
Geist, in gesonderter metaphysischer Existenz nebeneinander bestehen bleiben
mußten. Die gesonderte Hypostasierung des wohl in der Abstraktion Isolierbaren,
Hermann Cohen, Ästhetik des reinen Gefühls. Berlin, Bruno Cassirer, 1912.
2 Bde. in gr. 8°, XXV u. 401, XV u. 477 S.
Vielleicht wird diesem dritten der Hauptwerke Hermann Cohens die Bekannt-
heit und Anerkennung zuteil, die den ersten beiden, von dem engeren Kreise seiner
Verehrer und Schüler abgesehen, zunächst leider versagt blieben.
Wenn dort die Eigenart des Gegenstandes selber, der so sich noch in keiner
Schule behandelt fand, den landläufigen Einstellungen entrückt, dem Fernerstehenden
das Verständnis erschwerte, so scheinen allerdings in der Ästhetik die Bedingungen
günstiger zu liegen. Die Anwendung der allgemeinen systematischen Gesichtspunkte
auf die jedem Denkenden geläufigen Probleme der ästhetischen Reflexion macht
das Buch ungleich zugänglicher, als die »Logik der reinen Erkenntnis« und die »Ethik
des reinen Willens« es sein konnten. Zugleich rücken die Eigenwilligkeiten des
Ausdrucks, die in den früheren Werken manchen verwirrten, in eine neue, klärende
Beleuchtung. Immerhin erfordert auch das Verständnis dieser Ästhetik ein Eingehen
auf die systematischen Grundlagen der Cohenschen Denkweise, insbesondere auf
seinen Gegensatz zu dem unsere Zeit beherrschenden Empirismus, da nur von hier
aus alles weitere zugänglich ist. Trotz der Schwierigkeit, über so prinzipielle Dinge
in der hier erforderlichen Kürze zu handeln, scheint doch wenigstens der Versuch
dazu, wegen der Bedeutsamkeit des von Cohen Angebahnten, geboten. Auch der
scharfe und meines Erachtens nicht minder berechtigte Gegensatz zu den romantisch-
irrationalistischen Tendenzen unserer Zeit muß kurz beleuchtet werden. Danach
aber möchte ich nach Möglichkeit Cohen selbst sprechen lassen. Denn die Eigenart
seines Denkens kann man kaum besser kennzeichnen, als durch eine Auswahl seiner
eigenen Worte, die, ohne sklavisch der Reihenfolge der Stellen zu folgen, das
systematisch Wichtige hervorhebend den Zusammenhang des Ganzen durchscheinen
läßt. Es werden dabei nacheinander Cohens Stellung zur Romantik, zu Kant, zur
modernen Einfühlungslehre, ferner die Anknüpfung des reinen Gefühls an den pla-
tonischen Eros, die Unterordnung der Begriffe der Erhabenheit und des Humors
unter den der Schönheit, und schließlich die Lehre von der Poesie als zweiter
innerer Sprachform zu berücksichtigen sein.
In seinen früheren Büchern ist Cohen vielfach dahin mißverstanden worden, als
wollte er aus den Mitteln des Geistes (resp. der Vernunft, des Bewußtseins)
die Welt >erzeugen«, in jenem Sinne, in dem der Geist Gottes die Schöpfung
vollzog.
Ein anderes war ja aber von Anfang an gemeint, wenn die allgemeinen Eigen-
tümlichkeiten der Realität auf »erzeugende Methoden« des Bewußtseins zurück-
geführt wurden. Die Spontaneität der Erkenntnis galt es gegen die empiristische
Meinung zu sichern, als stelle sich in der Erkenntnis immer nur wieder eine an sich
bestehende einzelne Wirklichkeit dem Geiste dar, wo dann beides, Wirklichkeit wie
Geist, in gesonderter metaphysischer Existenz nebeneinander bestehen bleiben
mußten. Die gesonderte Hypostasierung des wohl in der Abstraktion Isolierbaren,