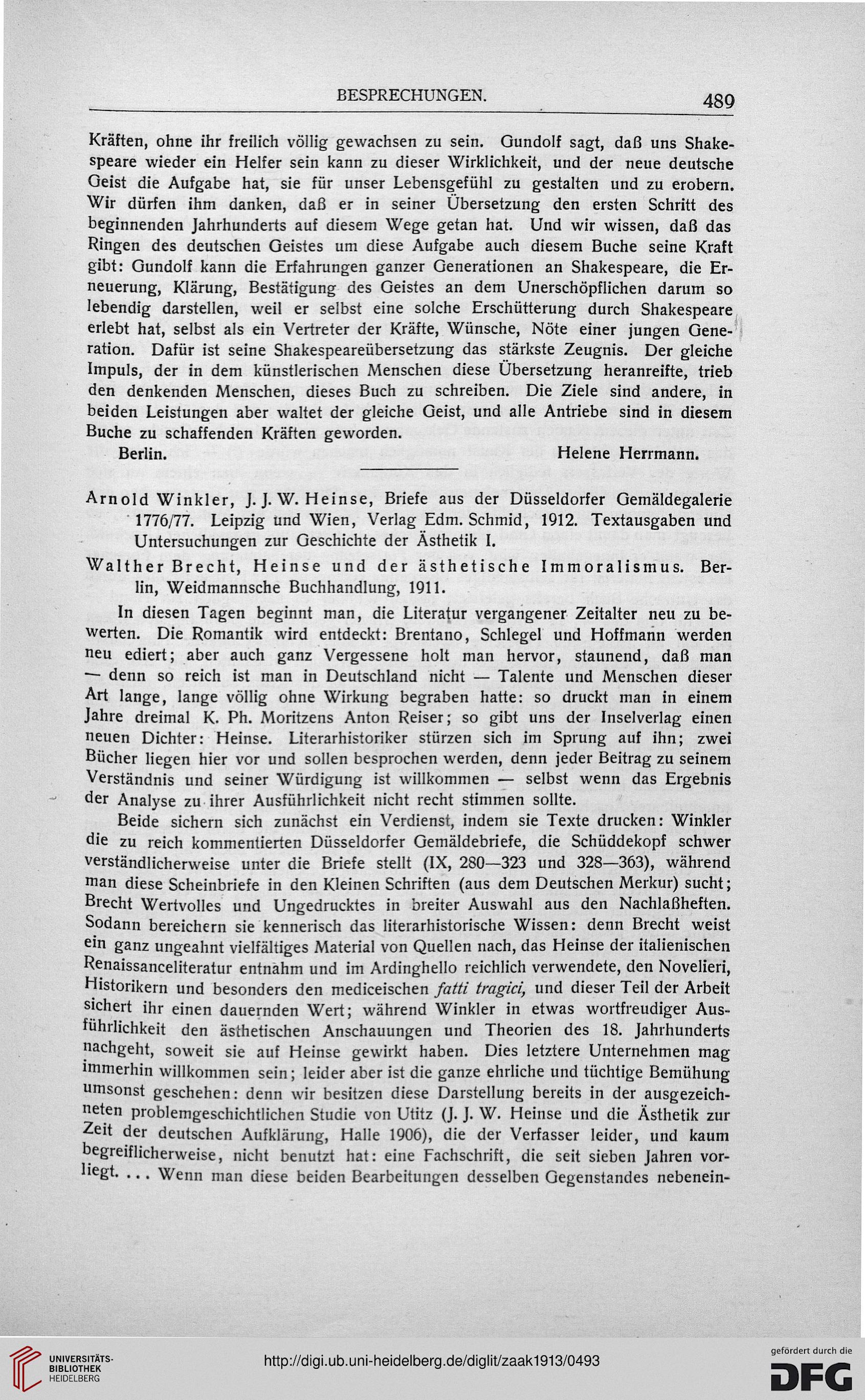BESPRECHUNGEN.
489
Kräften, ohne ihr freilich völlig gewachsen zu sein. Gundolf sagt, daß uns Shake-
speare wieder ein Helfer sein kann zu dieser Wirklichkeit, und der neue deutsche
Geist die Aufgabe hat, sie für unser Lebensgefühl zu gestalten und zu erobern.
Wir dürfen ihm danken, daß er in seiner Übersetzung den ersten Schritt des
beginnenden Jahrhunderts auf diesem Wege getan hat. Und wir wissen, daß das
Ringen des deutschen Geistes um diese Aufgabe auch diesem Buche seine Kraft
gibt: Gundolf kann die Erfahrungen ganzer Generationen an Shakespeare, die Er-
neuerung, Klärung, Bestätigung des Geistes an dem Unerschöpflichen darum so
lebendig darstellen, weil er selbst eine solche Erschütterung durch Shakespeare
erlebt hat, selbst als ein Vertreter der Kräfte, Wünsche, Nöte einer jungen Gene-
ration. Dafür ist seine Shakespeareübersetzung das stärkste Zeugnis. Der gleiche
Impuls, der in dem künstlerischen Menschen diese Übersetzung heranreifte, trieb
den denkenden Menschen, dieses Buch zu schreiben. Die Ziele sind andere, in
beiden Leistungen aber waltet der gleiche Geist, und alle Antriebe sind in diesem
Buche zu schaffenden Kräften geworden.
Berlin. Helene Herrmann.
Arnold Winkler, J. J. W. Heinse, Briefe aus der Düsseldorfer Gemäldegalerie
1776/77. Leipzig und Wien, Verlag Edm. Schmid, 1912. Textausgaben und
Untersuchungen zur Geschichte der Ästhetik I.
Walther Brecht, Heinse und der ästhetische Immoralismus. Ber-
lin, Weidmannsche Buchhandlung, 1911.
In diesen Tagen beginnt man, die Literatur vergangener Zeitalter neu zu be-
werten. Die Romantik wird entdeckt: Brentano, Schlegel und Hoffmann werden
neu ediert; aber auch ganz Vergessene holt man hervor, staunend, daß man
— denn so reich ist man in Deutschland nicht — Talente und Menschen dieser
Art lange, lange völlig ohne Wirkung begraben hatte: so druckt man in einem
Jahre dreimal K. Ph. Moritzens Anton Reiser; so gibt uns der Inselverlag einen
neuen Dichter: Heinse. Literarhistoriker stürzen sich im Sprung auf ihn; zwei
Bücher liegen hier vor und sollen besprochen werden, denn jeder Beitrag zu seinem
Verständnis und seiner Würdigung ist willkommen — selbst wenn das Ergebnis
der Analyse zu ihrer Ausführlichkeit nicht recht stimmen sollte.
Beide sichern sich zunächst ein Verdienst, indem sie Texte drucken: Winkler
die zu reich kommentierten Düsseldorfer Gemäldebriefe, die Schüddekopf schwer
verständlicherweise unter die Briefe stellt (IX, 280—323 und 328—363), während
man diese Scheinbriefe in den Kleinen Schriften (aus dem Deutschen Merkur) sucht;
Brecht Wertvolles und Ungedrucktes in breiter Auswahl aus den Nachlaßheften.
Sodann bereichern sie kennerisch das literarhistorische Wissen: denn Brecht weist
ein ganz ungeahnt vielfältiges Material von Quellen nach, das Heinse der italienischen
Renaissanceliteratur entnahm und im Ardinghello reichlich verwendete, den Novelieri,
Historikern und besonders den mediceischen fatti tragiti, und dieser Teil der Arbeit
sichert ihr einen dauernden Wert; während Winkler in etwas wortfreudiger Aus-
führlichkeit den ästhetischen Anschauungen und Theorien des 18. Jahrhunderts
nachgeht, soweit sie auf Heinse gewirkt haben. Dies letztere Unternehmen mag
immerhin willkommen sein; leider aber ist die ganze ehrliche und tüchtige Bemühung
umsonst geschehen: denn wir besitzen diese Darstellung bereits in der ausgezeich-
neten problemgeschichtlichen Studie von Utitz (J. J. W. Heinse und die Ästhetik zur
Zeit der deutschen Aufklärung, Halle 1906), die der Verfasser leider, und kaum
begreiflicherweise, nicht benutzt hat: eine Fachschrift, die seit sieben Jahren vor-
legt. .. . Wenn man diese beiden Bearbeitungen desselben Gegenstandes nebenein-
489
Kräften, ohne ihr freilich völlig gewachsen zu sein. Gundolf sagt, daß uns Shake-
speare wieder ein Helfer sein kann zu dieser Wirklichkeit, und der neue deutsche
Geist die Aufgabe hat, sie für unser Lebensgefühl zu gestalten und zu erobern.
Wir dürfen ihm danken, daß er in seiner Übersetzung den ersten Schritt des
beginnenden Jahrhunderts auf diesem Wege getan hat. Und wir wissen, daß das
Ringen des deutschen Geistes um diese Aufgabe auch diesem Buche seine Kraft
gibt: Gundolf kann die Erfahrungen ganzer Generationen an Shakespeare, die Er-
neuerung, Klärung, Bestätigung des Geistes an dem Unerschöpflichen darum so
lebendig darstellen, weil er selbst eine solche Erschütterung durch Shakespeare
erlebt hat, selbst als ein Vertreter der Kräfte, Wünsche, Nöte einer jungen Gene-
ration. Dafür ist seine Shakespeareübersetzung das stärkste Zeugnis. Der gleiche
Impuls, der in dem künstlerischen Menschen diese Übersetzung heranreifte, trieb
den denkenden Menschen, dieses Buch zu schreiben. Die Ziele sind andere, in
beiden Leistungen aber waltet der gleiche Geist, und alle Antriebe sind in diesem
Buche zu schaffenden Kräften geworden.
Berlin. Helene Herrmann.
Arnold Winkler, J. J. W. Heinse, Briefe aus der Düsseldorfer Gemäldegalerie
1776/77. Leipzig und Wien, Verlag Edm. Schmid, 1912. Textausgaben und
Untersuchungen zur Geschichte der Ästhetik I.
Walther Brecht, Heinse und der ästhetische Immoralismus. Ber-
lin, Weidmannsche Buchhandlung, 1911.
In diesen Tagen beginnt man, die Literatur vergangener Zeitalter neu zu be-
werten. Die Romantik wird entdeckt: Brentano, Schlegel und Hoffmann werden
neu ediert; aber auch ganz Vergessene holt man hervor, staunend, daß man
— denn so reich ist man in Deutschland nicht — Talente und Menschen dieser
Art lange, lange völlig ohne Wirkung begraben hatte: so druckt man in einem
Jahre dreimal K. Ph. Moritzens Anton Reiser; so gibt uns der Inselverlag einen
neuen Dichter: Heinse. Literarhistoriker stürzen sich im Sprung auf ihn; zwei
Bücher liegen hier vor und sollen besprochen werden, denn jeder Beitrag zu seinem
Verständnis und seiner Würdigung ist willkommen — selbst wenn das Ergebnis
der Analyse zu ihrer Ausführlichkeit nicht recht stimmen sollte.
Beide sichern sich zunächst ein Verdienst, indem sie Texte drucken: Winkler
die zu reich kommentierten Düsseldorfer Gemäldebriefe, die Schüddekopf schwer
verständlicherweise unter die Briefe stellt (IX, 280—323 und 328—363), während
man diese Scheinbriefe in den Kleinen Schriften (aus dem Deutschen Merkur) sucht;
Brecht Wertvolles und Ungedrucktes in breiter Auswahl aus den Nachlaßheften.
Sodann bereichern sie kennerisch das literarhistorische Wissen: denn Brecht weist
ein ganz ungeahnt vielfältiges Material von Quellen nach, das Heinse der italienischen
Renaissanceliteratur entnahm und im Ardinghello reichlich verwendete, den Novelieri,
Historikern und besonders den mediceischen fatti tragiti, und dieser Teil der Arbeit
sichert ihr einen dauernden Wert; während Winkler in etwas wortfreudiger Aus-
führlichkeit den ästhetischen Anschauungen und Theorien des 18. Jahrhunderts
nachgeht, soweit sie auf Heinse gewirkt haben. Dies letztere Unternehmen mag
immerhin willkommen sein; leider aber ist die ganze ehrliche und tüchtige Bemühung
umsonst geschehen: denn wir besitzen diese Darstellung bereits in der ausgezeich-
neten problemgeschichtlichen Studie von Utitz (J. J. W. Heinse und die Ästhetik zur
Zeit der deutschen Aufklärung, Halle 1906), die der Verfasser leider, und kaum
begreiflicherweise, nicht benutzt hat: eine Fachschrift, die seit sieben Jahren vor-
legt. .. . Wenn man diese beiden Bearbeitungen desselben Gegenstandes nebenein-