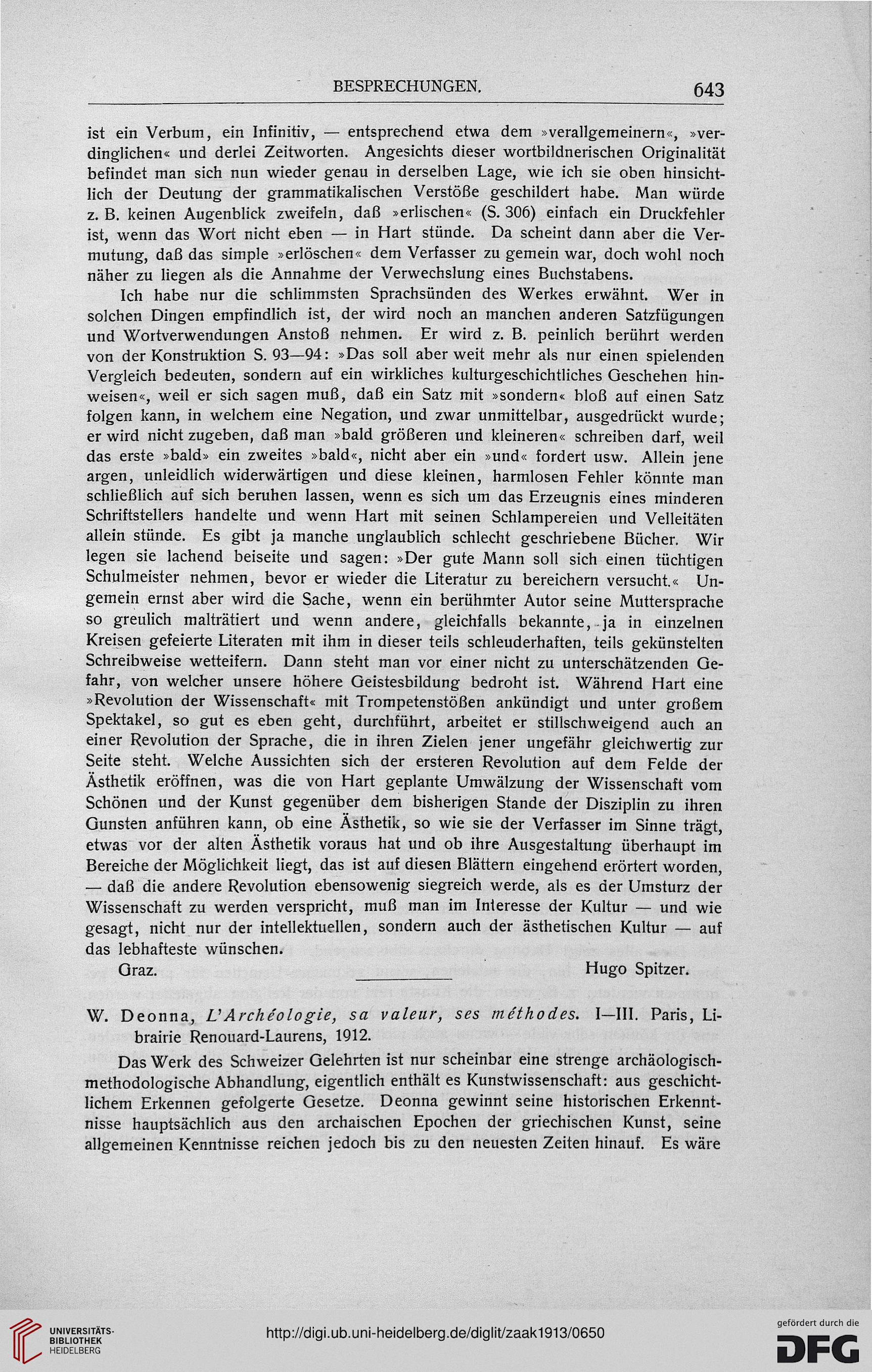BESPRECHUNGEN. 543
ist ein Verbum, ein Infinitiv, — entsprechend etwa dem »verallgemeinern«, »ver-
dinglichen« und derlei Zeitworten. Angesichts dieser wortbildnerischen Originalität
befindet man sich nun wieder genau in derselben Lage, wie ich sie oben hinsicht-
lich der Deutung der grammatikalischen Verstöße geschildert habe. Man würde
z.B. keinen Augenblick zweifeln, daß »erlischen« (S. 306) einfach ein Druckfehler
ist, wenn das Wort nicht eben — in Hart stünde. Da scheint dann aber die Ver-
mutung, daß das simple »erlöschen« dem Verfasser zu gemein war, doch wohl noch
näher zu liegen als die Annahme der Verwechslung eines Buchstabens.
Ich habe nur die schlimmsten Sprachsünden des Werkes erwähnt. Wer in
solchen Dingen empfindlich ist, der wird noch an manchen anderen Satzfügungen
und Wortverwendungen Anstoß nehmen. Er wird z. B. peinlich berührt werden
von der Konstruktion S. 93—04: »Das soll aber weit mehr als nur einen spielenden
Vergleich bedeuten, sondern auf ein wirkliches kulturgeschichtliches Geschehen hin-
weisen«, weil er sich sagen muß, daß ein Satz mit »sondern« bloß auf einen Satz
folgen kann, in welchem eine Negation, und zwar unmittelbar, ausgedrückt wurde;
er wird nicht zugeben, daß man »bald größeren und kleineren« schreiben darf, weil
das erste »bald» ein zweites »bald«, nicht aber ein »und« fordert usw. Allein jene
argen, unleidlich widerwärtigen und diese kleinen, harmlosen Fehler könnte man
schließlich auf sich beruhen lassen, wenn es sich um das Erzeugnis eines minderen
Schriftstellers handelte und wenn Hart mit seinen Schlampereien und Velleitäten
allein stünde. Es gibt ja manche unglaublich schlecht geschriebene Bücher. Wir
legen sie lachend beiseite und sagen: »Der gute Mann soll sich einen tüchtigen
Schulmeister nehmen, bevor er wieder die Literatur zu bereichern versucht.« Un-
gemein ernst aber wird die Sache, wenn ein berühmter Autor seine Muttersprache
so greulich malträtiert und wenn andere, gleichfalls bekannte, ja in einzelnen
Kreisen gefeierte Literaten mit ihm in dieser teils schleuderhaften, teils gekünstelten
Schreibweise wetteifern. Dann steht man vor einer nicht zu unterschätzenden Ge-
fahr, von welcher unsere höhere Geistesbildung bedroht ist. Während Hart eine
»Revolution der Wissenschaft« mit Trompetenstößen ankündigt und unter großem
Spektakel, so gut es eben geht, durchführt, arbeitet er stillschweigend auch an
einer Revolution der Sprache, die in ihren Zielen jener ungefähr gleichwertig zur
Seite steht. Welche Aussichten sich der ersteren Revolution auf dem Felde der
Ästhetik eröffnen, was die von Hart geplante Umwälzung der Wissenschaft vom
Schönen und der Kunst gegenüber dem bisherigen Stande der Disziplin zu ihren
Gunsten anführen kann, ob eine Ästhetik, so wie sie der Verfasser im Sinne trägt,
etwas vor der alten Ästhetik voraus hat und ob ihre Ausgestaltung überhaupt im
Bereiche der Möglichkeit liegt, das ist auf diesen Blättern eingehend erörtert worden,
— daß die andere Revolution ebensowenig siegreich werde, als es der Umsturz der
Wissenschaft zu werden verspricht, muß man im Interesse der Kultur — und wie
gesagt, nicht nur der intellektuellen, sondern auch der ästhetischen Kultur — auf
das lebhafteste wünschen.
Graz. ___________ Hugo Spitzer.
W. Deonna, VArche'ologie, sa valeur, ses me'thodes. I—III. Paris, Li-
brairie Renouard-Laurens, 1912.
Das Werk des Schweizer Gelehrten ist nur scheinbar eine strenge archäologisch-
methodologische Abhandlung, eigentlich enthält es Kunstwissenschaft: aus geschicht-
lichem Erkennen gefolgerte Gesetze. Deonna gewinnt seine historischen Erkennt-
nisse hauptsächlich aus den archaischen Epochen der griechischen Kunst, seine
allgemeinen Kenntnisse reichen jedoch bis zu den neuesten Zeiten hinauf. Es wäre
ist ein Verbum, ein Infinitiv, — entsprechend etwa dem »verallgemeinern«, »ver-
dinglichen« und derlei Zeitworten. Angesichts dieser wortbildnerischen Originalität
befindet man sich nun wieder genau in derselben Lage, wie ich sie oben hinsicht-
lich der Deutung der grammatikalischen Verstöße geschildert habe. Man würde
z.B. keinen Augenblick zweifeln, daß »erlischen« (S. 306) einfach ein Druckfehler
ist, wenn das Wort nicht eben — in Hart stünde. Da scheint dann aber die Ver-
mutung, daß das simple »erlöschen« dem Verfasser zu gemein war, doch wohl noch
näher zu liegen als die Annahme der Verwechslung eines Buchstabens.
Ich habe nur die schlimmsten Sprachsünden des Werkes erwähnt. Wer in
solchen Dingen empfindlich ist, der wird noch an manchen anderen Satzfügungen
und Wortverwendungen Anstoß nehmen. Er wird z. B. peinlich berührt werden
von der Konstruktion S. 93—04: »Das soll aber weit mehr als nur einen spielenden
Vergleich bedeuten, sondern auf ein wirkliches kulturgeschichtliches Geschehen hin-
weisen«, weil er sich sagen muß, daß ein Satz mit »sondern« bloß auf einen Satz
folgen kann, in welchem eine Negation, und zwar unmittelbar, ausgedrückt wurde;
er wird nicht zugeben, daß man »bald größeren und kleineren« schreiben darf, weil
das erste »bald» ein zweites »bald«, nicht aber ein »und« fordert usw. Allein jene
argen, unleidlich widerwärtigen und diese kleinen, harmlosen Fehler könnte man
schließlich auf sich beruhen lassen, wenn es sich um das Erzeugnis eines minderen
Schriftstellers handelte und wenn Hart mit seinen Schlampereien und Velleitäten
allein stünde. Es gibt ja manche unglaublich schlecht geschriebene Bücher. Wir
legen sie lachend beiseite und sagen: »Der gute Mann soll sich einen tüchtigen
Schulmeister nehmen, bevor er wieder die Literatur zu bereichern versucht.« Un-
gemein ernst aber wird die Sache, wenn ein berühmter Autor seine Muttersprache
so greulich malträtiert und wenn andere, gleichfalls bekannte, ja in einzelnen
Kreisen gefeierte Literaten mit ihm in dieser teils schleuderhaften, teils gekünstelten
Schreibweise wetteifern. Dann steht man vor einer nicht zu unterschätzenden Ge-
fahr, von welcher unsere höhere Geistesbildung bedroht ist. Während Hart eine
»Revolution der Wissenschaft« mit Trompetenstößen ankündigt und unter großem
Spektakel, so gut es eben geht, durchführt, arbeitet er stillschweigend auch an
einer Revolution der Sprache, die in ihren Zielen jener ungefähr gleichwertig zur
Seite steht. Welche Aussichten sich der ersteren Revolution auf dem Felde der
Ästhetik eröffnen, was die von Hart geplante Umwälzung der Wissenschaft vom
Schönen und der Kunst gegenüber dem bisherigen Stande der Disziplin zu ihren
Gunsten anführen kann, ob eine Ästhetik, so wie sie der Verfasser im Sinne trägt,
etwas vor der alten Ästhetik voraus hat und ob ihre Ausgestaltung überhaupt im
Bereiche der Möglichkeit liegt, das ist auf diesen Blättern eingehend erörtert worden,
— daß die andere Revolution ebensowenig siegreich werde, als es der Umsturz der
Wissenschaft zu werden verspricht, muß man im Interesse der Kultur — und wie
gesagt, nicht nur der intellektuellen, sondern auch der ästhetischen Kultur — auf
das lebhafteste wünschen.
Graz. ___________ Hugo Spitzer.
W. Deonna, VArche'ologie, sa valeur, ses me'thodes. I—III. Paris, Li-
brairie Renouard-Laurens, 1912.
Das Werk des Schweizer Gelehrten ist nur scheinbar eine strenge archäologisch-
methodologische Abhandlung, eigentlich enthält es Kunstwissenschaft: aus geschicht-
lichem Erkennen gefolgerte Gesetze. Deonna gewinnt seine historischen Erkennt-
nisse hauptsächlich aus den archaischen Epochen der griechischen Kunst, seine
allgemeinen Kenntnisse reichen jedoch bis zu den neuesten Zeiten hinauf. Es wäre