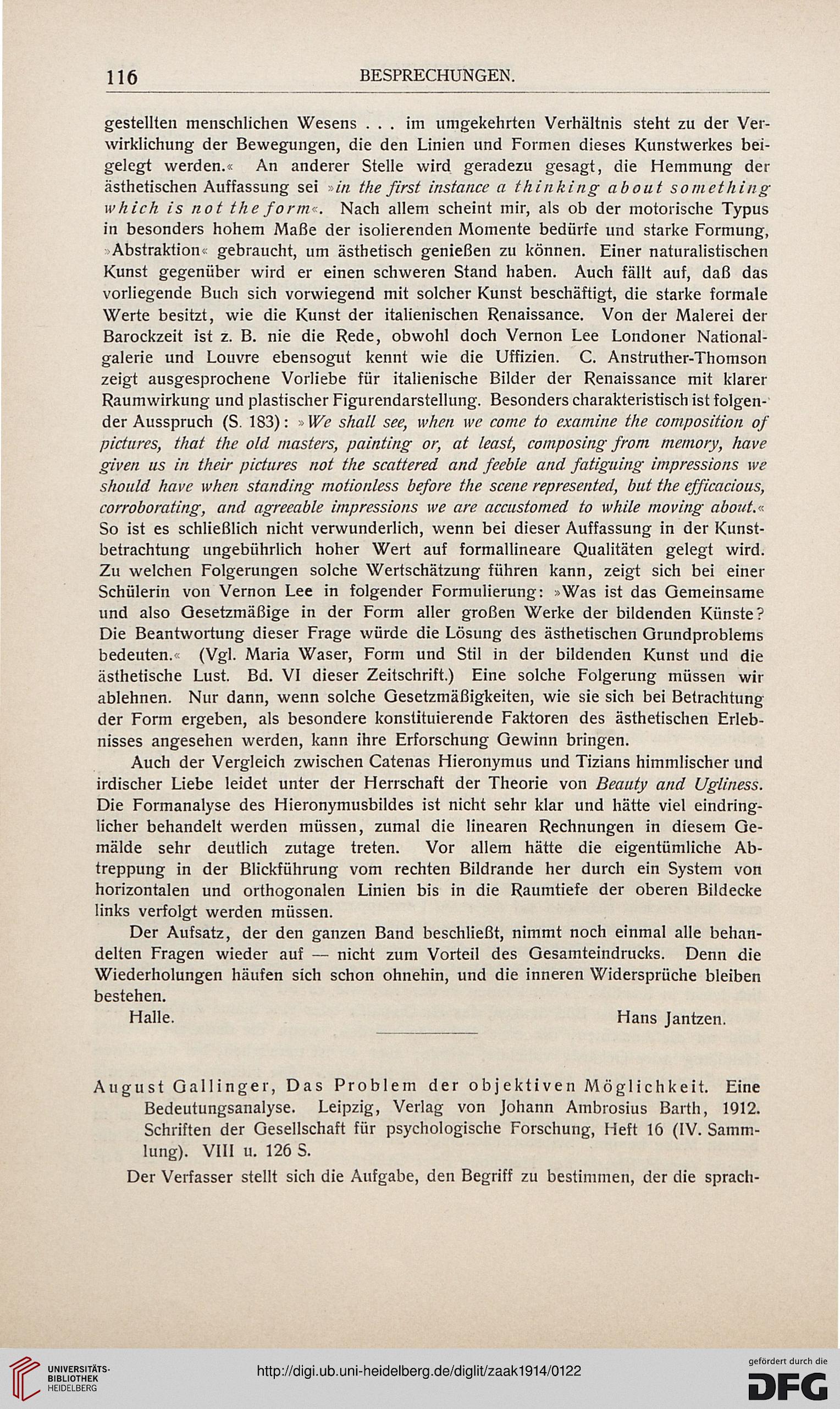116 BESPRECHUNGEN.
gestellten menschlichen Wesens . . . im umgekehrten Verhältnis steht zu der Ver-
wirklichung der Bewegungen, die den Linien und Formen dieses Kunstwerkes bei-
gelegt werden.« An anderer Stelle wird geradezu gesagt, die Hemmung der
ästhetischen Auffassung sei »in the first instance a thinking about something
which is not the forme. Nach allem scheint mir, als ob der motorische Typus
in besonders hohem Maße der isolierenden Momente bedürfe und starke Formung,
>Abstraktionc gebraucht, um ästhetisch genießen zu können. Einer naturalistischen
Kunst gegenüber wird er einen schweren Stand haben. Auch fällt auf, daß das
vorliegende Buch sich vorwiegend mit solcher Kunst beschäftigt, die starke formale
Werte besitzt, wie die Kunst der italienischen Renaissance. Von der Malerei der
Barockzeit ist z. B. nie die Rede, obwohl doch Vernon Lee Londoner National-
galerie und Louvre ebensogut kennt wie die Uffizien. C. Anstruther-Thomson
zeigt ausgesprochene Vorliebe für italienische Bilder der Renaissance mit klarer
Raumwirkung und plastischer Figurendarstellung. Besonders charakteristisch ist folgen-
der Ausspruch (S. 183): >We shall see, when we come to examine the composition of
pietnres, that the old masters, painting or, at least, composing from memoiy, have
given us in their pictures not the scattered and feeble and fatiguing impressions we
should have when standing motionless before the scene represented, bat the efficacious,
corroborating, and agreeable impressions we are aecustomed to white moving about.«
So ist es schließlich nicht verwunderlich, wenn bei dieser Auffassung in der Kunst-
betrachtung ungebührlich hoher Wert auf formallineare Qualitäten gelegt wird.
Zu welchen Folgerungen solche Wertschätzung führen kann, zeigt sich bei einer
Schülerin von Vernon Lee in folgender Formulierung: »Was ist das Gemeinsame
und also Gesetzmäßige in der Form aller großen Werke der bildenden Künste?
Die Beantwortung dieser Frage würde die Lösung des ästhetischen Grundproblems
bedeuten.« (Vgl. Maria Waser, Form und Stil in der bildenden Kunst und die
ästhetische Lust. Bd. VI dieser Zeitschrift.) Eine solche Folgerung müssen wir
ablehnen. Nur dann, wenn solche Gesetzmäßigkeiten, wie sie sich bei Betrachtung
der Form ergeben, als besondere konstituierende Faktoren des ästhetischen Erleb-
nisses angesehen werden, kann ihre Erforschung Gewinn bringen.
Auch der Vergleich zwischen Catenas Ffieronymus und Tizians himmlischer und
irdischer Liebe leidet unter der Herrschaft der Theorie von Beauty and Ugliness.
Die Formanalyse des Hieronymusbildes ist nicht sehr klar und hätte viel eindring-
licher behandelt werden müssen, zumal die linearen Rechnungen in diesem Ge-
mälde sehr deutlich zutage treten. Vor allem hätte die eigentümliche Ab-
treppung in der Blickführung vom rechten Bildrande her durch ein System von
horizontalen und orthogonalen Linien bis in die Raumtiefe der oberen Bildecke
links verfolgt werden müssen.
Der Aufsatz, der den ganzen Band beschließt, nimmt noch einmal alle behan-
delten Fragen wieder auf — nicht zum Vorteil des Gesamteindrucks. Denn die
Wiederholungen häufen sich schon ohnehin, und die inneren Widersprüche bleiben
bestehen.
Halle. Hans Jantzen.
August Gallinger, Das Problem der objektiven Möglichkeit. Eine
Bedeutungsanalyse. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1912.
Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung, Heft 16 (IV. Samm-
lung). VIII u. 126 S.
Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, den Begriff zu bestimmen, der die sprach-
gestellten menschlichen Wesens . . . im umgekehrten Verhältnis steht zu der Ver-
wirklichung der Bewegungen, die den Linien und Formen dieses Kunstwerkes bei-
gelegt werden.« An anderer Stelle wird geradezu gesagt, die Hemmung der
ästhetischen Auffassung sei »in the first instance a thinking about something
which is not the forme. Nach allem scheint mir, als ob der motorische Typus
in besonders hohem Maße der isolierenden Momente bedürfe und starke Formung,
>Abstraktionc gebraucht, um ästhetisch genießen zu können. Einer naturalistischen
Kunst gegenüber wird er einen schweren Stand haben. Auch fällt auf, daß das
vorliegende Buch sich vorwiegend mit solcher Kunst beschäftigt, die starke formale
Werte besitzt, wie die Kunst der italienischen Renaissance. Von der Malerei der
Barockzeit ist z. B. nie die Rede, obwohl doch Vernon Lee Londoner National-
galerie und Louvre ebensogut kennt wie die Uffizien. C. Anstruther-Thomson
zeigt ausgesprochene Vorliebe für italienische Bilder der Renaissance mit klarer
Raumwirkung und plastischer Figurendarstellung. Besonders charakteristisch ist folgen-
der Ausspruch (S. 183): >We shall see, when we come to examine the composition of
pietnres, that the old masters, painting or, at least, composing from memoiy, have
given us in their pictures not the scattered and feeble and fatiguing impressions we
should have when standing motionless before the scene represented, bat the efficacious,
corroborating, and agreeable impressions we are aecustomed to white moving about.«
So ist es schließlich nicht verwunderlich, wenn bei dieser Auffassung in der Kunst-
betrachtung ungebührlich hoher Wert auf formallineare Qualitäten gelegt wird.
Zu welchen Folgerungen solche Wertschätzung führen kann, zeigt sich bei einer
Schülerin von Vernon Lee in folgender Formulierung: »Was ist das Gemeinsame
und also Gesetzmäßige in der Form aller großen Werke der bildenden Künste?
Die Beantwortung dieser Frage würde die Lösung des ästhetischen Grundproblems
bedeuten.« (Vgl. Maria Waser, Form und Stil in der bildenden Kunst und die
ästhetische Lust. Bd. VI dieser Zeitschrift.) Eine solche Folgerung müssen wir
ablehnen. Nur dann, wenn solche Gesetzmäßigkeiten, wie sie sich bei Betrachtung
der Form ergeben, als besondere konstituierende Faktoren des ästhetischen Erleb-
nisses angesehen werden, kann ihre Erforschung Gewinn bringen.
Auch der Vergleich zwischen Catenas Ffieronymus und Tizians himmlischer und
irdischer Liebe leidet unter der Herrschaft der Theorie von Beauty and Ugliness.
Die Formanalyse des Hieronymusbildes ist nicht sehr klar und hätte viel eindring-
licher behandelt werden müssen, zumal die linearen Rechnungen in diesem Ge-
mälde sehr deutlich zutage treten. Vor allem hätte die eigentümliche Ab-
treppung in der Blickführung vom rechten Bildrande her durch ein System von
horizontalen und orthogonalen Linien bis in die Raumtiefe der oberen Bildecke
links verfolgt werden müssen.
Der Aufsatz, der den ganzen Band beschließt, nimmt noch einmal alle behan-
delten Fragen wieder auf — nicht zum Vorteil des Gesamteindrucks. Denn die
Wiederholungen häufen sich schon ohnehin, und die inneren Widersprüche bleiben
bestehen.
Halle. Hans Jantzen.
August Gallinger, Das Problem der objektiven Möglichkeit. Eine
Bedeutungsanalyse. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1912.
Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung, Heft 16 (IV. Samm-
lung). VIII u. 126 S.
Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, den Begriff zu bestimmen, der die sprach-