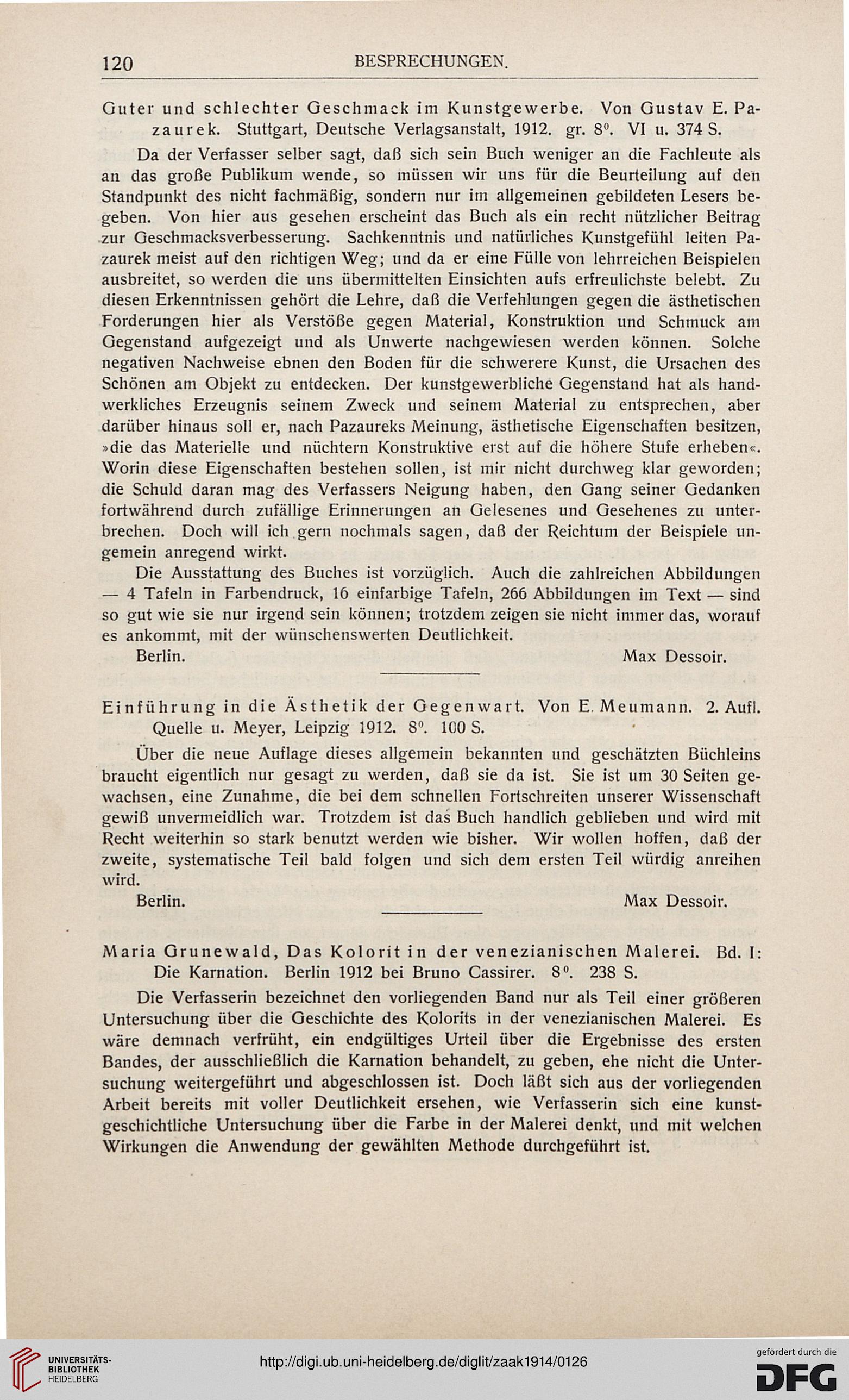120 BESPRECHUNGEN.
Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe. Von Gustav E. Pa-
zaurek. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1912. gr. 8°. VI u. 374 S.
Da der Verfasser selber sagt, daß sich sein Buch weniger an die Fachleute als
an das große Publikum wende, so müssen wir uns für die Beurteilung auf den
Standpunkt des nicht fachmäßig, sondern nur im allgemeinen gebildeten Lesers be-
geben. Von hier aus gesehen erscheint das Buch als ein recht nützlicher Beitrag
zur Geschmacksverbesserung. Sachkenntnis und natürliches Kunstgefühl leiten Pa-
zaurek meist auf den richtigen Weg; und da er eine Fülle von lehrreichen Beispielen
ausbreitet, so werden die uns übermittelten Einsichten aufs erfreulichste belebt. Zu
diesen Erkenntnissen gehört die Lehre, daß die Verfehlungen gegen die ästhetischen
Forderungen hier als Verstöße gegen Material, Konstruktion und Schmuck am
Gegenstand aufgezeigt und als Unwerte nachgewiesen werden können. Solche
negativen Nachweise ebnen den Boden für die schwerere Kunst, die Ursachen des
Schönen am Objekt zu entdecken. Der kunstgewerbliche Gegenstand hat als hand-
werkliches Erzeugnis seinem Zweck und seinem Material zu entsprechen, aber
darüber hinaus soll er, nach Pazaureks Meinung, ästhetische Eigenschaften besitzen,
»die das Materielle und nüchtern Konstruktive erst auf die höhere Stufe erheben«.
Worin diese Eigenschaften bestehen sollen, ist mir nicht durchweg klar geworden;
die Schuld daran mag des Verfassers Neigung haben, den Gang seiner Gedanken
fortwährend durch zufällige Erinnerungen an Gelesenes und Gesehenes zu unter-
brechen. Doch will ich gern nochmals sagen, daß der Reichtum der Beispiele un-
gemein anregend wirkt.
Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich. Auch die zahlreichen Abbildungen
— 4 Tafeln in Farbendruck, 16 einfarbige Tafeln, 266 Abbildungen im Text — sind
so gut wie sie nur irgend sein können; trotzdem zeigen sie nicht immer das, worauf
es ankommt, mit der wünschenswerten Deutlichkeit.
Berlin. Max Dessoir.
Einführung in die Ästhetik der Gegenwart. Von E. Meumann. 2. Aufl.
Quelle u. Meyer, Leipzig 1912. 8". 100 S.
Über die neue Auflage dieses allgemein bekannten und geschätzten Büchleins
braucht eigentlich nur gesagt zu werden, daß sie da ist. Sie ist um 30 Seiten ge-
wachsen, eine Zunahme, die bei dem schnellen Fortschreiten unserer Wissenschaft
gewiß unvermeidlich war. Trotzdem ist das Buch handlich geblieben und wird mit
Recht weiterhin so stark benutzt werden wie bisher. Wir wollen hoffen, daß der
zweite, systematische Teil bald folgen und sich dem ersten Teil würdig anreihen
wird.
Berlin. Max Dessoir.
Maria Grunewald, Das Kolorit in der venezianischen Malerei. Bd. I:
Die Karnation. Berlin 1912 bei Bruno Cassirer. 8°. 238 S.
Die Verfasserin bezeichnet den vorliegenden Band nur als Teil einer größeren
Untersuchung über die Geschichte des Kolorits in der venezianischen Malerei. Es
wäre demnach verfrüht, ein endgültiges Urteil über die Ergebnisse des ersten
Bandes, der ausschließlich die Karnation behandelt, zu geben, ehe nicht die Unter-
suchung weitergeführt und abgeschlossen ist. Doch läßt sich aus der vorliegenden
Arbeit bereits mit voller Deutlichkeit ersehen, wie Verfasserin sich eine kunst-
geschichtliche Untersuchung über die Farbe in der Malerei denkt, und mit welchen
Wirkungen die Anwendung der gewählten Methode durchgeführt ist.
Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe. Von Gustav E. Pa-
zaurek. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1912. gr. 8°. VI u. 374 S.
Da der Verfasser selber sagt, daß sich sein Buch weniger an die Fachleute als
an das große Publikum wende, so müssen wir uns für die Beurteilung auf den
Standpunkt des nicht fachmäßig, sondern nur im allgemeinen gebildeten Lesers be-
geben. Von hier aus gesehen erscheint das Buch als ein recht nützlicher Beitrag
zur Geschmacksverbesserung. Sachkenntnis und natürliches Kunstgefühl leiten Pa-
zaurek meist auf den richtigen Weg; und da er eine Fülle von lehrreichen Beispielen
ausbreitet, so werden die uns übermittelten Einsichten aufs erfreulichste belebt. Zu
diesen Erkenntnissen gehört die Lehre, daß die Verfehlungen gegen die ästhetischen
Forderungen hier als Verstöße gegen Material, Konstruktion und Schmuck am
Gegenstand aufgezeigt und als Unwerte nachgewiesen werden können. Solche
negativen Nachweise ebnen den Boden für die schwerere Kunst, die Ursachen des
Schönen am Objekt zu entdecken. Der kunstgewerbliche Gegenstand hat als hand-
werkliches Erzeugnis seinem Zweck und seinem Material zu entsprechen, aber
darüber hinaus soll er, nach Pazaureks Meinung, ästhetische Eigenschaften besitzen,
»die das Materielle und nüchtern Konstruktive erst auf die höhere Stufe erheben«.
Worin diese Eigenschaften bestehen sollen, ist mir nicht durchweg klar geworden;
die Schuld daran mag des Verfassers Neigung haben, den Gang seiner Gedanken
fortwährend durch zufällige Erinnerungen an Gelesenes und Gesehenes zu unter-
brechen. Doch will ich gern nochmals sagen, daß der Reichtum der Beispiele un-
gemein anregend wirkt.
Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich. Auch die zahlreichen Abbildungen
— 4 Tafeln in Farbendruck, 16 einfarbige Tafeln, 266 Abbildungen im Text — sind
so gut wie sie nur irgend sein können; trotzdem zeigen sie nicht immer das, worauf
es ankommt, mit der wünschenswerten Deutlichkeit.
Berlin. Max Dessoir.
Einführung in die Ästhetik der Gegenwart. Von E. Meumann. 2. Aufl.
Quelle u. Meyer, Leipzig 1912. 8". 100 S.
Über die neue Auflage dieses allgemein bekannten und geschätzten Büchleins
braucht eigentlich nur gesagt zu werden, daß sie da ist. Sie ist um 30 Seiten ge-
wachsen, eine Zunahme, die bei dem schnellen Fortschreiten unserer Wissenschaft
gewiß unvermeidlich war. Trotzdem ist das Buch handlich geblieben und wird mit
Recht weiterhin so stark benutzt werden wie bisher. Wir wollen hoffen, daß der
zweite, systematische Teil bald folgen und sich dem ersten Teil würdig anreihen
wird.
Berlin. Max Dessoir.
Maria Grunewald, Das Kolorit in der venezianischen Malerei. Bd. I:
Die Karnation. Berlin 1912 bei Bruno Cassirer. 8°. 238 S.
Die Verfasserin bezeichnet den vorliegenden Band nur als Teil einer größeren
Untersuchung über die Geschichte des Kolorits in der venezianischen Malerei. Es
wäre demnach verfrüht, ein endgültiges Urteil über die Ergebnisse des ersten
Bandes, der ausschließlich die Karnation behandelt, zu geben, ehe nicht die Unter-
suchung weitergeführt und abgeschlossen ist. Doch läßt sich aus der vorliegenden
Arbeit bereits mit voller Deutlichkeit ersehen, wie Verfasserin sich eine kunst-
geschichtliche Untersuchung über die Farbe in der Malerei denkt, und mit welchen
Wirkungen die Anwendung der gewählten Methode durchgeführt ist.