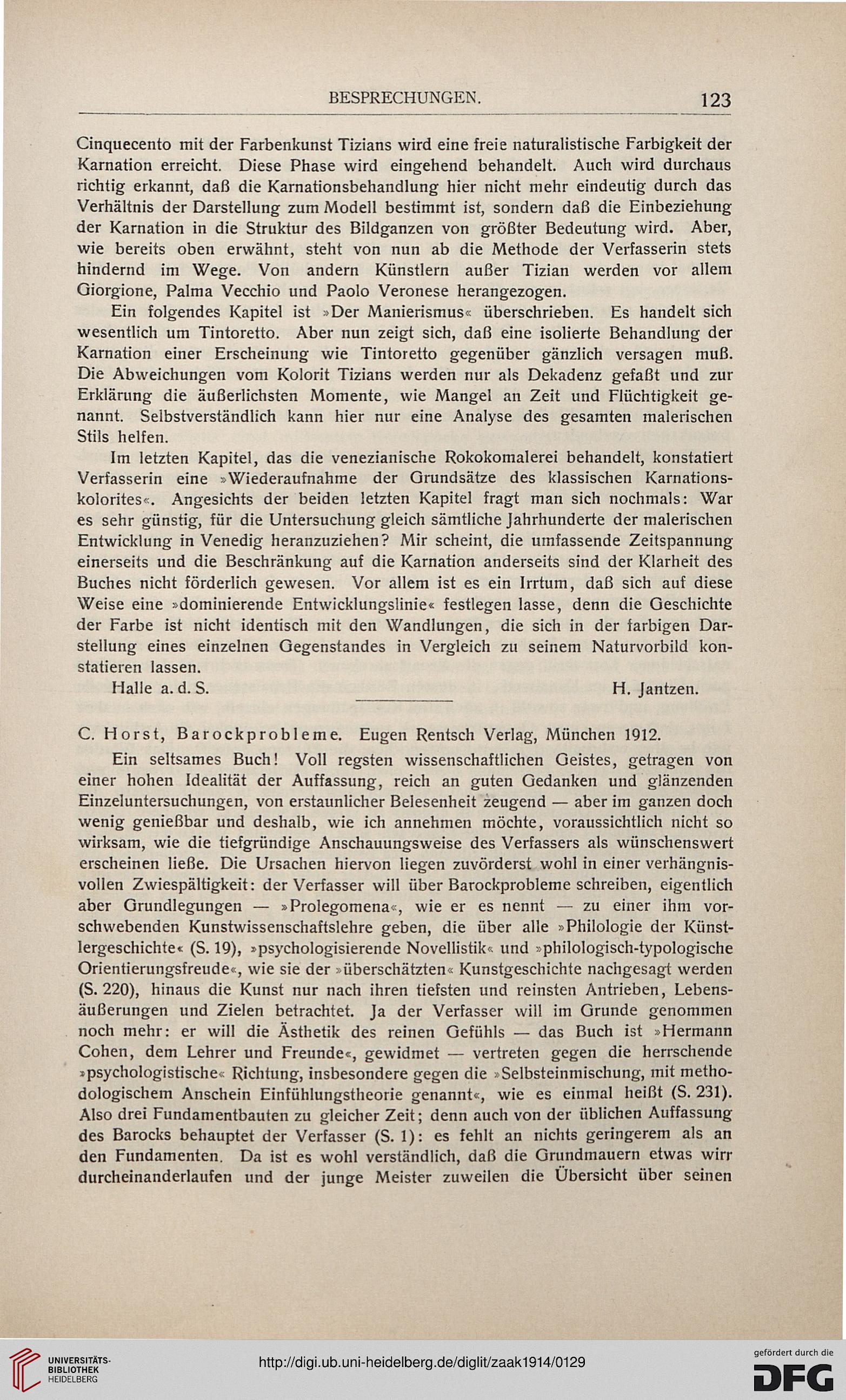BESPRECHUNGEN. 123
Cinquecento mit der Farbenkunst Tizians wird eine freie naturalistische Farbigkeit der
Karnation erreicht. Diese Phase wird eingehend behandelt. Auch wird durchaus
richtig erkannt, daß die Karnationsbehandlung hier nicht mehr eindeutig durch das
Verhältnis der Darstellung zum Modell bestimmt ist, sondern daß die Einbeziehung
der Karnation in die Struktur des Bildganzen von größter Bedeutung wird. Aber,
wie bereits oben erwähnt, steht von nun ab die Methode der Verfasserin stets
hindernd im Wege. Von andern Künstlern außer Tizian werden vor allem
Giorgione, Palma Vecchio und Paolo Veronese herangezogen.
Ein folgendes Kapitel ist »Der Manierismus« überschrieben. Es handelt sich
wesentlich um Tintoretto. Aber nun zeigt sich, daß eine isolierte Behandlung der
Karnation einer Erscheinung wie Tintoretto gegenüber gänzlich versagen muß.
Die Abweichungen vom Kolorit Tizians werden nur als Dekadenz gefaßt und zur
Erklärung die äußerlichsten Momente, wie Mangel an Zeit und Flüchtigkeit ge-
nannt. Selbstverständlich kann hier nur eine Analyse des gesamten malerischen
Stils helfen.
Im letzten Kapitel, das die venezianische Rokokomalerei behandelt, konstatiert
Verfasserin eine »Wiederaufnahme der Grundsätze des klassischen Karnations-
kolorites«. Angesichts der beiden letzten Kapitel fragt man sich nochmals: War
es sehr günstig, für die Untersuchung gleich sämtliche Jahrhunderte der malerischen
Entwicklung in Venedig heranzuziehen? Mir scheint, die umfassende Zeitspannung
einerseits und die Beschränkung auf die Karnation anderseits sind der Klarheit des
Buches nicht förderlich gewesen. Vor allem ist es ein Irrtum, daß sich auf diese
Weise eine »dominierende Entwicklungslinie« festlegen lasse, denn die Geschichte
der Farbe ist nicht identisch mit den Wandlungen, die sich in der farbigen Dar-
stellung eines einzelnen Gegenstandes in Vergleich zu seinem Naturvorbild kon-
statieren lassen.
Halle a. d. S. H. Jantzen.
C. Horst, Barockprobleme. Eugen Rentsch Verlag, München 1912.
Ein seltsames Buch! Voll regsten wissenschaftlichen Geistes, getragen von
einer hohen Idealität der Auffassung, reich an guten Gedanken und glänzenden
Einzeluntersuchungen, von erstaunlicher Belesenheit zeugend — aber im ganzen doch
wenig genießbar und deshalb, wie ich annehmen möchte, voraussichtlich nicht so
wirksam, wie die tiefgründige Anschauungsweise des Verfassers als wünschenswert
erscheinen ließe. Die Ursachen hiervon liegen zuvörderst wohl in einer verhängnis-
vollen Zwiespältigkeit: der Verfasser will über Barockprobleme schreiben, eigentlich
aber Grundlegungen — »Prolegomena«, wie er es nennt — zu einer ihm vor-
schwebenden Kunstwissenschaftslehre geben, die über alle »Philologie der Künst-
lergeschichte« (S. 19), »psychologisierende Novellistik« und »philologisch-typologische
Orientierungsfreude«, wie sie der »überschätzten« Kunstgeschichte nachgesagt werden
(S. 220), hinaus die Kunst nur nach ihren tiefsten und reinsten Antrieben, Lebens-
äußerungen und Zielen betrachtet. Ja der Verfasser will im Grunde genommen
noch mehr: er will die Ästhetik des reinen Gefühls — das Buch ist »Hermann
Cohen, dem Lehrer und Freunde«, gewidmet — vertreten gegen die herrschende
jpsychologistische« Richtung, insbesondere gegen die »Selbsteinmischung, mit metho-
dologischem Anschein Einfühlungstheorie genannt«, wie es einmal heißt (S. 231).
Also drei Fundamentbauten zu gleicher Zeit; denn auch von der üblichen Auffassung
des Barocks behauptet der Verfasser (S. 1): es fehlt an nichts geringerem als an
den Fundamenten. Da ist es wohl verständlich, daß die Grundmauern etwas wirr
durcheinanderlaufen und der junge Meister zuweilen die Übersicht über seinen
Cinquecento mit der Farbenkunst Tizians wird eine freie naturalistische Farbigkeit der
Karnation erreicht. Diese Phase wird eingehend behandelt. Auch wird durchaus
richtig erkannt, daß die Karnationsbehandlung hier nicht mehr eindeutig durch das
Verhältnis der Darstellung zum Modell bestimmt ist, sondern daß die Einbeziehung
der Karnation in die Struktur des Bildganzen von größter Bedeutung wird. Aber,
wie bereits oben erwähnt, steht von nun ab die Methode der Verfasserin stets
hindernd im Wege. Von andern Künstlern außer Tizian werden vor allem
Giorgione, Palma Vecchio und Paolo Veronese herangezogen.
Ein folgendes Kapitel ist »Der Manierismus« überschrieben. Es handelt sich
wesentlich um Tintoretto. Aber nun zeigt sich, daß eine isolierte Behandlung der
Karnation einer Erscheinung wie Tintoretto gegenüber gänzlich versagen muß.
Die Abweichungen vom Kolorit Tizians werden nur als Dekadenz gefaßt und zur
Erklärung die äußerlichsten Momente, wie Mangel an Zeit und Flüchtigkeit ge-
nannt. Selbstverständlich kann hier nur eine Analyse des gesamten malerischen
Stils helfen.
Im letzten Kapitel, das die venezianische Rokokomalerei behandelt, konstatiert
Verfasserin eine »Wiederaufnahme der Grundsätze des klassischen Karnations-
kolorites«. Angesichts der beiden letzten Kapitel fragt man sich nochmals: War
es sehr günstig, für die Untersuchung gleich sämtliche Jahrhunderte der malerischen
Entwicklung in Venedig heranzuziehen? Mir scheint, die umfassende Zeitspannung
einerseits und die Beschränkung auf die Karnation anderseits sind der Klarheit des
Buches nicht förderlich gewesen. Vor allem ist es ein Irrtum, daß sich auf diese
Weise eine »dominierende Entwicklungslinie« festlegen lasse, denn die Geschichte
der Farbe ist nicht identisch mit den Wandlungen, die sich in der farbigen Dar-
stellung eines einzelnen Gegenstandes in Vergleich zu seinem Naturvorbild kon-
statieren lassen.
Halle a. d. S. H. Jantzen.
C. Horst, Barockprobleme. Eugen Rentsch Verlag, München 1912.
Ein seltsames Buch! Voll regsten wissenschaftlichen Geistes, getragen von
einer hohen Idealität der Auffassung, reich an guten Gedanken und glänzenden
Einzeluntersuchungen, von erstaunlicher Belesenheit zeugend — aber im ganzen doch
wenig genießbar und deshalb, wie ich annehmen möchte, voraussichtlich nicht so
wirksam, wie die tiefgründige Anschauungsweise des Verfassers als wünschenswert
erscheinen ließe. Die Ursachen hiervon liegen zuvörderst wohl in einer verhängnis-
vollen Zwiespältigkeit: der Verfasser will über Barockprobleme schreiben, eigentlich
aber Grundlegungen — »Prolegomena«, wie er es nennt — zu einer ihm vor-
schwebenden Kunstwissenschaftslehre geben, die über alle »Philologie der Künst-
lergeschichte« (S. 19), »psychologisierende Novellistik« und »philologisch-typologische
Orientierungsfreude«, wie sie der »überschätzten« Kunstgeschichte nachgesagt werden
(S. 220), hinaus die Kunst nur nach ihren tiefsten und reinsten Antrieben, Lebens-
äußerungen und Zielen betrachtet. Ja der Verfasser will im Grunde genommen
noch mehr: er will die Ästhetik des reinen Gefühls — das Buch ist »Hermann
Cohen, dem Lehrer und Freunde«, gewidmet — vertreten gegen die herrschende
jpsychologistische« Richtung, insbesondere gegen die »Selbsteinmischung, mit metho-
dologischem Anschein Einfühlungstheorie genannt«, wie es einmal heißt (S. 231).
Also drei Fundamentbauten zu gleicher Zeit; denn auch von der üblichen Auffassung
des Barocks behauptet der Verfasser (S. 1): es fehlt an nichts geringerem als an
den Fundamenten. Da ist es wohl verständlich, daß die Grundmauern etwas wirr
durcheinanderlaufen und der junge Meister zuweilen die Übersicht über seinen