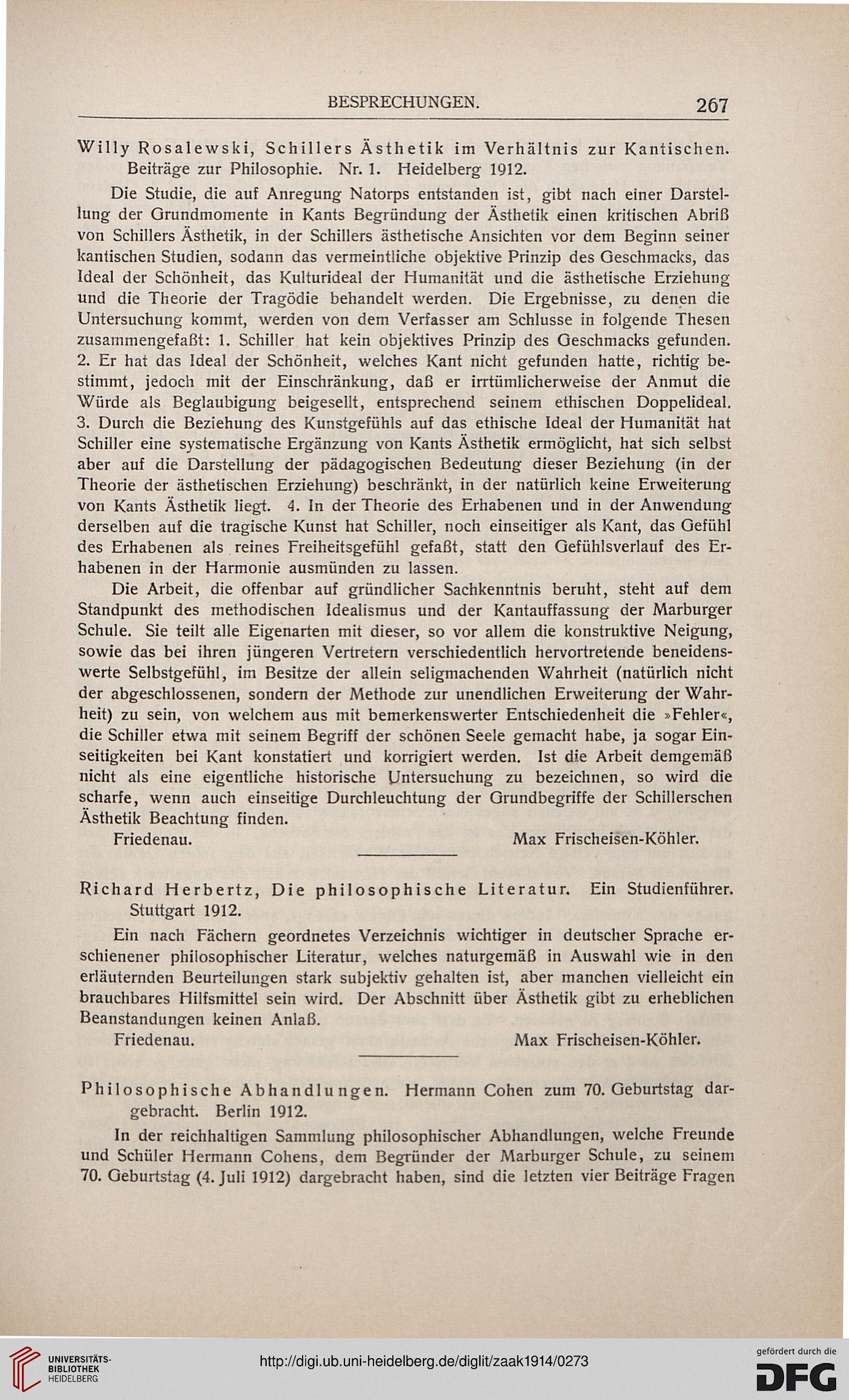BESPRECHUNGEN. 267
Willy Rosalewski, Schillers Ästhetik im Verhältnis zur Kantischen.
Beiträge zur Philosophie. Nr. 1. Heidelberg 1912.
Die Studie, die auf Anregung Natorps entstanden ist, gibt nach einer Darstel-
lung der Grundmomente in Kants Begründung der Ästhetik einen kritischen Abriß
von Schillers Ästhetik, in der Schillers ästhetische Ansichten vor dem Beginn seiner
kantischen Studien, sodann das vermeintliche objektive Prinzip des Geschmacks, das
Ideal der Schönheit, das Kulturideal der Humanität und die ästhetische Erziehung
und die Theorie der Tragödie behandelt werden. Die Ergebnisse, zu denen die
Untersuchung kommt, werden von dem Verfasser am Schlüsse in folgende Thesen
zusammengefaßt: 1. Schiller hat kein objektives Prinzip des Geschmacks gefunden.
2. Er hat das Ideal der Schönheit, welches Kant nicht gefunden hatte, richtig be-
stimmt, jedoch mit der Einschränkung, daß er irrtümlicherweise der Anmut die
Würde als Beglaubigung beigesellt, entsprechend seinem ethischen Doppelideal.
3. Durch die Beziehung des Kunstgefühls auf das ethische Ideal der Humanität hat
Schiller eine systematische Ergänzung von Kants Ästhetik ermöglicht, hat sich selbst
aber auf die Darstellung der pädagogischen Bedeutung dieser Beziehung (in der
Theorie der ästhetischen Erziehung) beschränkt, in der natürlich keine Erweiterung
von Kants Ästhetik liegt. 4. In der Theorie des Erhabenen und in der Anwendung
derselben auf die tragische Kunst hat Schiller, noch einseitiger als Kant, das Gefühl
des Erhabenen als reines Freiheitsgefühl gefaßt, statt den Gefühlsverlauf des Er-
habenen in der Harmonie ausmünden zu lassen.
Die Arbeit, die offenbar auf gründlicher Sachkenntnis beruht, steht auf dem
Standpunkt des methodischen Idealismus und der Kantauffassung der Marburger
Schule. Sie teilt alle Eigenarten mit dieser, so vor allem die konstruktive Neigung,
sowie das bei ihren jüngeren Vertretern verschiedentlich hervortretende beneidens-
werte Selbstgefühl, im Besitze der allein seligmachenden Wahrheit (natürlich nicht
der abgeschlossenen, sondern der Methode zur unendlichen Erweiterung der Wahr-
heit) zu sein, von welchem aus mit bemerkenswerter Entschiedenheit die »Fehler«,
die Schiller etwa mit seinem Begriff der schönen Seele gemacht habe, ja sogar Ein-
seitigkeiten bei Kant konstatiert und korrigiert werden. Ist die Arbeit demgemäß
nicht als eine eigentliche historische Untersuchung zu bezeichnen, so wird die
scharfe, wenn auch einseitige Durchleuchtung der Grundbegriffe der Schillerschen
Ästhetik Beachtung finden.
Friedenau. Max Frischeisen-Köhler.
Richard Herbertz, Die philosophische Literatur. Ein Studrenführer.
Stuttgart 1912.
Ein nach Fächern geordnetes Verzeichnis wichtiger in deutscher Sprache er-
schienener philosophischer Literatur, welches naturgemäß in Auswahl wie in den
erläuternden Beurteilungen stark subjektiv gehalten ist, aber manchen vielleicht ein
brauchbares Hilfsmittel sein wird. Der Abschnitt über Ästhetik gibt zu erheblichen
Beanstandungen keinen Anlaß.
Friedenau. Max Frischeisen-Köhler.
Philosophische Abhandlungen. Hermann Cohen zum 70. Geburtstag dar-
gebracht. Berlin 1912.
In der reichhaltigen Sammlung philosophischer Abhandlungen, welche Freunde
und Schüler Hermann Cohens, dem Begründer der Marburger Schule, zu seinem
70. Geburtstag (4. Juli 1912) dargebracht haben, sind die letzten vier Beiträge Fragen
Willy Rosalewski, Schillers Ästhetik im Verhältnis zur Kantischen.
Beiträge zur Philosophie. Nr. 1. Heidelberg 1912.
Die Studie, die auf Anregung Natorps entstanden ist, gibt nach einer Darstel-
lung der Grundmomente in Kants Begründung der Ästhetik einen kritischen Abriß
von Schillers Ästhetik, in der Schillers ästhetische Ansichten vor dem Beginn seiner
kantischen Studien, sodann das vermeintliche objektive Prinzip des Geschmacks, das
Ideal der Schönheit, das Kulturideal der Humanität und die ästhetische Erziehung
und die Theorie der Tragödie behandelt werden. Die Ergebnisse, zu denen die
Untersuchung kommt, werden von dem Verfasser am Schlüsse in folgende Thesen
zusammengefaßt: 1. Schiller hat kein objektives Prinzip des Geschmacks gefunden.
2. Er hat das Ideal der Schönheit, welches Kant nicht gefunden hatte, richtig be-
stimmt, jedoch mit der Einschränkung, daß er irrtümlicherweise der Anmut die
Würde als Beglaubigung beigesellt, entsprechend seinem ethischen Doppelideal.
3. Durch die Beziehung des Kunstgefühls auf das ethische Ideal der Humanität hat
Schiller eine systematische Ergänzung von Kants Ästhetik ermöglicht, hat sich selbst
aber auf die Darstellung der pädagogischen Bedeutung dieser Beziehung (in der
Theorie der ästhetischen Erziehung) beschränkt, in der natürlich keine Erweiterung
von Kants Ästhetik liegt. 4. In der Theorie des Erhabenen und in der Anwendung
derselben auf die tragische Kunst hat Schiller, noch einseitiger als Kant, das Gefühl
des Erhabenen als reines Freiheitsgefühl gefaßt, statt den Gefühlsverlauf des Er-
habenen in der Harmonie ausmünden zu lassen.
Die Arbeit, die offenbar auf gründlicher Sachkenntnis beruht, steht auf dem
Standpunkt des methodischen Idealismus und der Kantauffassung der Marburger
Schule. Sie teilt alle Eigenarten mit dieser, so vor allem die konstruktive Neigung,
sowie das bei ihren jüngeren Vertretern verschiedentlich hervortretende beneidens-
werte Selbstgefühl, im Besitze der allein seligmachenden Wahrheit (natürlich nicht
der abgeschlossenen, sondern der Methode zur unendlichen Erweiterung der Wahr-
heit) zu sein, von welchem aus mit bemerkenswerter Entschiedenheit die »Fehler«,
die Schiller etwa mit seinem Begriff der schönen Seele gemacht habe, ja sogar Ein-
seitigkeiten bei Kant konstatiert und korrigiert werden. Ist die Arbeit demgemäß
nicht als eine eigentliche historische Untersuchung zu bezeichnen, so wird die
scharfe, wenn auch einseitige Durchleuchtung der Grundbegriffe der Schillerschen
Ästhetik Beachtung finden.
Friedenau. Max Frischeisen-Köhler.
Richard Herbertz, Die philosophische Literatur. Ein Studrenführer.
Stuttgart 1912.
Ein nach Fächern geordnetes Verzeichnis wichtiger in deutscher Sprache er-
schienener philosophischer Literatur, welches naturgemäß in Auswahl wie in den
erläuternden Beurteilungen stark subjektiv gehalten ist, aber manchen vielleicht ein
brauchbares Hilfsmittel sein wird. Der Abschnitt über Ästhetik gibt zu erheblichen
Beanstandungen keinen Anlaß.
Friedenau. Max Frischeisen-Köhler.
Philosophische Abhandlungen. Hermann Cohen zum 70. Geburtstag dar-
gebracht. Berlin 1912.
In der reichhaltigen Sammlung philosophischer Abhandlungen, welche Freunde
und Schüler Hermann Cohens, dem Begründer der Marburger Schule, zu seinem
70. Geburtstag (4. Juli 1912) dargebracht haben, sind die letzten vier Beiträge Fragen