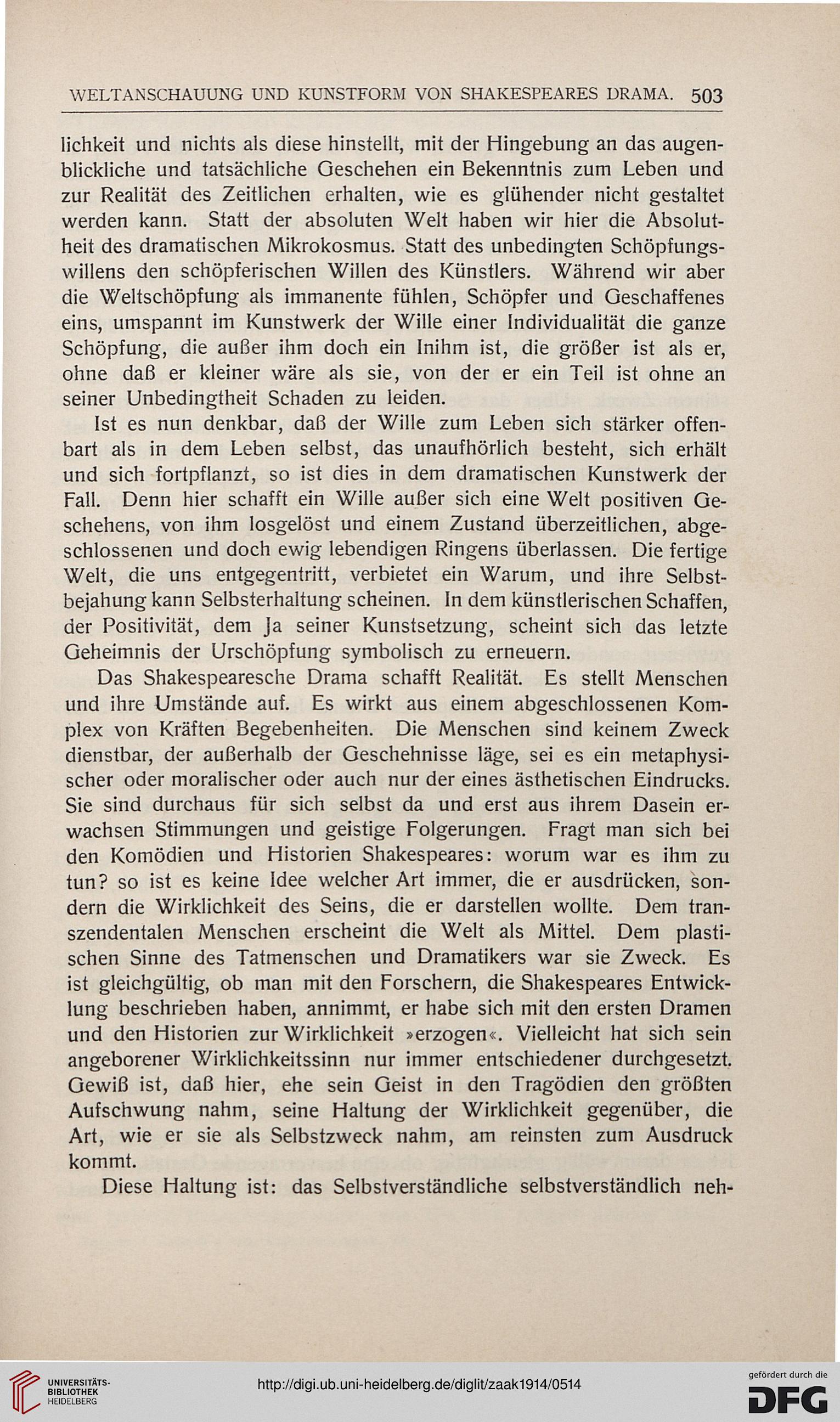WELTANSCHAUUNG UND KUNSTFORM VON SHAKESPEARES DRAMA. 503
lichkeit und nichts als diese hinstellt, mit der Hingebung an das augen-
blickliche und tatsächliche Geschehen ein Bekenntnis zum Leben und
zur Realität des Zeitlichen erhalten, wie es glühender nicht gestaltet
werden kann. Statt der absoluten Welt haben wir hier die Absolut-
heit des dramatischen Mikrokosmus. Statt des unbedingten Schöpfungs-
willens den schöpferischen Willen des Künstlers. Während wir aber
die Weltschöpfung als immanente fühlen, Schöpfer und Geschaffenes
eins, umspannt im Kunstwerk der Wille einer Individualität die ganze
Schöpfung, die außer ihm doch ein Inihm ist, die größer ist als er,
ohne daß er kleiner wäre als sie, von der er ein Teil ist ohne an
seiner Unbedingtheit Schaden zu leiden.
Ist es nun denkbar, daß der Wille zum Leben sich stärker offen-
bart als in dem Leben selbst, das unaufhörlich besteht, sich erhält
und sich fortpflanzt, so ist dies in dem dramatischen Kunstwerk der
Fall. Denn hier schafft ein Wille außer sich eine Welt positiven Ge-
schehens, von ihm losgelöst und einem Zustand überzeitlichen, abge-
schlossenen und doch ewig lebendigen Ringens überlassen. Die fertige
Welt, die uns entgegentritt, verbietet ein Warum, und ihre Selbst-
bejahung kann Selbsterhaltung scheinen. In dem künstlerischen Schaffen,
der Positivität, dem Ja seiner Kunstsetzung, scheint sich das letzte
Geheimnis der Urschöpfung symbolisch zu erneuern.
Das Shakespearesche Drama schafft Realität. Es stellt Menschen
und ihre Umstände auf. Es wirkt aus einem abgeschlossenen Kom-
plex von Kräften Begebenheiten. Die Menschen sind keinem Zweck
dienstbar, der außerhalb der Geschehnisse läge, sei es ein metaphysi-
scher oder moralischer oder auch nur der eines ästhetischen Eindrucks.
Sie sind durchaus für sich selbst da und erst aus ihrem Dasein er-
wachsen Stimmungen und geistige Folgerungen. Fragt man sich bei
den Komödien und Historien Shakespeares: worum war es ihm zu
tun? so ist es keine Idee welcher Art immer, die er ausdrücken, son-
dern die Wirklichkeit des Seins, die er darstellen wollte. Dem tran-
szendentalen Menschen erscheint die Welt als Mittel. Dem plasti-
schen Sinne des Tatmenschen und Dramatikers war sie Zweck. Es
ist gleichgültig, ob man mit den Forschern, die Shakespeares Entwick-
lung beschrieben haben, annimmt, er habe sich mit den ersten Dramen
und den Historien zur Wirklichkeit »erzogen«. Vielleicht hat sich sein
angeborener Wirklichkeitssinn nur immer entschiedener durchgesetzt.
Gewiß ist, daß hier, ehe sein Geist in den Tragödien den größten
Aufschwung nahm, seine Haltung der Wirklichkeit gegenüber, die
Art, wie er sie als Selbstzweck nahm, am reinsten zum Ausdruck
kommt.
Diese Haltung ist: das Selbstverständliche selbstverständlich neh-
lichkeit und nichts als diese hinstellt, mit der Hingebung an das augen-
blickliche und tatsächliche Geschehen ein Bekenntnis zum Leben und
zur Realität des Zeitlichen erhalten, wie es glühender nicht gestaltet
werden kann. Statt der absoluten Welt haben wir hier die Absolut-
heit des dramatischen Mikrokosmus. Statt des unbedingten Schöpfungs-
willens den schöpferischen Willen des Künstlers. Während wir aber
die Weltschöpfung als immanente fühlen, Schöpfer und Geschaffenes
eins, umspannt im Kunstwerk der Wille einer Individualität die ganze
Schöpfung, die außer ihm doch ein Inihm ist, die größer ist als er,
ohne daß er kleiner wäre als sie, von der er ein Teil ist ohne an
seiner Unbedingtheit Schaden zu leiden.
Ist es nun denkbar, daß der Wille zum Leben sich stärker offen-
bart als in dem Leben selbst, das unaufhörlich besteht, sich erhält
und sich fortpflanzt, so ist dies in dem dramatischen Kunstwerk der
Fall. Denn hier schafft ein Wille außer sich eine Welt positiven Ge-
schehens, von ihm losgelöst und einem Zustand überzeitlichen, abge-
schlossenen und doch ewig lebendigen Ringens überlassen. Die fertige
Welt, die uns entgegentritt, verbietet ein Warum, und ihre Selbst-
bejahung kann Selbsterhaltung scheinen. In dem künstlerischen Schaffen,
der Positivität, dem Ja seiner Kunstsetzung, scheint sich das letzte
Geheimnis der Urschöpfung symbolisch zu erneuern.
Das Shakespearesche Drama schafft Realität. Es stellt Menschen
und ihre Umstände auf. Es wirkt aus einem abgeschlossenen Kom-
plex von Kräften Begebenheiten. Die Menschen sind keinem Zweck
dienstbar, der außerhalb der Geschehnisse läge, sei es ein metaphysi-
scher oder moralischer oder auch nur der eines ästhetischen Eindrucks.
Sie sind durchaus für sich selbst da und erst aus ihrem Dasein er-
wachsen Stimmungen und geistige Folgerungen. Fragt man sich bei
den Komödien und Historien Shakespeares: worum war es ihm zu
tun? so ist es keine Idee welcher Art immer, die er ausdrücken, son-
dern die Wirklichkeit des Seins, die er darstellen wollte. Dem tran-
szendentalen Menschen erscheint die Welt als Mittel. Dem plasti-
schen Sinne des Tatmenschen und Dramatikers war sie Zweck. Es
ist gleichgültig, ob man mit den Forschern, die Shakespeares Entwick-
lung beschrieben haben, annimmt, er habe sich mit den ersten Dramen
und den Historien zur Wirklichkeit »erzogen«. Vielleicht hat sich sein
angeborener Wirklichkeitssinn nur immer entschiedener durchgesetzt.
Gewiß ist, daß hier, ehe sein Geist in den Tragödien den größten
Aufschwung nahm, seine Haltung der Wirklichkeit gegenüber, die
Art, wie er sie als Selbstzweck nahm, am reinsten zum Ausdruck
kommt.
Diese Haltung ist: das Selbstverständliche selbstverständlich neh-