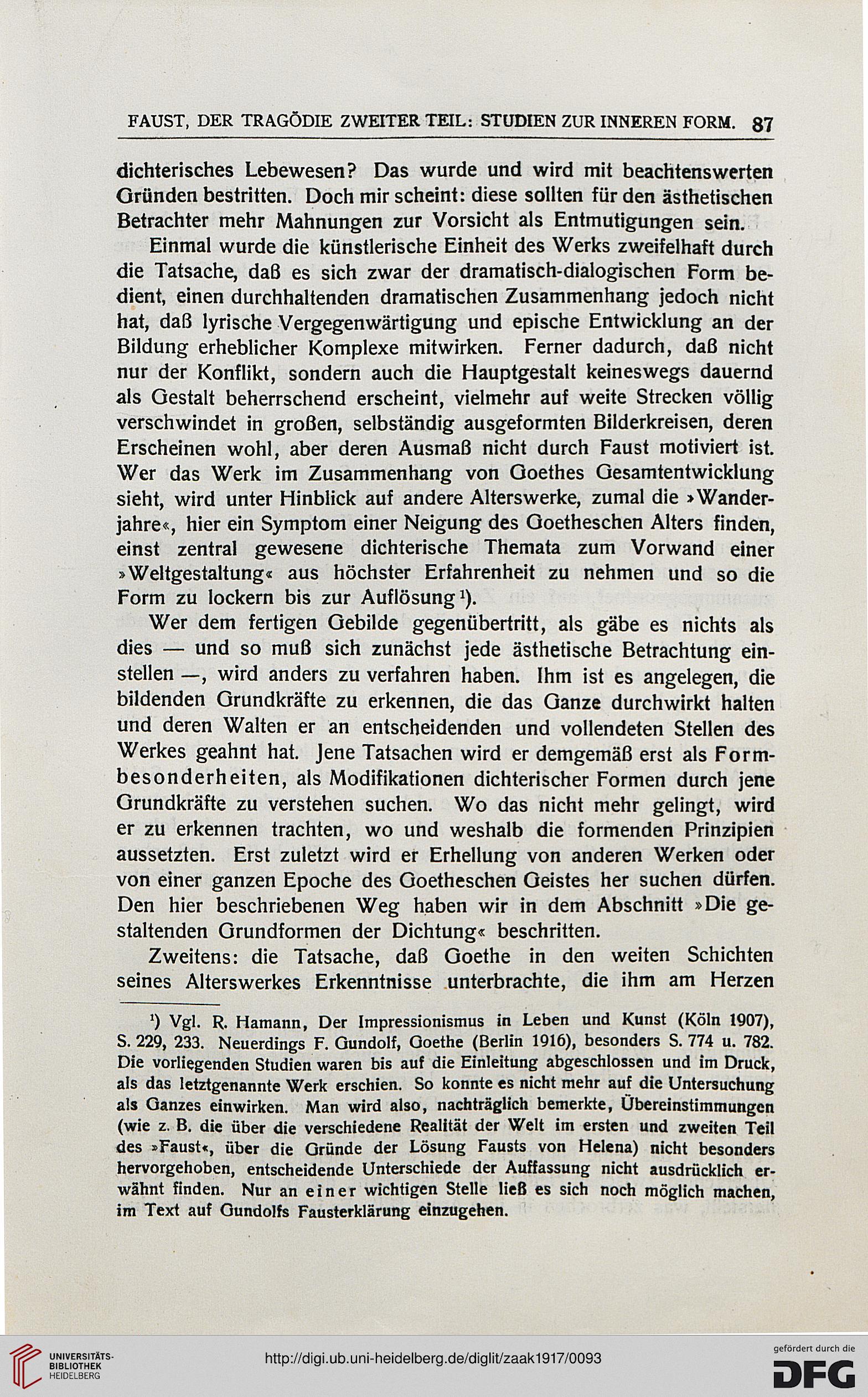FAUST, DER TRAGÖDIE ZWEITER TEIL: STUDIEN ZUR INNEREN FORM. 87
dichterisches Lebewesen? Das wurde und wird mit beachtenswerten
Gründen bestritten. Doch mir scheint: diese sollten für den ästhetischen
Betrachter mehr Mahnungen zur Vorsicht als Entmutigungen sein.
Einmal wurde die künstlerische Einheit des Werks zweifelhaft durch
die Tatsache, daß es sich zwar der dramatisch-dialogischen Form be-
dient, einen durchhaltenden dramatischen Zusammenhang jedoch nicht
hat, daß lyrische Vergegenwärtigung und epische Entwicklung an der
Bildung erheblicher Komplexe mitwirken. Ferner dadurch, daß nicht
nur der Konflikt, sondern auch die Hauptgestalt keineswegs dauernd
als Gestalt beherrschend erscheint, vielmehr auf weite Strecken völlig
verschwindet in großen, selbständig ausgeformten Bilderkreisen, deren
Erscheinen wohl, aber deren Ausmaß nicht durch Faust motiviert ist.
Wer das Werk im Zusammenhang von Goethes Gesamtentwicklung
sieht, wird unter Hinblick auf andere Alterswerke, zumal die »Wander-
jahre«, hier ein Symptom einer Neigung des Goetheschen Alters finden,
einst zentral gewesene dichterische Themata zum Vorwand einer
»Weltgestaltung« aus höchster Erfahrenheit zu nehmen und so die
Form zu Iockern bis zur Auflösung1).
Wer dem fertigen Gebilde gegen übertritt, als gäbe es nichts als
dies — und so muß sich zunächst jede ästhetische Betrachtung ein-
stellen —, wird anders zu verfahren haben. Ihm ist es angelegen, die
bildenden Grundkräfte zu erkennen, die das Ganze durchwirkt halten
und deren Walten er an entscheidenden und vollendeten Stellen des
Werkes geahnt hat. Jene Tatsachen wird er demgemäß erst als Form-
besonderheiten, als Modifikationen dichterischer Formen durch jene
Grundkräfte zu verstehen suchen. Wo das nicht mehr gelingt, wird
er zu erkennen trachten, wo und weshalb die formenden Prinzipien
aussetzten. Erst zuletzt wird er Erhellung von anderen Werken oder
von einer ganzen Epoche des Goetheschen Geistes her suchen dürfen.
Den hier beschriebenen Weg haben wir in dem Abschnitt »Die ge-
staltenden Grundformen der Dichtung« beschritten.
Zweitens: die Tatsache, daß Goethe in den weiten Schichten
seines Alterswerkes Erkenntnisse unterbrachte, die ihm am Herzen
') Vgl. R. Hamann, Der Impressionismus in Leben und Kunst (Köln 1907),
S. 229, 233. Neuerdings F. Gundolf, Goethe (Berlin 1916), besonders S. 774 u. 782.
Die vorliegenden Studien waren bis auf die Einleitung abgeschlossen und im Druck,
als das letztgenannte Werk erschien. So konnte es nicht mehr auf die Untersuchung
als Ganzes einwirken. Man wird also, nachträglich bemerkte, Übereinstimmungen
(wie z. B. die über die verschiedene Realität der Welt im ersten und zweiten Teil
des »Faust«, über die Gründe der Lösung Fausts von Helena) nicht besonders
hervorgehoben, entscheidende Unterschiede der Auffassung nicht ausdrücklich er-
wähnt finden. Nur an einer wichtigen Stelle ließ es sich noch möglich machen,
im Text auf Gundolfs Fausterklärung einzugehen.
dichterisches Lebewesen? Das wurde und wird mit beachtenswerten
Gründen bestritten. Doch mir scheint: diese sollten für den ästhetischen
Betrachter mehr Mahnungen zur Vorsicht als Entmutigungen sein.
Einmal wurde die künstlerische Einheit des Werks zweifelhaft durch
die Tatsache, daß es sich zwar der dramatisch-dialogischen Form be-
dient, einen durchhaltenden dramatischen Zusammenhang jedoch nicht
hat, daß lyrische Vergegenwärtigung und epische Entwicklung an der
Bildung erheblicher Komplexe mitwirken. Ferner dadurch, daß nicht
nur der Konflikt, sondern auch die Hauptgestalt keineswegs dauernd
als Gestalt beherrschend erscheint, vielmehr auf weite Strecken völlig
verschwindet in großen, selbständig ausgeformten Bilderkreisen, deren
Erscheinen wohl, aber deren Ausmaß nicht durch Faust motiviert ist.
Wer das Werk im Zusammenhang von Goethes Gesamtentwicklung
sieht, wird unter Hinblick auf andere Alterswerke, zumal die »Wander-
jahre«, hier ein Symptom einer Neigung des Goetheschen Alters finden,
einst zentral gewesene dichterische Themata zum Vorwand einer
»Weltgestaltung« aus höchster Erfahrenheit zu nehmen und so die
Form zu Iockern bis zur Auflösung1).
Wer dem fertigen Gebilde gegen übertritt, als gäbe es nichts als
dies — und so muß sich zunächst jede ästhetische Betrachtung ein-
stellen —, wird anders zu verfahren haben. Ihm ist es angelegen, die
bildenden Grundkräfte zu erkennen, die das Ganze durchwirkt halten
und deren Walten er an entscheidenden und vollendeten Stellen des
Werkes geahnt hat. Jene Tatsachen wird er demgemäß erst als Form-
besonderheiten, als Modifikationen dichterischer Formen durch jene
Grundkräfte zu verstehen suchen. Wo das nicht mehr gelingt, wird
er zu erkennen trachten, wo und weshalb die formenden Prinzipien
aussetzten. Erst zuletzt wird er Erhellung von anderen Werken oder
von einer ganzen Epoche des Goetheschen Geistes her suchen dürfen.
Den hier beschriebenen Weg haben wir in dem Abschnitt »Die ge-
staltenden Grundformen der Dichtung« beschritten.
Zweitens: die Tatsache, daß Goethe in den weiten Schichten
seines Alterswerkes Erkenntnisse unterbrachte, die ihm am Herzen
') Vgl. R. Hamann, Der Impressionismus in Leben und Kunst (Köln 1907),
S. 229, 233. Neuerdings F. Gundolf, Goethe (Berlin 1916), besonders S. 774 u. 782.
Die vorliegenden Studien waren bis auf die Einleitung abgeschlossen und im Druck,
als das letztgenannte Werk erschien. So konnte es nicht mehr auf die Untersuchung
als Ganzes einwirken. Man wird also, nachträglich bemerkte, Übereinstimmungen
(wie z. B. die über die verschiedene Realität der Welt im ersten und zweiten Teil
des »Faust«, über die Gründe der Lösung Fausts von Helena) nicht besonders
hervorgehoben, entscheidende Unterschiede der Auffassung nicht ausdrücklich er-
wähnt finden. Nur an einer wichtigen Stelle ließ es sich noch möglich machen,
im Text auf Gundolfs Fausterklärung einzugehen.