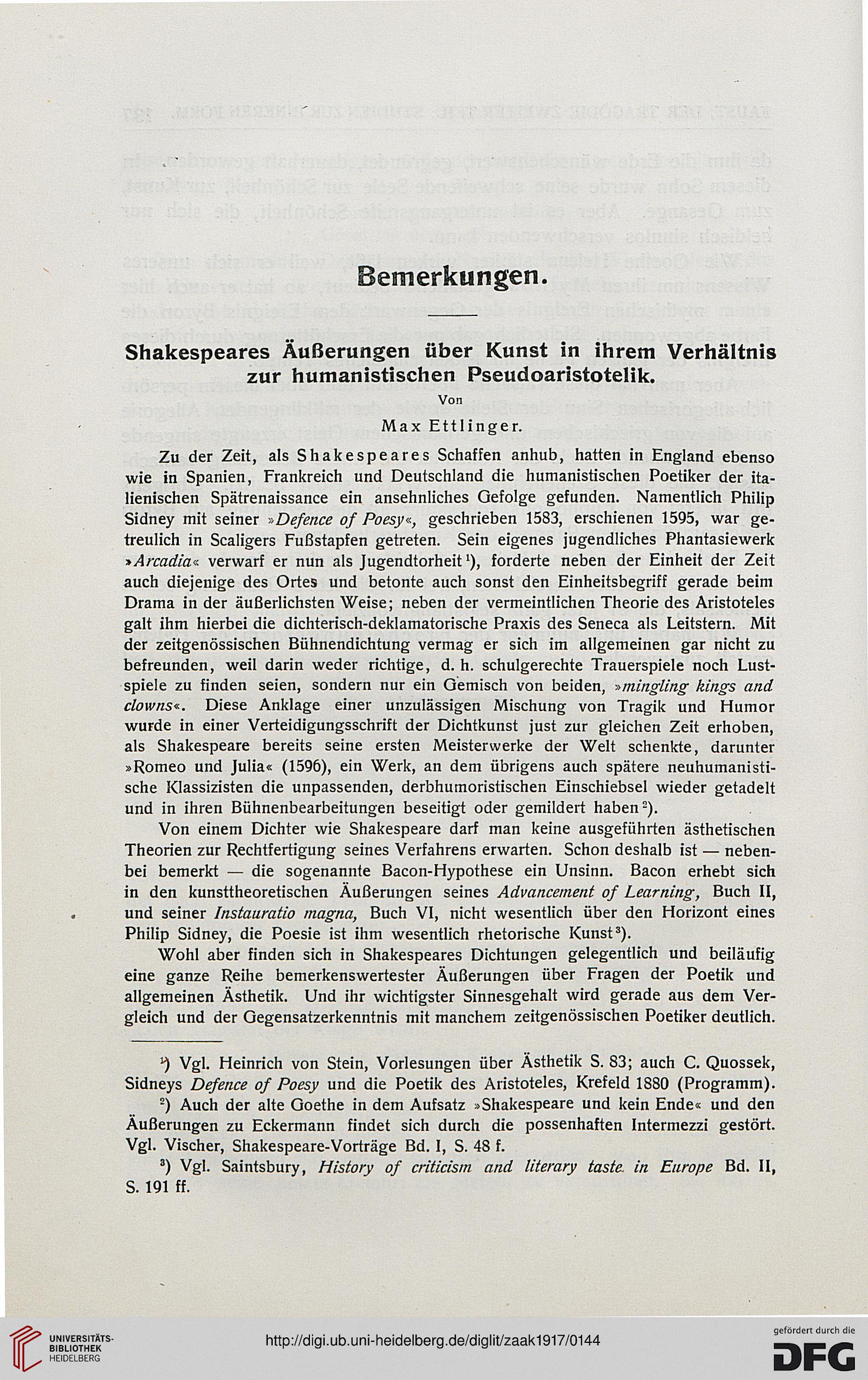Bemerkungen.
Shakespeares Äußerungen über Kunst in ihrem Verhältnis
zur humanistischen Pseudoaristotelik.
Von
Max Ettlinger.
Zu der Zeit, als Shakespeares Schaffen anhub, hatten in England ebenso
wie in Spanien, Frankreich und Deutschland die humanistischen Poetiker der ita-
lienischen Spätrenaissance ein ansehnliches Gefolge gefunden. Namentlich Philip
Sidney mit seiner -Defaice of Poesy«, geschrieben 1583, erschienen 1595, war ge-
treulich in Scaligers Fußstapfen getreten. Sein eigenes jugendliches Phantasiewerk
»Arcadia« verwarf er nun als Jugendtorheit1), forderte neben der Einheit der Zeit
auch diejenige des Ortes und betonte auch sonst den Einheitsbegriff gerade beim
Drama in der äußerlichsten Weise; neben der vermeintlichen Theorie des Aristoteles
galt ihm hierbei die dichterisch-deklamatorische Praxis des Seneca als Leitstern. Mit
der zeitgenössischen Bühnendichtung vermag er sich im allgemeinen gar nicht zu
befreunden, weil darin weder richtige, d. h. schulgerechte Trauerspiele noch Lust-
spiele zu finden seien, sondern nur ein Gemisch von beiden, »mingling kings and
clowns«. Diese Anklage einer unzulässigen Mischung von Tragik und Humor
wurde in einer Verteidigungsschrift der Dichtkunst just zur gleichen Zeit erhoben,
als Shakespeare bereits seine ersten Meisterwerke der Welt schenkte, darunter
»Romeo und Julia« (1596), ein Werk, an dem übrigens auch spätere neuhumanisti-
sche Klassizisten die unpassenden, derbhumoristischen Einschiebsel wieder getadelt
und in ihren Bühnenbearbeitungen beseitigt oder gemildert haben2).
Von einem Dichter wie Shakespeare darf man keine ausgeführten ästhetischen
Theorien zur Rechtfertigung seines Verfahrens erwarten. Schon deshalb ist — neben-
bei bemerkt — die sogenannte Bacon-Hypothese ein Unsinn. Bacon erhebt sich
in den kunsttheoretischen Äußerungen seines Advancement of Learning, Buch II,
und seiner Instauratio magna, Buch VI, nicht wesentlich über den Horizont eines
Philip Sidney, die Poesie ist ihm wesentlich rhetorische Kunst3).
Wohl aber finden sich in Shakespeares Dichtungen gelegentlich und beiläufig
eine ganze Reihe bemerkenswertester Äußerungen über Fragen der Poetik und
allgemeinen Ästhetik. Und ihr wichtigster Sinnesgehalt wird gerade aus dem Ver-
gleich und der Gegensatzerkenntnis mit manchem zeitgenössischen Poetiker deutlich.
■) Vgl. Heinrich von Stein, Vorlesungen über Ästhetik S. 83; auch C. Quossek,
Sidneys Defence of Poesy und die Poetik des Aristoteles, Krefeld 1880 (Programm).
-) Auch der alte Goethe in dem Aufsatz »Shakespeare und kein Ende« und den
Äußerungen zu Eckermann findet sich durch die possenhaften Intermezzi gestört.
Vgl. Vischer, Shakespeare-Vorträge Bd. I, S. 48 f.
3) Vgl. Saintsbury, History of criticism and literary taste, in Europe Bd. II,
S. 191 ff.
Shakespeares Äußerungen über Kunst in ihrem Verhältnis
zur humanistischen Pseudoaristotelik.
Von
Max Ettlinger.
Zu der Zeit, als Shakespeares Schaffen anhub, hatten in England ebenso
wie in Spanien, Frankreich und Deutschland die humanistischen Poetiker der ita-
lienischen Spätrenaissance ein ansehnliches Gefolge gefunden. Namentlich Philip
Sidney mit seiner -Defaice of Poesy«, geschrieben 1583, erschienen 1595, war ge-
treulich in Scaligers Fußstapfen getreten. Sein eigenes jugendliches Phantasiewerk
»Arcadia« verwarf er nun als Jugendtorheit1), forderte neben der Einheit der Zeit
auch diejenige des Ortes und betonte auch sonst den Einheitsbegriff gerade beim
Drama in der äußerlichsten Weise; neben der vermeintlichen Theorie des Aristoteles
galt ihm hierbei die dichterisch-deklamatorische Praxis des Seneca als Leitstern. Mit
der zeitgenössischen Bühnendichtung vermag er sich im allgemeinen gar nicht zu
befreunden, weil darin weder richtige, d. h. schulgerechte Trauerspiele noch Lust-
spiele zu finden seien, sondern nur ein Gemisch von beiden, »mingling kings and
clowns«. Diese Anklage einer unzulässigen Mischung von Tragik und Humor
wurde in einer Verteidigungsschrift der Dichtkunst just zur gleichen Zeit erhoben,
als Shakespeare bereits seine ersten Meisterwerke der Welt schenkte, darunter
»Romeo und Julia« (1596), ein Werk, an dem übrigens auch spätere neuhumanisti-
sche Klassizisten die unpassenden, derbhumoristischen Einschiebsel wieder getadelt
und in ihren Bühnenbearbeitungen beseitigt oder gemildert haben2).
Von einem Dichter wie Shakespeare darf man keine ausgeführten ästhetischen
Theorien zur Rechtfertigung seines Verfahrens erwarten. Schon deshalb ist — neben-
bei bemerkt — die sogenannte Bacon-Hypothese ein Unsinn. Bacon erhebt sich
in den kunsttheoretischen Äußerungen seines Advancement of Learning, Buch II,
und seiner Instauratio magna, Buch VI, nicht wesentlich über den Horizont eines
Philip Sidney, die Poesie ist ihm wesentlich rhetorische Kunst3).
Wohl aber finden sich in Shakespeares Dichtungen gelegentlich und beiläufig
eine ganze Reihe bemerkenswertester Äußerungen über Fragen der Poetik und
allgemeinen Ästhetik. Und ihr wichtigster Sinnesgehalt wird gerade aus dem Ver-
gleich und der Gegensatzerkenntnis mit manchem zeitgenössischen Poetiker deutlich.
■) Vgl. Heinrich von Stein, Vorlesungen über Ästhetik S. 83; auch C. Quossek,
Sidneys Defence of Poesy und die Poetik des Aristoteles, Krefeld 1880 (Programm).
-) Auch der alte Goethe in dem Aufsatz »Shakespeare und kein Ende« und den
Äußerungen zu Eckermann findet sich durch die possenhaften Intermezzi gestört.
Vgl. Vischer, Shakespeare-Vorträge Bd. I, S. 48 f.
3) Vgl. Saintsbury, History of criticism and literary taste, in Europe Bd. II,
S. 191 ff.