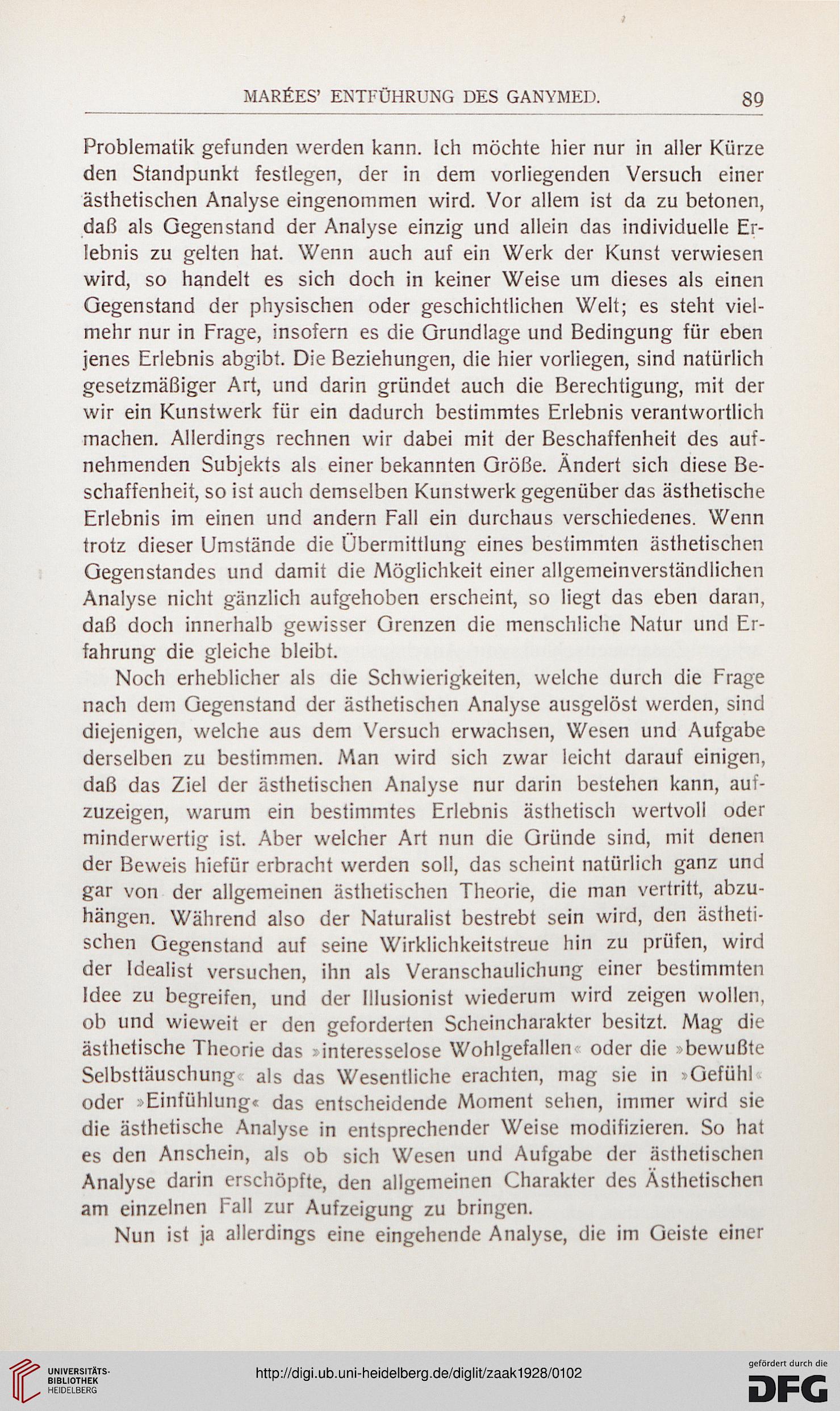MAREES' ENTFÜHRUNG DES GANYMED. 89
Problematik gefunden werden kann. Ich möchte hier nur in aller Kürze
den Standpunkt festlegen, der in dem vorliegenden Versuch einer
ästhetischen Analyse eingenommen wird. Vor allem ist da zu betonen,
daß als Gegenstand der Analyse einzig und allein das individuelle Er-
lebnis zu gelten hat. Wenn auch auf ein Werk der Kunst verwiesen
wird, so handelt es sich doch in keiner Weise um dieses als einen
Gegenstand der physischen oder geschichtlichen Welt; es steht viel-
mehr nur in Frage, insofern es die Grundlage und Bedingung für eben
jenes Erlebnis abgibt. Die Beziehungen, die hier vorliegen, sind natürlich
gesetzmäßiger Art, und darin gründet auch die Berechtigung, mit der
wir ein Kunstwerk für ein dadurch bestimmtes Erlebnis verantwortlich
machen. Allerdings rechnen wir dabei mit der Beschaffenheit des auf-
nehmenden Subjekts als einer bekannten Größe. Ändert sich diese Be-
schaffenheit, so ist auch demselben Kunstwerk gegenüber das ästhetische
Erlebnis im einen und andern Fall ein durchaus verschiedenes. Wenn
trotz dieser Umstände die Übermittlung eines bestimmten ästhetischen
Gegenstandes und damit die Möglichkeit einer allgemeinverständlichen
Analyse nicht gänzlich aufgehoben erscheint, so liegt das eben daran,
daß doch innerhalb gewisser Grenzen die menschliche Natur und Er-
fahrung die gleiche bleibt.
Noch erheblicher als die Schwierigkeiten, welche durch die Frage
nach dem Gegenstand der ästhetischen Analyse ausgelöst werden, sind
diejenigen, welche aus dem Versuch erwachsen, Wesen und Aufgabe
derselben zu bestimmen. Man wird sich zwar leicht darauf einigen,
daß das Ziel der ästhetischen Analyse nur darin bestehen kann, auf-
zuzeigen, warum ein bestimmtes Erlebnis ästhetisch wertvoll oder
minderwertig ist. Aber welcher Art nun die Gründe sind, mit denen
der Beweis hiefür erbracht werden soll, das scheint natürlich ganz und
gar von der allgemeinen ästhetischen Theorie, die man vertritt, abzu-
hängen. Während also der Naturalist bestrebt sein wird, den ästheti-
schen Gegenstand auf seine Wirklichkeitstreue hin zu prüfen, wird
der Idealist versuchen, ihn als Veranschaulichung einer bestimmten
Idee zu begreifen, und der Illusionist wiederum wird zeigen wollen,
ob und wieweit er den geforderten Scheincharakter besitzt. Mag die
ästhetische Theorie das interesselose Wohlgefallen oder die >bewußte
Selbsttäuschung als das Wesentliche erachten, mag sie in Gefühl
oder »Einfühlung« das entscheidende Moment sehen, immer wird sie
die ästhetische Analyse in entsprechender Weise modifizieren. So hat
es den Anschein, als ob sich Wesen und Aufgabe der ästhetischen
Analyse darin erschöpfte, den allgemeinen Charakter des Ästhetischen
am einzelnen Fall zur Aufzeigung zu bringen.
Nun ist ja allerdings eine eingehende Analyse, die im Geiste einer
Problematik gefunden werden kann. Ich möchte hier nur in aller Kürze
den Standpunkt festlegen, der in dem vorliegenden Versuch einer
ästhetischen Analyse eingenommen wird. Vor allem ist da zu betonen,
daß als Gegenstand der Analyse einzig und allein das individuelle Er-
lebnis zu gelten hat. Wenn auch auf ein Werk der Kunst verwiesen
wird, so handelt es sich doch in keiner Weise um dieses als einen
Gegenstand der physischen oder geschichtlichen Welt; es steht viel-
mehr nur in Frage, insofern es die Grundlage und Bedingung für eben
jenes Erlebnis abgibt. Die Beziehungen, die hier vorliegen, sind natürlich
gesetzmäßiger Art, und darin gründet auch die Berechtigung, mit der
wir ein Kunstwerk für ein dadurch bestimmtes Erlebnis verantwortlich
machen. Allerdings rechnen wir dabei mit der Beschaffenheit des auf-
nehmenden Subjekts als einer bekannten Größe. Ändert sich diese Be-
schaffenheit, so ist auch demselben Kunstwerk gegenüber das ästhetische
Erlebnis im einen und andern Fall ein durchaus verschiedenes. Wenn
trotz dieser Umstände die Übermittlung eines bestimmten ästhetischen
Gegenstandes und damit die Möglichkeit einer allgemeinverständlichen
Analyse nicht gänzlich aufgehoben erscheint, so liegt das eben daran,
daß doch innerhalb gewisser Grenzen die menschliche Natur und Er-
fahrung die gleiche bleibt.
Noch erheblicher als die Schwierigkeiten, welche durch die Frage
nach dem Gegenstand der ästhetischen Analyse ausgelöst werden, sind
diejenigen, welche aus dem Versuch erwachsen, Wesen und Aufgabe
derselben zu bestimmen. Man wird sich zwar leicht darauf einigen,
daß das Ziel der ästhetischen Analyse nur darin bestehen kann, auf-
zuzeigen, warum ein bestimmtes Erlebnis ästhetisch wertvoll oder
minderwertig ist. Aber welcher Art nun die Gründe sind, mit denen
der Beweis hiefür erbracht werden soll, das scheint natürlich ganz und
gar von der allgemeinen ästhetischen Theorie, die man vertritt, abzu-
hängen. Während also der Naturalist bestrebt sein wird, den ästheti-
schen Gegenstand auf seine Wirklichkeitstreue hin zu prüfen, wird
der Idealist versuchen, ihn als Veranschaulichung einer bestimmten
Idee zu begreifen, und der Illusionist wiederum wird zeigen wollen,
ob und wieweit er den geforderten Scheincharakter besitzt. Mag die
ästhetische Theorie das interesselose Wohlgefallen oder die >bewußte
Selbsttäuschung als das Wesentliche erachten, mag sie in Gefühl
oder »Einfühlung« das entscheidende Moment sehen, immer wird sie
die ästhetische Analyse in entsprechender Weise modifizieren. So hat
es den Anschein, als ob sich Wesen und Aufgabe der ästhetischen
Analyse darin erschöpfte, den allgemeinen Charakter des Ästhetischen
am einzelnen Fall zur Aufzeigung zu bringen.
Nun ist ja allerdings eine eingehende Analyse, die im Geiste einer