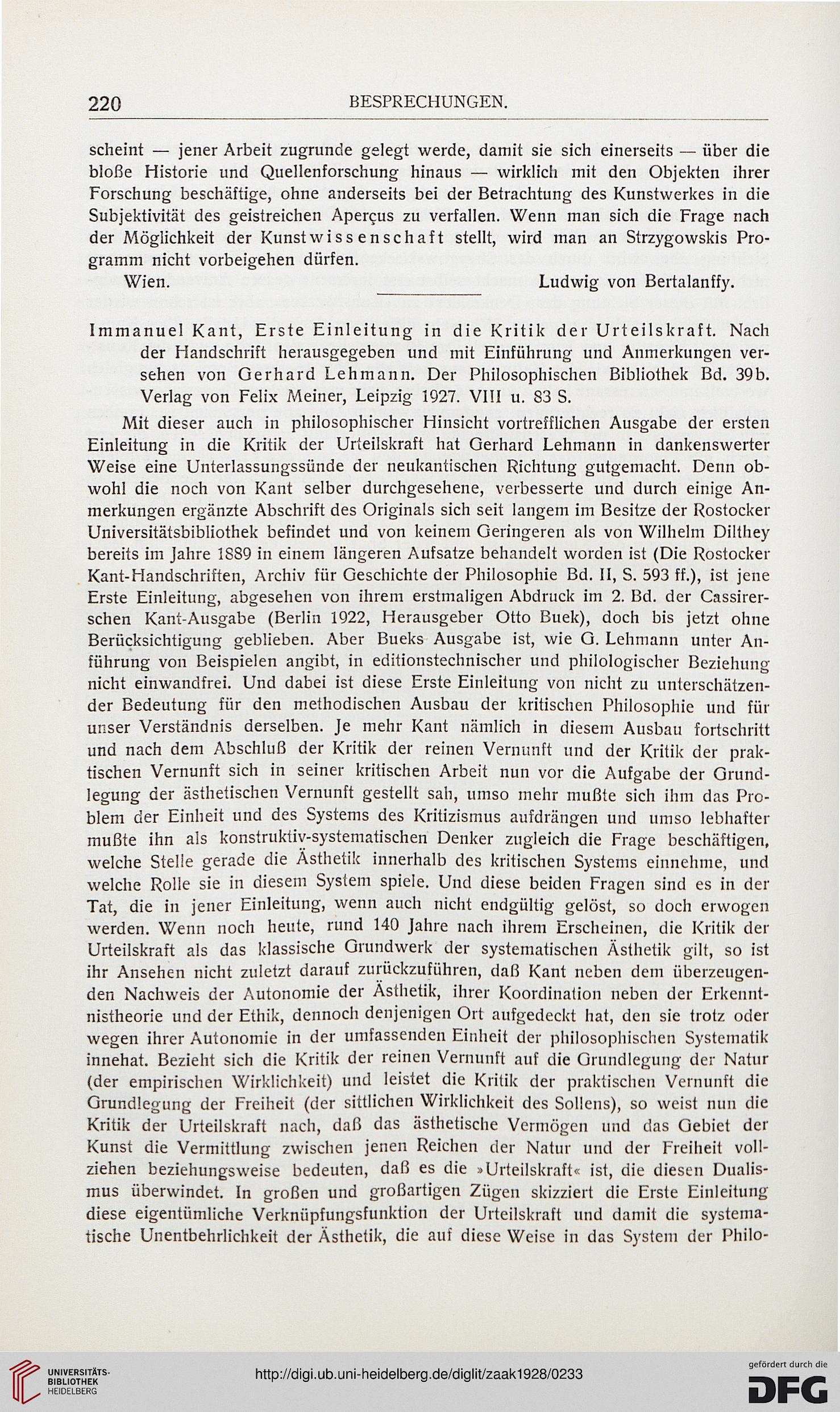220
BESPRECHUNGEN.
scheint — jener Arbeit zugrunde gelegt werde, damit sie sich einerseits — über die
bloße Historie und Quellenforschung hinaus — wirklich mit den Objekten ihrer
Forschung beschäftige, ohne anderseits bei der Betrachtung des Kunstwerkes in die
Subjektivität des geistreichen Apercus zu verfallen. Wenn man sich die Frage nach
der Möglichkeit der Kunstwissenschaft stellt, wird man an Strzygowskis Pro-
gramm nicht vorbeigehen dürfen.
Wien. Ludwig von Bertalanffy.
Immanuel Kant, Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Nach
der Handschrift herausgegeben und mit Einführung und Anmerkungen ver-
sehen von Gerhard Lehmann. Der Philosophischen Bibliothek Bd. 39b.
Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1927. VIH u. 83 S.
Mit dieser auch in philosophischer Hinsicht vortrefflichen Ausgabe der ersten
Einleitung in die Kritik der Urteilskraft hat Gerhard Lehmann in dankenswerter
Weise eine Unterlassungssünde der neukantischen Richtung gutgemacht. Denn ob-
wohl die noch von Kant selber durchgesehene, verbesserte und durch einige An-
merkungen ergänzte Abschrift des Originals sich seit langem im Besitze der Rostocker
Universitätsbibliothek befindet und von keinem Geringeren als von Wilhelm Dillhey
bereits im Jahre 1889 in einem längeren Aufsatze behandelt worden ist (Die Rostocker
Kant-Handschriften, Archiv für Geschichte der Philosophie Bd. II, S. 593 ff.), ist jene
Erste Einleitung, abgesehen von ihrem erstmaligen Abdruck im 2. Bd. der Cassirer-
schen Kant-Ausgabe (Berlin 1922, Herausgeber Otto Buek), doch bis jetzt ohne
Berücksichtigung geblieben. Aber Bueks Ausgabe ist, wie G. Lehmann unter An-
führung von Beispielen angibt, in editionstechnischer und philologischer Beziehung
nicht einwandfrei. Und dabei ist diese Erste Einleitung von nicht zu unterschätzen-
der Bedeutung für den methodischen Ausbau der kritischen Philosophie und für
unser Verständnis derselben. Je mehr Kant nämlich in diesem Ausbau fortschritt
und nach dem Abschluß der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der prak-
tischen Vernunft sich in seiner kritischen Arbeit nun vor die Aufgabe der Grund-
legung der ästhetischen Vernunft gestellt sah, umso mehr mußte sich ihm das Pro-
blem der Einheit und des Systems des Kritizismus aufdrängen und umso lebhafter
mußte ihn als konstruktiv-systematischen Denker zugleich die Frage beschäftigen,
welche Stelle gerade die Ästhetik innerhalb des kritischen Systems einnehme, und
welche Rolle sie in diesem System spiele. Und diese beiden Fragen sind es in der
Tat, die in jener Einleitung, wenn auch nicht endgültig gelöst, so doch erwogen
werden. Wenn noch heute, rund 140 Jahre nach ihrem Erscheinen, die Kritik der
Urteilskraft als das klassische Grundwerk der systematischen Ästhetik gilt, so ist
ihr Ansehen nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß Kant neben dem überzeugen-
den Nachweis der Autonomie der Ästhetik, ihrer Koordination neben der Erkennt-
nistheorie und der Ethik, dennoch denjenigen Ort aufgedeckt hat, den sie trotz oder
wegen ihrer Autonomie in der umfassenden Einheit der philosophischen Systematik
innehat. Bezieht sich die Kritik der reinen Vernunft auf die Grundlegung der Natur
(der empirischen Wirklichkeit) und leistet die Kritik der praktischen Vernunft die
Grundlegung der Freiheit (der sittlichen Wirklichkeit des Sollens), so weist nun die
Kritik der Urteilskraft nach, daß das ästhetische Vermögen und das Gebiet der
Kunst die Vermittlung zwischen jenen Reichen der Natur und der Freiheit voll-
ziehen beziehungsweise bedeuten, daß es die »Urteilskraft« ist, die diesen Dualis-
mus überwindet. In großen und großartigen Zügen skizziert die Erste Einleitung
diese eigentümliche Verknüpfungsfunktion der Urteilskraft und damit die systema-
tische Unentbehrlichkeit der Ästhetik, die auf diese Weise in das System der Philo-
BESPRECHUNGEN.
scheint — jener Arbeit zugrunde gelegt werde, damit sie sich einerseits — über die
bloße Historie und Quellenforschung hinaus — wirklich mit den Objekten ihrer
Forschung beschäftige, ohne anderseits bei der Betrachtung des Kunstwerkes in die
Subjektivität des geistreichen Apercus zu verfallen. Wenn man sich die Frage nach
der Möglichkeit der Kunstwissenschaft stellt, wird man an Strzygowskis Pro-
gramm nicht vorbeigehen dürfen.
Wien. Ludwig von Bertalanffy.
Immanuel Kant, Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Nach
der Handschrift herausgegeben und mit Einführung und Anmerkungen ver-
sehen von Gerhard Lehmann. Der Philosophischen Bibliothek Bd. 39b.
Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1927. VIH u. 83 S.
Mit dieser auch in philosophischer Hinsicht vortrefflichen Ausgabe der ersten
Einleitung in die Kritik der Urteilskraft hat Gerhard Lehmann in dankenswerter
Weise eine Unterlassungssünde der neukantischen Richtung gutgemacht. Denn ob-
wohl die noch von Kant selber durchgesehene, verbesserte und durch einige An-
merkungen ergänzte Abschrift des Originals sich seit langem im Besitze der Rostocker
Universitätsbibliothek befindet und von keinem Geringeren als von Wilhelm Dillhey
bereits im Jahre 1889 in einem längeren Aufsatze behandelt worden ist (Die Rostocker
Kant-Handschriften, Archiv für Geschichte der Philosophie Bd. II, S. 593 ff.), ist jene
Erste Einleitung, abgesehen von ihrem erstmaligen Abdruck im 2. Bd. der Cassirer-
schen Kant-Ausgabe (Berlin 1922, Herausgeber Otto Buek), doch bis jetzt ohne
Berücksichtigung geblieben. Aber Bueks Ausgabe ist, wie G. Lehmann unter An-
führung von Beispielen angibt, in editionstechnischer und philologischer Beziehung
nicht einwandfrei. Und dabei ist diese Erste Einleitung von nicht zu unterschätzen-
der Bedeutung für den methodischen Ausbau der kritischen Philosophie und für
unser Verständnis derselben. Je mehr Kant nämlich in diesem Ausbau fortschritt
und nach dem Abschluß der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der prak-
tischen Vernunft sich in seiner kritischen Arbeit nun vor die Aufgabe der Grund-
legung der ästhetischen Vernunft gestellt sah, umso mehr mußte sich ihm das Pro-
blem der Einheit und des Systems des Kritizismus aufdrängen und umso lebhafter
mußte ihn als konstruktiv-systematischen Denker zugleich die Frage beschäftigen,
welche Stelle gerade die Ästhetik innerhalb des kritischen Systems einnehme, und
welche Rolle sie in diesem System spiele. Und diese beiden Fragen sind es in der
Tat, die in jener Einleitung, wenn auch nicht endgültig gelöst, so doch erwogen
werden. Wenn noch heute, rund 140 Jahre nach ihrem Erscheinen, die Kritik der
Urteilskraft als das klassische Grundwerk der systematischen Ästhetik gilt, so ist
ihr Ansehen nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß Kant neben dem überzeugen-
den Nachweis der Autonomie der Ästhetik, ihrer Koordination neben der Erkennt-
nistheorie und der Ethik, dennoch denjenigen Ort aufgedeckt hat, den sie trotz oder
wegen ihrer Autonomie in der umfassenden Einheit der philosophischen Systematik
innehat. Bezieht sich die Kritik der reinen Vernunft auf die Grundlegung der Natur
(der empirischen Wirklichkeit) und leistet die Kritik der praktischen Vernunft die
Grundlegung der Freiheit (der sittlichen Wirklichkeit des Sollens), so weist nun die
Kritik der Urteilskraft nach, daß das ästhetische Vermögen und das Gebiet der
Kunst die Vermittlung zwischen jenen Reichen der Natur und der Freiheit voll-
ziehen beziehungsweise bedeuten, daß es die »Urteilskraft« ist, die diesen Dualis-
mus überwindet. In großen und großartigen Zügen skizziert die Erste Einleitung
diese eigentümliche Verknüpfungsfunktion der Urteilskraft und damit die systema-
tische Unentbehrlichkeit der Ästhetik, die auf diese Weise in das System der Philo-