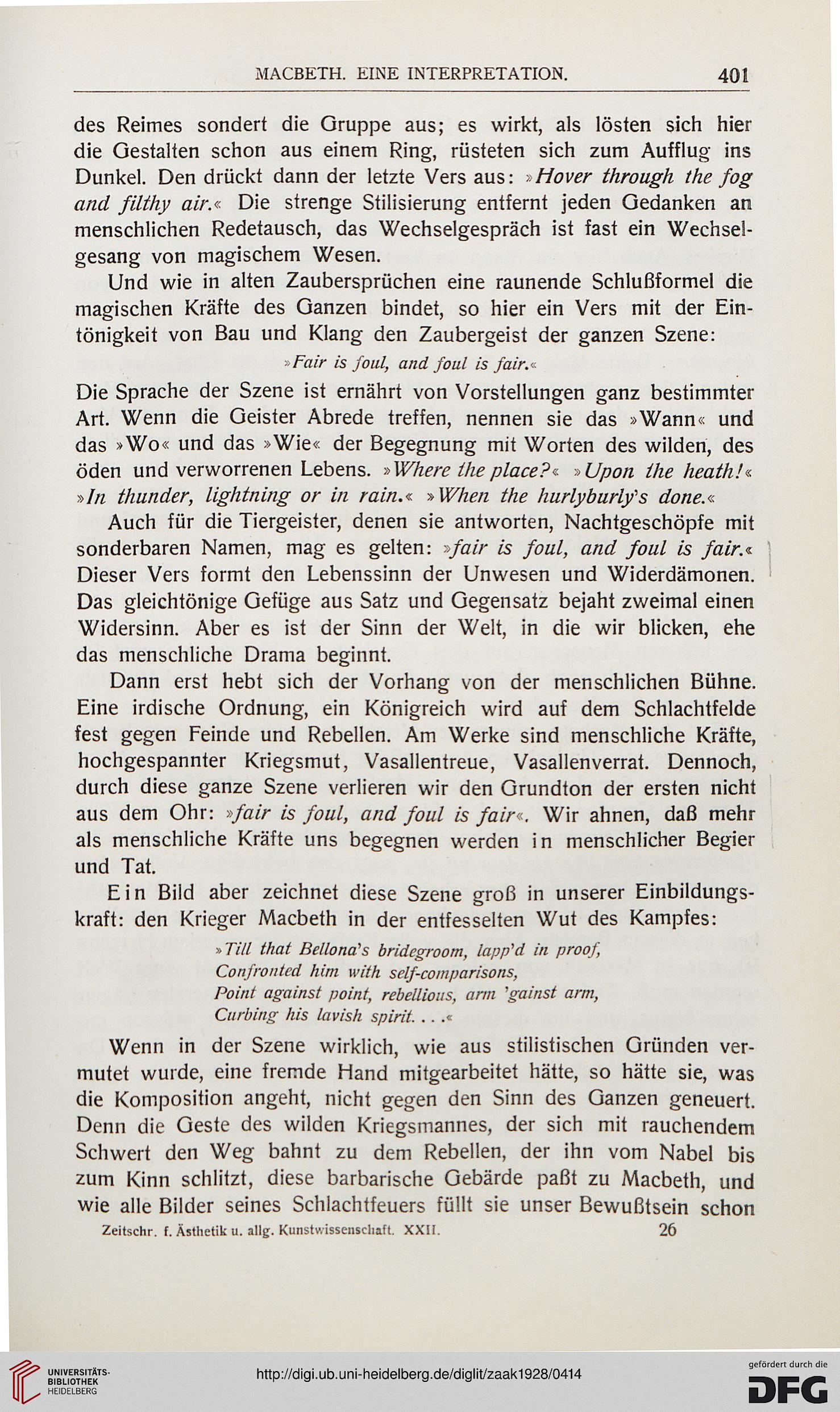MACBETH. EINE INTERPRETATION.
401
des Reimes sondert die Gruppe aus; es wirkt, als lösten sich hier
die Gestalten schon aus einem Ring, rüsteten sich zum Aufflug ins
Dunkel. Den drückt dann der letzte Vers aus: Höver through the fog
and filthy air.« Die strenge Stilisierung entfernt jeden Gedanken an
menschlichen Redetausch, das Wechselgespräch ist fast ein Wechsel-
gesang von magischem Wesen.
Und wie in alten Zaubersprüchen eine raunende Schlußformel die
magischen Kräfte des Ganzen bindet, so hier ein Vers mit der Ein-
tönigkeit von Bau und Klang den Zaubergeist der ganzen Szene:
»Fair is foul, and foul is fair.--
Die Sprache der Szene ist ernährt von Vorstellungen ganz bestimmter
Art. Wenn die Geister Abrede treffen, nennen sie das »Wann« und
das »Wo« und das »Wie« der Begegnung mit Worten des wilden, des
öden und verworrenen Lebens. »Where the place?« »lipon ihe heath!«.
»In thunder, lightning or in rain.«~ »When the hurlyburl/s done.«
Auch für die Tiergeister, denen sie antworten, Nachtgeschöpfe mit
sonderbaren Namen, mag es gelten: »fair is foul, and foul is fair.*
Dieser Vers formt den Lebenssinn der Unwesen und Widerdämonen.
Das gleichtönige Gefüge aus Satz und Gegensatz bejaht zweimal einen
Widersinn. Aber es ist der Sinn der Welt, in die wir blicken, ehe
das menschliche Drama beginnt.
Dann erst hebt sich der Vorhang von der menschlichen Bühne.
Eine irdische Ordnung, ein Königreich wird auf dem Schlachtfelde
fest gegen Feinde und Rebellen. Am Werke sind menschliche Kräfte,
hochgespannter Kriegsmut, Vasallentreue, Vasallenverrat. Dennoch,
durch diese ganze Szene verlieren wir den Grundton der ersten nicht
aus dem Ohr: »fair is foul, and foul is fair«. Wir ahnen, daß mehr
als menschliche Kräfte uns begegnen werden in menschlicher Begier
und Tat.
Ein Bild aber zeichnet diese Szene groß in unserer Einbildungs-
kraft: den Krieger Macbeth in der entfesselten Wut des Kampfes:
»Till that Bellono?s bridcgroom, lapp'd in prooj]
Confronted htm with seif-comparisons,
Point against point, rebellious, arm 'gainst arm,
Curbing Iiis lavish spirit. . . .«
Wenn in der Szene wirklich, wie aus stilistischen Gründen ver-
mutet wurde, eine fremde Hand mitgearbeitet hätte, so hätte sie, was
die Komposition angeht, nicht gegen den Sinn des Ganzen geneuert.
Denn die Geste des wilden Kriegsmannes, der sich mit rauchendem
Schwert den Weg bahnt zu dem Rebellen, der ihn vom Nabel bis
zum Kinn schlitzt, diese barbarische Gebärde paßt zu Macbeth, und
wie alle Bilder seines Schlachtfeuers füllt sie unser Bewußtsein schon
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXI1. 26
401
des Reimes sondert die Gruppe aus; es wirkt, als lösten sich hier
die Gestalten schon aus einem Ring, rüsteten sich zum Aufflug ins
Dunkel. Den drückt dann der letzte Vers aus: Höver through the fog
and filthy air.« Die strenge Stilisierung entfernt jeden Gedanken an
menschlichen Redetausch, das Wechselgespräch ist fast ein Wechsel-
gesang von magischem Wesen.
Und wie in alten Zaubersprüchen eine raunende Schlußformel die
magischen Kräfte des Ganzen bindet, so hier ein Vers mit der Ein-
tönigkeit von Bau und Klang den Zaubergeist der ganzen Szene:
»Fair is foul, and foul is fair.--
Die Sprache der Szene ist ernährt von Vorstellungen ganz bestimmter
Art. Wenn die Geister Abrede treffen, nennen sie das »Wann« und
das »Wo« und das »Wie« der Begegnung mit Worten des wilden, des
öden und verworrenen Lebens. »Where the place?« »lipon ihe heath!«.
»In thunder, lightning or in rain.«~ »When the hurlyburl/s done.«
Auch für die Tiergeister, denen sie antworten, Nachtgeschöpfe mit
sonderbaren Namen, mag es gelten: »fair is foul, and foul is fair.*
Dieser Vers formt den Lebenssinn der Unwesen und Widerdämonen.
Das gleichtönige Gefüge aus Satz und Gegensatz bejaht zweimal einen
Widersinn. Aber es ist der Sinn der Welt, in die wir blicken, ehe
das menschliche Drama beginnt.
Dann erst hebt sich der Vorhang von der menschlichen Bühne.
Eine irdische Ordnung, ein Königreich wird auf dem Schlachtfelde
fest gegen Feinde und Rebellen. Am Werke sind menschliche Kräfte,
hochgespannter Kriegsmut, Vasallentreue, Vasallenverrat. Dennoch,
durch diese ganze Szene verlieren wir den Grundton der ersten nicht
aus dem Ohr: »fair is foul, and foul is fair«. Wir ahnen, daß mehr
als menschliche Kräfte uns begegnen werden in menschlicher Begier
und Tat.
Ein Bild aber zeichnet diese Szene groß in unserer Einbildungs-
kraft: den Krieger Macbeth in der entfesselten Wut des Kampfes:
»Till that Bellono?s bridcgroom, lapp'd in prooj]
Confronted htm with seif-comparisons,
Point against point, rebellious, arm 'gainst arm,
Curbing Iiis lavish spirit. . . .«
Wenn in der Szene wirklich, wie aus stilistischen Gründen ver-
mutet wurde, eine fremde Hand mitgearbeitet hätte, so hätte sie, was
die Komposition angeht, nicht gegen den Sinn des Ganzen geneuert.
Denn die Geste des wilden Kriegsmannes, der sich mit rauchendem
Schwert den Weg bahnt zu dem Rebellen, der ihn vom Nabel bis
zum Kinn schlitzt, diese barbarische Gebärde paßt zu Macbeth, und
wie alle Bilder seines Schlachtfeuers füllt sie unser Bewußtsein schon
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXI1. 26