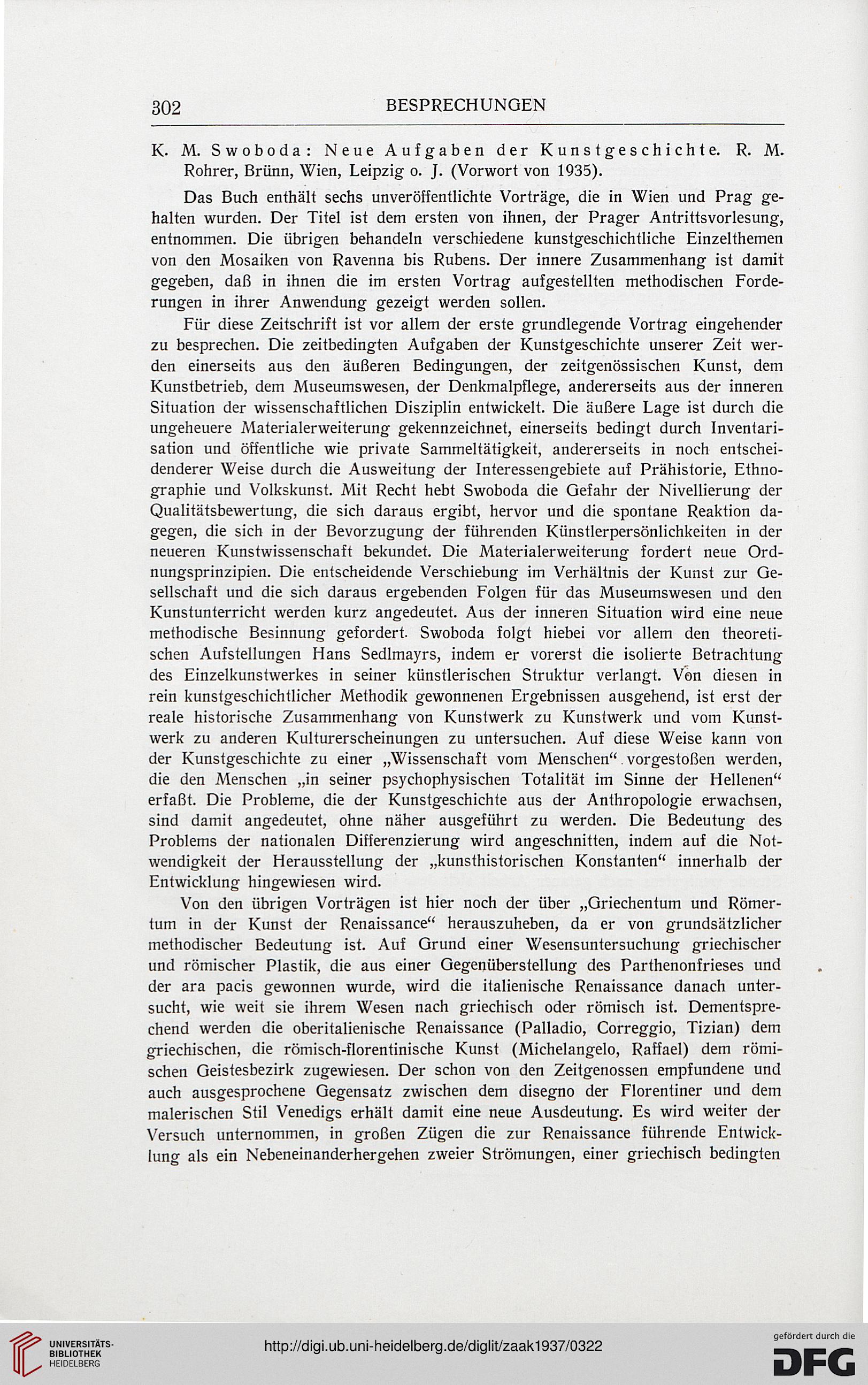302
BESPRECHUNGEN
K. M. Swoboda: Neue Aufgaben der Kunstgeschichte. R. M.
Rohrer, Brünn, Wien, Leipzig o. J. (Vorwort von 1935).
Das Buch enthält sechs unveröffentlichte Vorträge, die in Wien und Prag ge-
halten wurden. Der Titel ist dem ersten von ihnen, der Prager Antrittsvorlesung,
entnommen. Die übrigen behandeln verschiedene kunstgeschichtliche Einzelthemen
von den Mosaiken von Ravenna bis Rubens. Der innere Zusammenhang ist damit
gegeben, daß in ihnen die im ersten Vortrag aufgestellten methodischen Forde-
rungen in ihrer Anwendung gezeigt werden sollen.
Für diese Zeitschrift ist vor allem der erste grundlegende Vortrag eingehender
zu besprechen. Die zeitbedingten Aufgaben der Kunstgeschichte unserer Zeit wer-
den einerseits aus den äußeren Bedingungen, der zeitgenössischen Kunst, dem
Kunstbetrieb, dem Museumswesen, der Denkmalpflege, andererseits aus der inneren
Situation der wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Die äußere Lage ist durch die
ungeheuere Materialerweiterung gekennzeichnet, einerseits bedingt durch Inventari-
sation und öffentliche wie private Sammeltätigkeit, andererseits in noch entschei-
denderer Weise durch die Ausweitung der Interessengebiete auf Prähistorie, Ethno-
graphie und Volkskunst. Mit Recht hebt Swoboda die Gefahr der Nivellierung der
Qualitätsbewertung, die sich daraus ergibt, hervor und die spontane Reaktion da-
gegen, die sich in der Bevorzugung der führenden Künstlerpersönlichkeiten in der
neueren Kunstwissenschaft bekundet. Die Materialerweiterung fordert neue Ord-
nungsprinzipien. Die entscheidende Verschiebung im Verhältnis der Kunst zur Ge-
sellschaft und die sich daraus ergebenden Folgen für das Museumswesen und den
Kunstunterricht werden kurz angedeutet. Aus der inneren Situation wird eine neue
methodische Besinnung gefordert. Swoboda folgt hiebei vor allem den theoreti-
schen Aufstellungen Hans Sedlmayrs, indem er vorerst die isolierte Betrachtung
des Einzelkunstwerkes in seiner künstlerischen Struktur verlangt. Von diesen in
rein kunstgeschichtlicher Methodik gewonnenen Ergebnissen ausgehend, ist erst der
reale historische Zusammenhang von Kunstwerk zu Kunstwerk und vom Kunst-
werk zu anderen Kulturerscheinungen zu untersuchen. Auf diese Weise kann von
der Kunstgeschichte zu einer „Wissenschaft vom Menschen" vorgestoßen werden,
die den Menschen „in seiner psychophysischen Totalität im Sinne der Hellenen"
erfaßt. Die Probleme, die der Kunstgeschichte aus der Anthropologie erwachsen,
sind damit angedeutet, ohne näher ausgeführt zu werden. Die Bedeutung des
Problems der nationalen Differenzierung wird angeschnitten, indem auf die Not-
wendigkeit der Herausstellung der „kunsthistorischen Konstanten" innerhalb der
Entwicklung hingewiesen wird.
Von den übrigen Vorträgen ist hier noch der über „Griechentum und Römer-
tum in der Kunst der Renaissance" herauszuheben, da er von grundsätzlicher
methodischer Bedeutung ist. Auf Grund einer Wesensuntersuchung griechischer
und römischer Plastik, die aus einer Gegenüberstellung des Parthenonfrieses und
der ara pacis gewonnen wurde, wird die italienische Renaissance danach unter-
sucht, wie weit sie ihrem Wesen nach griechisch oder römisch ist. Dementspre-
chend werden die oberitalienische Renaissance (Palladio, Correggio, Tizian) dem
griechischen, die römisch-florentinische Kunst (Michelangelo, Raffael) dem römi-
schen Geistesbezirk zugewiesen. Der schon von den Zeitgenossen empfundene und
auch ausgesprochene Gegensatz zwischen dem disegno der Florentiner und dem
malerischen Stil Venedigs erhält damit eine neue Ausdeutung. Es wird weiter der
Versuch unternommen, in großen Zügen die zur Renaissance führende Entwick-
lung als ein Nebeneinanderhergehen zweier Strömungen, einer griechisch bedingten
BESPRECHUNGEN
K. M. Swoboda: Neue Aufgaben der Kunstgeschichte. R. M.
Rohrer, Brünn, Wien, Leipzig o. J. (Vorwort von 1935).
Das Buch enthält sechs unveröffentlichte Vorträge, die in Wien und Prag ge-
halten wurden. Der Titel ist dem ersten von ihnen, der Prager Antrittsvorlesung,
entnommen. Die übrigen behandeln verschiedene kunstgeschichtliche Einzelthemen
von den Mosaiken von Ravenna bis Rubens. Der innere Zusammenhang ist damit
gegeben, daß in ihnen die im ersten Vortrag aufgestellten methodischen Forde-
rungen in ihrer Anwendung gezeigt werden sollen.
Für diese Zeitschrift ist vor allem der erste grundlegende Vortrag eingehender
zu besprechen. Die zeitbedingten Aufgaben der Kunstgeschichte unserer Zeit wer-
den einerseits aus den äußeren Bedingungen, der zeitgenössischen Kunst, dem
Kunstbetrieb, dem Museumswesen, der Denkmalpflege, andererseits aus der inneren
Situation der wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Die äußere Lage ist durch die
ungeheuere Materialerweiterung gekennzeichnet, einerseits bedingt durch Inventari-
sation und öffentliche wie private Sammeltätigkeit, andererseits in noch entschei-
denderer Weise durch die Ausweitung der Interessengebiete auf Prähistorie, Ethno-
graphie und Volkskunst. Mit Recht hebt Swoboda die Gefahr der Nivellierung der
Qualitätsbewertung, die sich daraus ergibt, hervor und die spontane Reaktion da-
gegen, die sich in der Bevorzugung der führenden Künstlerpersönlichkeiten in der
neueren Kunstwissenschaft bekundet. Die Materialerweiterung fordert neue Ord-
nungsprinzipien. Die entscheidende Verschiebung im Verhältnis der Kunst zur Ge-
sellschaft und die sich daraus ergebenden Folgen für das Museumswesen und den
Kunstunterricht werden kurz angedeutet. Aus der inneren Situation wird eine neue
methodische Besinnung gefordert. Swoboda folgt hiebei vor allem den theoreti-
schen Aufstellungen Hans Sedlmayrs, indem er vorerst die isolierte Betrachtung
des Einzelkunstwerkes in seiner künstlerischen Struktur verlangt. Von diesen in
rein kunstgeschichtlicher Methodik gewonnenen Ergebnissen ausgehend, ist erst der
reale historische Zusammenhang von Kunstwerk zu Kunstwerk und vom Kunst-
werk zu anderen Kulturerscheinungen zu untersuchen. Auf diese Weise kann von
der Kunstgeschichte zu einer „Wissenschaft vom Menschen" vorgestoßen werden,
die den Menschen „in seiner psychophysischen Totalität im Sinne der Hellenen"
erfaßt. Die Probleme, die der Kunstgeschichte aus der Anthropologie erwachsen,
sind damit angedeutet, ohne näher ausgeführt zu werden. Die Bedeutung des
Problems der nationalen Differenzierung wird angeschnitten, indem auf die Not-
wendigkeit der Herausstellung der „kunsthistorischen Konstanten" innerhalb der
Entwicklung hingewiesen wird.
Von den übrigen Vorträgen ist hier noch der über „Griechentum und Römer-
tum in der Kunst der Renaissance" herauszuheben, da er von grundsätzlicher
methodischer Bedeutung ist. Auf Grund einer Wesensuntersuchung griechischer
und römischer Plastik, die aus einer Gegenüberstellung des Parthenonfrieses und
der ara pacis gewonnen wurde, wird die italienische Renaissance danach unter-
sucht, wie weit sie ihrem Wesen nach griechisch oder römisch ist. Dementspre-
chend werden die oberitalienische Renaissance (Palladio, Correggio, Tizian) dem
griechischen, die römisch-florentinische Kunst (Michelangelo, Raffael) dem römi-
schen Geistesbezirk zugewiesen. Der schon von den Zeitgenossen empfundene und
auch ausgesprochene Gegensatz zwischen dem disegno der Florentiner und dem
malerischen Stil Venedigs erhält damit eine neue Ausdeutung. Es wird weiter der
Versuch unternommen, in großen Zügen die zur Renaissance führende Entwick-
lung als ein Nebeneinanderhergehen zweier Strömungen, einer griechisch bedingten